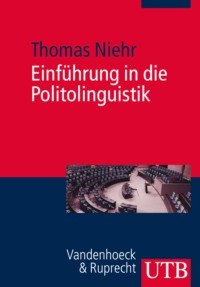Kitabı oku: «Einführung in die Politolinguistik», sayfa 3
1. Inhalt/Gegenstand des Textes
2. Inszenierung des Inhalts (sprachliche Analyse)
3. Sinn der Inszenierung (Rückgriff auf den sozialgeschichtlichen Kontext)
4. Zusammenfassung der Analyse
5. Entwicklung konkurrierender Lesweisen (falls sich bei 4 Widersprüche ergeben haben).
Wendet man diese Schritte auf den zitierten Text an, so kommt man zu folgenden Ergebnissen (vgl. ebd.: 23 ff.):
1. Es geht um die Rationierungsmaßnahmen bei der Bewirtschaftung von Nahrungs- und Futtermitteln.
2. Interessant ist die spezielle Inszenierung dieses Textes: So können beispielsweise die meisten Attribuierungen weggelassen werden, ohne dass sich der Sinn des Textes ändert. Auf die Adressaten erfolgt ein persönlicher Zugriff: Es heißt nicht, wie man vielleicht erwarten könnte, jeder muß – es ist zu tun, sondern: Dein gewohnter Verteiler, Du mußt Dich an ihn wenden. Es handelt sich also um die Umkehrung des sonst üblichen Ablaufs: Nicht der Staat erhebt Steuern, sondern der Bürger selbst muss aktiv werden. Diese Maßnahme gilt nicht ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft, sondern: ab sofort. Das heißt: Schon vor der Lektüre, nämlich bei Drucklegung, trat dieses Verfahren in Kraft. Wer immer den Aufruf liest, hätte schon vorher so handeln müssen. Mithin ist er auch schon schuldig geworden.
3. Diese spezielle sprachliche Inszenierung verweist auf eine weitere Botschaft, die man nur versteht, wenn man die gesellschaftlichen Verhältnisse der Zeit mit berücksichtigt. Es herrschte ein traditionell feindliches Verhältnis zur Obrigkeit: Diese nimmt bzw. presst den Bauern etwas ab. Die Steuereinnehmer bezahlten dies nicht selten mit ihrem Leben. Die organischen Strukturen wie Familie, Dorf, die auch immer latente Widerstandsinseln gegen staatlichen Zugriff waren, sollten aufgelöst werden. Deshalb wird in diesem Aufruf das Individuum direkt angesprochen und persönlich verpflichtet. Dabei werden aber geschickt traditionelle Bezüge instrumentalisiert, etwa der gewohnte Verteiler. Weiterhin ist bemerkenswert, dass es im gesamten Text keine weltanschauliche Legitimation der Maßnahmen gibt, auch Hinweise auf die nationalsozialistische Ideologie sind hier nicht zu finden. Es gibt also keine Begründungen der Maßnahmen, lediglich wird das Verfahren ausführlich geschildert (Warum? Was? Wie? Wann? Wer? Wo? usw.).
4. Üblicherweise bedürfen solche staatlichen Maßnahmen einer Kontrolle. Eine solche ist für den hier angesprochenen Bereich (hauswirtschaftliche bäuerliche Betriebe, die nicht mit moderner Großlandwirtschaft zu vergleichen sind) nicht denkbar, weil die Zahl der Kontrolleure der der Kontrollierten entsprechen müsste. Eine effektive Kontrolle dieser Maßnahme wäre also gar nicht möglich gewesen.
5. Trotzdem wird ein Kontrollapparat angesprochen, der jedoch eine andere Qualität hat. Gefordert wird in diesem Text eine Selbstkontrolle: Jeder, der den neuen Staat will, trägt durch Selbstkontrolle seinen Teil dazu bei. Dabei ist diese Selbstkontrolle nicht auf das eigene, individuelle Handeln beschränkt. Denn jeder kann potenziell auch sein soziales Umfeld kontrollieren. Jeder muss also damit rechnen, von seinem Umfeld, z. B. Nachbarn, kontrolliert zu werden. Damit ist der Aufruf gleichzeitig ein Aufruf zur Denunziation. Da die Identifikation mit dem neuen Staat sich vor allem an die Jugend richtete, hatte man sozusagen in jedem Haushalt, in jedem Bauernhof die Kontrollinstanz vertreten. Und Denunziationen von Eltern durch die eigenen Kinder waren durchaus keine Seltenheit.
Zusammenfassend lässt sich zu diesem Text also sagen, dass sich hier der neue Staat inszeniert:
An der Oberfläche richtet sich die Inszenierung an die Parteigänger, die bereit sind, das Neue unter Opfern zu schaffen; die über ihre Identifikation aber auch als Kontrollinstanz für die andern fungieren. Das wird mit diesem Text auch der Masse der Indifferenten, der Verweigerer deutlich gemacht, die in Angst vor der Denunziation versetzt werden – und so vermittelt eben auch von der realen Vergesellschaftung erfaßt werden. (Maas 1984: 27)
Eine solche „polyphone“ Interpretation von Texten kann man – das sollte die Analyse deutlich gemacht haben – nur erreichen, wenn man den sozialgeschichtlichen Kontext in die Analyse mit einbezieht. Nur so kann das vereinfachende Schema „oben vs. unten“ umgangen werden.
Über die Analyse von Einzeltexten hinaus geht eine Studie von Heidrun Kämper, die sich mit dem Schulddiskurs in der frühen Nachkriegszeit beschäftigt.
Besonders interessant an diesem Werk ist, dass Kämper zwischen Texten von Opfern, Tätern und Nichttätern unterscheidet. Anhand derer arbeitet sie heraus, welche Charakteristika der Sprachgebrauch der einzelnen Gruppen aufweist, wenn sie über Schuld in der NS-Zeit reden. Bei den Opfern ist beispielsweise markant, dass sie Freiheit „als Begriff zur Bezeichnung des Gegenteils von Knechtschaft und Unterdrückung“ (Kämper 2005: 468) auffassen. In ihrem Diskurs spielen Erinnerungsorte (wie Lager, Appellplatz, Steinbruch) etc. eine große Rolle.13 Der Schulddiskurs der Täter hingegen hat eine rechtfertigende Grundtendenz (vgl. ebd.: 471). Vergangenheitsbezogene Äußerungen dienen der Selbstverteidigung und Schuldabwehr. Wörter wie ausrotten, Sonderbehandlung werden umgedeutet, die eigenen Taten marginalisiert und das eigene Denken und Wollen idealisiert (Glaube, Liebe, Hoffnung, Dienst, Pflicht) (vgl. ebd.). Der Diskurs der Nichttäter – damit sind Menschen gemeint, die sich vom Nationalsozialismus fernhalten konnten – kann dagegen am ehesten mit „analytisch-diagnostisch angelegten Reflexionen zur Schuld der Deutschen“ (ebd.: 473) umschrieben werden. Wichtige Vokabeln in diesem Zusammenhang sind beispielsweise Abendland, Demokratie, Kollektivschuld, -scham, Kultur, Wiedergutmachung.
Auf reges Interesse stießen seit jeher die rhetorischen Besonderheiten, die man in NS-Reden feststellen kann. Dass es allerdings so etwas wie eine spezielle NS-Rhetorik gegeben habe, lässt sich mit guten Gründen bezweifeln. Die Redecharakteristika lassen sich eher mit der in der Weimarer Zeit verbreiteten „allgemein übertriebenen, verwilderten Art des Redens in großen Freiräumen ohne bzw. mit noch primitiver Mikrophon- und Übertragungseinrichtung“ (von Polenz 1999: 553) erklären.
Als Beispiel für eine solch eine verwilderte Art des Redens kann eine Rede Hitlers vom 8. November 1940 stehen, aus der hier einige kurze Auszüge genügen sollen (Domarus 1965: 1606):
Und so, nachdem er das an sich nicht mehr bestreiten kann, hat sich dieser genialste Stratege, der bisher geboren wurde, auf den Luftkrieg gestürzt. Denn es ist schon eine geniale Idee von Mr. Churchill gewesen, ausgerechnet mit der Waffe, mit der England uns gegenüber am allerschwächsten ist, den Luftkrieg anzufangen. […] Man hat Bomben geworfen auf die Zivilbevölkerung in Westfalen. Und ich habe dann 14 Tage zugesehen und dachte mir: Der Mann ist wahnsinnig! […] Ich habe über drei Monate gewartet, und dann eines Tages allerdings gab ich nun den Befehl: So, ich nehme jetzt diesen Kampf auf, und ich nehme ihn auf mit der Entschlossenheit, mit der ich noch jeden Kampf aufnahm. Das heißt: jetzt Kampf bis zum letzten! Sie wollten es, sie sollen es haben! Sie wollten Deutschland durch den Luftkrieg vernichten. Ich werde ihnen jetzt zeigen, wer vernichtet wird! Das englische Volk, das ich nun bedaure, kann sich dafür bei seinem Generalverbrecher Churchill bedanken. […] Dieses Deutschland wird durch jede Bombe fanatischer. Seine Entschlußkraft wird nur noch stärker, es weiß vor allem: Mit diesem Unfug muß einmal für immer aufgeräumt werden. Und dazu sind wir entschlossen.
Möchte man NS-Reden linguistisch untersuchen, steht man heutzutage vor dem Problem, dass häufig nur die Manuskripte vorliegen, von denen die Redner möglicherweise abgewichen sind. Für die Massenwirksamkeit dieser Reden bzw. Redner dürften aber insbesondere auch parasprachliche Faktoren wie Intonation, Akzentuierung, Satzmelodie, Lautstärke etc. verantwortlich gewesen sein. Hinzu kommen Verhaltensmerkmale wie Mimik und Gestik des Redners. Nicht zu vergessen sind auch situative Faktoren, sozusagen das Setting dieser Reden: Sie fanden häufig an historischen Orten statt, die Rednertribüne wurde wie ein Altar hergerichtet, es gab quasi rituelle Begleithandlungen (z. B. militärische Aufmärsche) und eine genau durchchoreographierte Dramaturgie. Die Auftritte wurden so zu einem faschistischen Gemeinschaftserlebnis, in dem die Sprache möglicherweise nur eine untergeordnete Rolle spielte.
Vor diesem Hintergrund scheint es problematisch, solche Reden zu analysieren, indem man die angewandten sprachlichen Mittel lediglich auflistet.14 Eine solche „disparate Zusammenstellung […] erlaubt im Grund keinen Zugriff auf die nationalsozialistische Spezifik des Redens. Es handelt sich um Redemittel, die sich leicht in sehr vielen anderen älteren und neueren Reden auffinden lassen“ (Sauer 2003: 98). Stattdessen komme es darauf an, so fordert Sauer (ebd.: 109), den Untersuchungsansatz zu erweitern und die Analysen nicht auf einzelne Reden bzw. Redner einzuschränken. Vielversprechender sei es dagegen, die sprachlichen Verhältnisse insgesamt in den Blick zu nehmen:
Vereinfacht ausgedrückt, geht es um die Frage, was die Menschen davon hatten, dass sie sich eine Hitler-Rede anhörten oder sie in der Zeitung nachlasen (noch abgesehen davon, dass öfters auch die Zuhörer zum Zuhören verpflichtet waren) – und was das Regime davon hatte, dass es so aufwändige Veranstaltungen betrieb, bei denen eben den vielen Vorsichtsmaßnahmen zum Trotz nicht alle Faktoren zu kontrollieren waren. (Ebd.: 100)
Wichtig bei all diesen Beobachtungen bleibt, dass der Erfolg solcher Inszenierungen auf einer bestimmten Sprecher-Hörer-Konstellation beruht, in der es etwa dem Sprecher gelingt, „kollektiven Stimmungen eine Stimme zu geben und sie so aus ihrer quälenden Sprachlosigkeit zu erlösen“ (Kopperschmidt 2003c: 190). Dies betont auch von Polenz (1999: 548) in wünschenswerter Deutlichkeit, wenn er schreibt:
Unter politischem Sprachgebrauch ist nicht nur Propaganda und ‚Manipulation‘ von ‚oben‘ nach ‚unten‘ zu verstehen, sondern auch das Sprachverhalten der eine politische Richtung mittragenden Massen aufgrund sprachlicher und politischer Prädispositionen und Erwartungen.
Eine unabdingbare Voraussetzung für Redeerfolge ist also immer die Zustimmung eines Redepublikums (vgl. Kopperschmidt 2003b: 19). Dies muss man bei linguistischen Analysen von NS-Reden stets im Blick behalten.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass der Sprachgebrauch der Nationalsozialisten am besten „als Teil eines sprachgeschichtlichen Kontinuums“ (Braun 2007: 226) zu begreifen ist, denn weder der sprachliche Antisemitismus, die Sportmetaphorik oder auch die sakrale Ausdrucksweise noch militärische oder technische Metaphern sind neu im politischen Sprachgebrauch gewesen.15
2.4.3 Frühe Studien zur Sprache in der DDR und der BRD
Betrachtet man die Erforschung der Sprache in der DDR bzw. der sprachlichen Auswirkungen, die die Teilung Deutschlands mit sich brachte, so zeigt sich besonders deutlich, dass frühe politolinguistische Studien häufig mit entscheidenden methodischen Mängeln behaftet waren. So sieht man bei zahlreichen Studien zur Sprache der DDR, dass andere als linguistische Aspekte eine Rolle spielten. Manfred W. Hellmann, einer der exponiertesten Erforscher der DDR-Sprache, zählt insbesondere die folgenden Punkte auf (1980: 519 ff.).
1. Der nationale Aspekt
Es wurde zu einem nationalen Politikum, ob die deutsche Sprache überhaupt noch eine funktionstüchtige gemeinsame Sprache der BRD und der DDR war. Während zunächst von beiden Seiten die Einheit der deutschen Sprache betont wurde, kam es nach politisch brisanten Ereignissen wie z. B. dem Mauerbau 1961 von westlicher Seite zu dem Vorwurf, die DDR-Führung wolle nach der politischen auch eine sprachliche Spaltung herbeiführen. In der zweiten Hälfte der 60er Jahre waren die BRD-Forscher sich allerdings einig, dass die These von einer möglichen Sprachspaltung nicht zu halten sei. In der DDR hob man dagegen die Eigenständigkeit und Fortschrittlichkeit der eigenen sprachlichen Entwicklung hervor. In den 70er Jahren vertrat der Linguist Gottfried Lerchner dementsprechend die These von vier nationalsprachlichen Varianten des Deutschen. Gemeint sind hier also das Deutsch in der BRD, der Schweiz und Österreich sowie der DDR.16
2. Der politisch-ideologische Aspekt
Während DDR-Forscher immer wieder das Klassenkampfschema bemühten, übertrafen die BRD-Forscher sich teilweise in ihrer antikommunistischen Haltung. Dies führte dann unweigerlich zu gegenseitigen Manipulationsvorwürfen sowie zum (sinnlosen) Kampf um die „richtige“ Bedeutung von Wörtern.
3. Der gesellschaftsstrukturelle Aspekt
Teilweise wurde nicht berücksichtigt, dass unterschiedliche soziale Verhältnisse für Unterschiede im Sprachgebrauch verantwortlich sein können. Unterschiedliche Sprachgebräuche müssen also nicht zwangsläufig als Ausdruck unterschiedlicher Ideologien interpretiert werden. Insbesondere der Alltagssprachgebrauch der DDR-Bürger wurde kaum untersucht, vielmehr konzentrierte man sich auf den „offiziellen“ politisch-propagandistischen Sprachgebrauch. Hier waren die Unterschiede allerdings offensichtlich.
4. Der kommunikative Aspekt
Durchaus unterschiedlich ist die Frage nach der Verständigungsmöglichkeit zwischen DDR- und BRD-Bürgern beantwortet worden. Lerchner betonte Mitte der 70er Jahre die vorhandene Kommunikationsfähigkeit, während Dieckmann zunehmende Schwierigkeiten beschrieb. Allerdings ist nicht untersucht worden, inwieweit es tatsächlich ausschließlich oder hauptsächlich sprachliche Faktoren sind, die zu Kommunikationsschwierigkeiten führten. Denkbar sind auch biografische, soziale oder gruppenpsychologische Aspekte.
Bevor zur Illustration einzelne Beispiele herangezogen werden, soll zunächst noch einmal zusammenfassend die unterschiedliche Erforschung des sprachlichen Ost-West-Problems in der BRD und DDR betont werden. In der BRD folgte nach der ersten Phase, die eine (von der DDR forcierte) Sprachspaltung betonte, eine Phase, in der häufig der DDR-Sprachgebrauch als „abweichend“ (von einer nicht definierten Norm) dargestellt wurde. Teilweise fehlte diesen Arbeiten die empirische Grundlage und teilweise folgten sie deutlich politischpolemischen Intentionen. Burkhardt (2003a: 133) bezeichnet die Haltung, die solche Arbeiten kennzeichnet, zu Recht als „latent sprachimperialistisch“. Nach der bereits erwähnten Kritik von Dieckmann Mitte der 60er Jahre (vgl. oben S. 19) entstanden dann in der BRD fundiertere Arbeiten. Das Institut für deutsche Sprache (IdS) gründete in Bonn eine eigene Forschungsstelle, die fortan vergleichende empirische Studien zum Sprachgebrauch in der BRD und der DDR – gestützt auf Zeitungstexte aus beiden Staaten – durchführte. Eine dritte Phase lässt sich ab Ende der 70er Jahre ausmachen, in der das Interesse bundesdeutscher Sprachwissenschaftler an dieser Problematik mehr und mehr nachlässt. Lediglich die erwähnte Forschungsstelle des IdS blieb zunächst erhalten. Mit der Vereinigung von BRD und DDR im Jahre 1989 gab es dann noch einmal ein gesteigertes Interesse, das sich unter dem Stichwort „Sprache der Wende“ zusammenfassen lässt. Hierzu gibt es auch einige Veröffentlichungen, auf die zurückzukommen sein wird.
Die DDR-Forschung war größtenteils durch eine „gereizte Verteidigungshaltung“ (Hellmann 1980: 521) gekennzeichnet. Der DDR-Wortschatz sollte als fortschrittlich, der der BRD als manipulativ herausgestellt werden.
Wie lassen sich Unterschiede und Gemeinsamkeiten von BRD- und DDR-Sprache herausarbeiten? Sie müssen auf jeden Fall empirisch erforscht werden. Und – das ist bereits angeklungen – insbesondere in der DDR gab es einen großen Unterschied zwischen offizieller und privater Sprache. Allerdings darf dieser Umstand nicht dazu führen, die DDR-Sprache als ein bloßes Partei-Idiom, als Sprache einer herrschenden Gruppe misszuverstehen. Denn die DDR-Bürger waren ja gezwungen, diese offizielle Sprache zu verstehen und je nach Situation (z. B. im Betrieb) auch zu verwenden. Deshalb ist man schließlich dazu übergegangen, bei DDR- und BRD-Deutsch von gleichwertigen Varianten einer Sprache auszugehen, die beide standardsprachliche Spezifika haben, aber auch durchaus eine gemeinsame Mitte. Ein grundsätzliches Forschungsproblem soll dabei bereits hier angesprochen werden: In der DDR war lediglich der öffentliche – und das heißt weitgehend kontrollierte und normierte – Sprachgebrauch erforschbar. Man hat sich hier meist auf die völlig unter Parteikontrolle stehende Presse bezogen. Der private, umgangssprachliche Sprachgebrauch war für West-Forscher prinzipiell unzugänglich. Zu unterscheiden im DDR-Sprachgebrauch waren drei Kommunikationsbereiche (v. Polenz 1999: 433):
– Öffentlicher Diskurs in allen staatlichen Institutionen (einschließlich Bildungswesen) und Massenmedien; stark normiert und ritualisiert, funktionell ähnlich distanzierend wie deutsche Standardsprache in der Schweiz und in Luxemburg.
– Halböffentlicher Diskurs in kirchlichen und oppositionellen Diskussionsgruppen, im kulturell-literarischen Bereich, auch gruppenintern in der SED, und privat; sprachkritisch, sprachspielerisch, ironisch, zunehmend regional orientiert.
– Privat-zwischenmenschlicher Diskurs im politikfernen Umgang in Familie, Nachbarschaft und Freundeskreis, gespeist aus der eigenen Erfahrungswelt, vom offiziellen Diskurs abgeschirmt […].
Bei den sprachlichen Unterschieden ist zu differenzieren zwischen Unterschieden in der Grammatik, der Lexik und Stilistik. Erstere hat sich als recht stabil erwiesen: Sowohl Syntax wie auch Morphologie sind im Wesentlichen gleich geblieben – es gab wenige marginale Unterschiede. Eine statistische Untersuchung an literarischen Texten hat hier keine Unterschiede aufzeigen können.
Sprachpfleger auf beiden Seiten haben der jeweils anderen Seite Bürokratenjargon, Amtsdeutsch bzw. Funktionärsdeutsch vorgeworfen. Diese Erscheinungen kennzeichneten die DDR-Presse allerdings wesentlich stärker als die BRD-Presse. Insbesondere formelhafte Wendungen wie sozialistische Menschengemeinschaft, brüderliche Kampfesgrüße etc. waren dort häufig anzutreffen (vgl. Hellmann 1980: 522). Diese Erscheinungen hängen sicherlich damit zusammen, dass die DDR-Presse ausnahmslos unter staatlicher Kontrolle stand. In einer Dokumentation des Gesamtdeutschen Instituts aus dem Jahre 1991 sind zahlreiche Beispiele für Zensur der DDR-Presse abgedruckt: Einerseits finden sich dort Hinweise auf Tabus, also auf Themenbereiche, über die aus politischen Gründen nicht berichtet werden durfte:
1. Keinerlei Veröffentlichungen zur Erprobung des ökonomischen Systems in der VVB Schiffsbau, im Kombinat Ruhla, im VEB Carl Zeiss Jena und über Betriebe, die Teile des ökonomischen Systems erproben […].
4. Keine Veröffentlichungen über die Bildung von Kombinaten (Agitationskommission). Als Begründung wurde angegeben, daß zunächst die Erfahrungen der bestehenden Kombinate gründlich ausgewertet werden sollen. […]
8. Keine Veröffentlichungen über die Inbetriebnahme des Düngemittelwerkes Schwedt. (Ministerium für Chemische Industrie – Werk ging verspätet in Betrieb, Anlagen z. T. us kapitalistischem Ausland sind weiterhin störanfällig.) (Gesamtdeutsches Institut 1991: 16 f.)
Andererseits gibt es sogenannte Argumentationshilfen, in denen den Chefredakteuren genau vorgegeben wurde, welche Themen auf welcher Seite der Zeitung zu veröffentlichen bzw. kommentieren waren:
Hinweise für die Zeitungen am 9. Oktober 1978
a) Militärparade an der Spitze der Zeitungen bringen, und zwar in folgender Weise: zunächst einen Bericht über die Militärparade, dann einen zweiten Bericht über Volksfest anhängen
b) Zweispaltig auf der Titelseite das Grußtelegramm der Sowjetunion veröffentlichen. An das Grußtelegramm schließt sich eine knappe Zusammenfassung über weitere ausländische Glückwunschtelegramme zum Nationalfeiertag an.
c) Die Rede auf dem Auszeichnungsakt am Freitag (4 Manuskriptseiten) in der Montag-Ausgabe veröffentlichen. (Ebd.)
Untersuchungen zur Stilistik in west- und ostdeutschen Zeitungen haben ebenfalls zu interessanten Ergebnissen geführt (vgl. v. Polenz 1999: 432 f.). Monika Fingerhut hat die Fußballberichterstattung in der FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG (FAZ) und in der LEIPZIGER VOLKSZEITUNG (LVZ) (1955–1985) vergleichend untersucht und kommt zu folgenden Ergebnissen (vgl. ebd.):
FAZ: Seit den 70er Jahren infolge der Radio- und TV-Konkurrenz mehr Kommentierung, Wertung, Unterhaltung – viel Kritik an Niederlagen, Trainern, Schiedsrichtern – emotionaler, kreativ-spielerischer, witziger Stil – viel Ironie und Metaphorik – viel Satzbauvarianz
LVZ: Medienbedingte Verschiebung schwächer und später; mehr Berichten über Ereignisverlauf (vs. mehr Kommentierung) – keine Kritik. Anerkennung von Leistung auch bei Niederlagen – trockener, formelhafter, archaisch-hochliterarischer Stil – kaum Ironie, wenig Metaphorik, beides bis in die 60er Jahre in Anführungszeichen – Satzbau und Interpunktion mehr traditionell und standardsprachlich.
Exemplarisch kann dies an der Beschreibung derselben Szene in der FAZ und der LVZ gezeigt werden. So liest man 1983 in der LVZ:
Wie aus dem Lehrbuch kam auch von Moldt jener die Abwehr um Österreichs Nationalspieler Pezzey entblößende Pass auf Richter, den der Lok-Mittelstürmer zum goldenen Tor im wahrsten Sinne des Wortes verwandelte. (LVZ Nr. 247/1983, S. 7; zit. nach Fingerhut 1991: 169)
Dieselbe Szene wird in der FAZ weniger ungelenk und mit ironischem Einschlag beschrieben:
Doch den Führungstreffer erzielt in der 35. Minute Lokomotive Leipzig. Hans Richter, ein bulliger, wuchtiger Stürmer (…) lief durch eine Gasse, die Pezzey und Gruber freundlicherweise für ihn offen hielten, und plazierte den Ball ins Tor. (FAZ Nr. 244/1983, S. 23; zit. nach Fingerhut 1991: 169)
Zusammenfassend schreibt Fingerhut (1991: 170) in ihrer kurz nach dem Mauerfall erschienenen Dissertation:
Der Sportjournalismus der Presse hat sich in der Bundesrepublik in den letzten Jahrzehnten wesentlich gewandelt. Die immer stärker werdende Konkurrenz auf dem Mediensektor – Hörfunk, Fernsehen – brachte die Tagespresse in Zugzwang. Diese reagierte entsprechend und verzichtete weitgehend auf eine ausführliche Berichterstattung des Spielverlaufs. Stattdessen gestaltete sie die Berichte im Laufe der Jahrzehnte immer mehr ‚analytisch‘. Hintergrundgeschichten, Zitate und Wertungen des Reporters, die mitunter witzig und originell realisiert werden, sind Belege für das Bemühen nach mehr Informationsvermittlung und Unterhaltung.
In der DDR hat die Einflußnahme der Medien noch nicht die Auswirkungen, wie sie sich in der Bundesrepublik zeigen. Zwar gibt es auch hier Ansätze (z. B. Zitate), die eine Änderung der Gestaltungsweise andeuten, dennoch ist der Ereignisverlauf das dominierende Element.
Inhaltlich – das zeigt ebenfalls die bereits angesprochene Dokumentation des Gesamtdeutschen Instituts – ist die öffentliche (und damit gleichzeitig offizielle) Sprache der DDR durch einen permanenten Klassenkampf gekennzeichnet. Dieser äußert sich in ständigem Eigenlob, gepaart mit massiver Polemik gegen den politischen Gegner, das kapitalistische System. Gerade diese Kombination ist charakteristisch für den offiziellen DDR-Sprachgebrauch.
Der Wortschatz hat sich in der BRD und der DDR teilweise unterschiedlich entwickelt. Am wenigsten betroffen ist hier der Alltagswortschatz wie auch der historisch orientierte Bildungswortschatz. Folgende Phänomene kann man unterscheiden (vgl. Hellmann 1980: 523 ff.):
A) Ausgehend von der Ausdrucksseite
Wörter, bei denen Bezeichnetes und Bezeichnendes nur einer Seite (BRD oder DDR) zuzuordnen sind: Staatskammer, Volkskammer, VEB vs. Bundesregierung, Bundestag, AG. Dies betrifft häufig auch spezifische Wendungen, die teilweise nur kurzzeitig in Gebrauch waren: friedliche Koexistenz, wissenschaftlich-technische Revolution vs. europäische Integration, atlantische Partnerschaft.
Weiterhin gibt es homonyme Wörter, bei denen die Bezeichnung gleich lautet, das Bezeichnete jedoch mehr oder minder unterschiedlich war: APO: ‚Abteilungs-Partei-Organisation‘ vs. ‚Außerparlamentarische Opposition‘.
Schließlich sind Wörter zu nennen, bei denen jeweils eine von mehreren Bedeutungen dominiert: Kommission: ‚Gremium mit autoritativer (Kontroll- oder Leitungs-)Kompetenz‘ vs. ‚Gremium mit beratender Kompetenz‘ oder Kurs: ‚politische Richtung‘ vs. ‚Börsenkurs‘.
Ebenfalls auffällig sind unterschiedliche Frequenzen von Wörtern gleicher Bezeichnung und Bedeutung (DDR): friedliebend, sozialistisch, umfassend, allseitig, Massen; (BRD): freiheitlich, Partnerschaft, Markt, Preis, dynamisch.
B) Ausgehend von der Inhaltsseite
Wörter, die bei gleichem oder ähnlichem Denotat in der BRD und der DDR unterschiedliche Bezeichnungen hatten: Plastik/Plaste, Personalchef/Kaderleiter, Arbeitnehmer/Werktätiger.
Grundsätzlich betrifft die Wortschatzdifferenzierung zwischen BRD und DDR alle Lebensbereiche; besonders stark macht sich die Differenzierung aber in den Bereichen Ideologie/Politik/Propaganda, bei Bezeichnungen für Institutionen und Organisationen und bei wirtschaftlichen Zusammenhängen bemerkbar. Weiterhin gab es erhebliche Differenzierungen im Wortschatz des Erziehungs- bzw. Bildungswesens.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass von einer Sprachspaltung zwischen BRD und DDR nicht gesprochen werden kann, zumindest nicht in dem Sinne, dass eine Verständigung zwischen BRD- und DDR-Bürgern nicht möglich gewesen wäre. Allerdings war diese Verständigung nicht unbedingt problemlos möglich, sie bedurfte teilweise eines erhöhten metakommunikativen Aufwands. Andererseits gab es jedoch auch vielfache direkte Kontakte zwischen BRD- und DDR-Bürgern, insbesondere als Ergebnis der sogenannten Entspannungspolitik in den 60er und 70er Jahren. Weiterhin ist der Einfluss des Westfernsehens nicht zu unterschätzen: Über 80% der DDR-Bürger schauten Westfernsehen. Wenn dieses auch lediglich eine medial vermittelte Wirklichkeit präsentierte, waren die DDR-Bürger über die Verhältnisse und den BRD-Sprachgebrauch besser informiert als umgekehrt. Im Jahre 1990, also kurz nach der Vereinigung von BRD und DDR, stellte Hellmann (1990: 268) resümierend fest:
Es gibt e i n e deutsche Sprache, bezogen auf das grammatische System, die Regeln der Wortbildung, den Grundwortschatz und eine Reihe stilistischer Normen; es gibt aber auch erhebliche Besonderheiten im Wortschatz und im Gebrauch, teilweise auch in den Stilnormen, besonders im öffentlichen Sprachgebrauch.
Dabei dürfte es nicht unbedingt in erster Linie der Wortschatz gewesen sein, der für Kommunikationsschwierigkeiten sorgte. Denn derartige Unterschiede konnte man ja bei privaten Kontakten relativ leicht durch Nachfragen und/oder Vermeiden umgehen. So war es allgemein bekannt, dass Wörter wie Brigade, Broiler, Datsche, Intershop, Kader, Kollektiv typische DDR-Wörter waren, an denen DDR-Bürger eindeutig zu erkennen waren (vgl. von Polenz 1999: 431). Besonders deutlich werden die sprachlichen Unterschiede in ihrer ganzen Tragweite aber erst, wenn man sich alltagsweltliche Sachbereiche anschaut. Am Beispiel des Wohnungsmarktes hat von Polenz dies einmal dargestellt (ebd.: 431 f.):
Im Westen mußte man bei der Wohnungssuche von Eigenbedarf, Kündigung, Makler, Mieterhöhung, Mieterschutz, Mietvorauszahlung, Nebenkosten, rausklagen, Sozialamt, Sozialwohnung, Vermieter, Wohngeldantrag, Wohnungsmarkt, usw. sprechen. Im Osten hatte man es dagegen mit Bedarfsträger, Bevorrechtigung, Feierabendbrigade, Hausgemeinschaft, nichterfaßtes Zimmer, einen Mieter umsetzen, Vergabeplan, Wohnraumlenkung, Wohnungsamt, -antrag, -beauftragter-, -kommission, -tausch, Zuweisung, usw. zu tun; und für all dies gab es in dem jeweils anderen deutschen Staat keine direkten Entsprechungen […], und Altbauwohnung hatte in der DDR eine höchst pejorative Bedeutung.
Inwieweit es heute noch sprachliche Unterschiede zwischen Ost und West gibt, ist nicht ausreichend erforscht.17 Allerdings hat es insbesondere zur sogenannten Wendezeit, also 1989/90, Untersuchungen zum öffentlichen Sprachgebrauch gegeben, die die spezielle sprachliche Situation zur Zeit der Vereinigung von BRD und DDR untersucht haben (vgl. Herberg/Steffens/Tellenbach 1997). Zweifelsohne lässt sich jedoch feststellen, dass diese Vereinigung auch längerfristige sprachliche Konsequenzen hatte:
Das sogenannte offizielle Sprachregister, das die öffentliche Kommunikation [in der DDR, Th.N.] maßgeblich bestimmt hatte, ist binnen weniger Monate bis auf wenige Rudimente bedeutungslos geworden und nur noch sprachhistorisch interessant. […] So sind ganze Teilbereiche des vormals DDR-typischen Wortschatzes gemeinsam mit der SED und dem administrativ-sozialistischen System untergegangen. In anderen Bereichen ist es zu Umbenennungen gekommen, wobei häufig vormals DDR-typische Lexeme durch in der alten BRD geltende ersetzt wurden. Schließlich hat die Adaption der bundesdeutschen Gesellschaftsordnung durch die ehemalige DDR einen Prozeß der Wortwanderung von West nach Ost ausgelöst. (Bauer 1993: 145, 156)
Hellmann stellt in seinem jüngsten Forschungsüberblick fest, dass die „Kommunikation zwischen Ost- und Westbürgern […] in den ersten Jahren nach der friedlichen Revolution desaströs [misslang]“ (Hellmann 2011: 69). Dieses Problem dürfte sich nach Hellmanns Auffassung jedoch mit den nachwachsenden Generationen in Ost und West von selbst erledigen.
Auch die frühen Studien zur Sprache in der BRD und der DDR entsprechen nicht den Standards der deskriptiven Linguistik. Erst mit neueren Forschungen ist es gelungen, die Defizite der früheren Arbeiten auszugleichen.