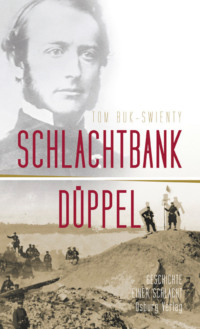Kitabı oku: «Schlachtbank Düppel: 18. April 1864.», sayfa 2
EINLEITUNG: DER VETERAN
Als das Dampfschiff Kegnæs passiert, einen halbinselartigen Vorsprung der Insel Alsen, blickt der berühmte dänische Dichter und Autor Holger Drachmann über den Horizont und sieht in der Ferne die Düppeler Höhe, die, wie er meint, »einem gestrandeten Riesen-Wal ähnlich sieht, der dort liegt und mit dem Tode ringt«.
Es ist der späte Nachmittag des 18. April 1877. Drachmann ist auf dem Weg nach Sønderborg und Düppel, um sich mit eigenen Augen das Schlachtfeld anzusehen, auf dem das dänische Heer dreizehn Jahre zuvor ums Überleben gekämpft hat. Für Drachmann und seine dänischen Zeitgenossen haben ›Düppel‹ und ›18. April‹ einen schicksalsträchtigen Klang. Einen Klang nach Tod und Schmerz.
Als er kurz nach seiner Ankunft in Sønderborg in dem alten Schanzengelände umherwandert, begleitet ihn ein einheimischer dänischer Kriegsveteran als Führer. Der ehemalige Soldat hatte sich während des Granatenbeschusses in den Apriltagen 1864 in der dänischen Stellung aufgehalten und auch den Beginn der Erstürmung erlebt. Am 17. April war er mit seinem Regiment in eine Schanze an die lädierte linke Flanke verlegt worden, wo er bis zum 18. April bleiben musste.
»Und wie haben Sie sich damals gefühlt?«, möchte Drachmann wissen. Der Soldat ist journalistische Fragen offensichtlich nicht gewohnt, und schon gar keine Fragen, bei denen es um Gefühle geht.
»Sie fragen so seltsam!«, antwortet er. Und doch löst die Frage eine ganze Reihe an Erinnerungen an diese Stunden und Tage aus, an denen er gerade nichts gefühlt hatte. Erst zögernd, dann in einem Redestrom, erzählt der Veteran von den Stunden bis zum Angriff, in denen die preußischen Kanonen unablässig die dänischen Stellungen beschossen.
»Wir waren jetzt so taub, und wir sahen aus, als hätten wir in einem Misthaufen gelegen – was ja auch der Fall war. Nachts hörten wir, wie die Preußen gruben und in der Erde wühlten, nur ein paar hundert Schritte vor unserer Brustwehr. Am Tag zuvor hatten sie unsere Schützengräben eingenommen, und wir hatten sie nicht verjagen können. Sie rückten uns direkt auf den Leib, das wussten wir. Und wir wussten auch, dass es nun bald losgehen würde. Das war auch gut so, denn wir hielten es nicht mehr aus. Wir saßen, lagen oder trödelten herum und waren so dreckig wie die Kehrichtfahrer. Niemand hätte uns für dänische Soldaten gehalten. Mir selbst war warme Gehirnmasse ins Gesicht gespritzt, als beim letzten Schuss meinem Nebenmann der Kopf weggerissen wurde … Wir feuerten nachts mit unseren letzten Granaten ein paar Schuss in die Schützengräben, dorthin, wo wir die Preußen vermuteten … Wir glaubten, nun kämen sie, und ich kann mich erinnern, wie meine Finger juckten. Aber sie kamen noch nicht. Sie deckten uns nur mit ihren Granaten ein. Bis der Tag graute, das war das Furchtbarste, was wir je erlebt hatten. Sie machen sich keinen Begriff davon, was sie auf uns herabregnen ließen. Und ich kann Ihnen das wirklich nicht erklären, weil Sie es einfach nicht verstehen können.«
Der Veteran macht eine Pause, als würde er nach Worten suchen. Dann fährt er fort: »Es war, als würde sich ein Schleifstein in meinem Kopf drehen, und er dreht sich immer noch, wenn ich daran denke.«
Drachmann und der Veteran schweigen eine Weile, der Satz bleibt in der Luft hängen.
Drachmann bricht das Schweigen. Zusammen blicken sie über die Landschaft. Die Sonne geht allmählich unter, und lange Schatten legen sich über das Land: »Und was haben Sie empfunden, als die Deutschen angriffen?«
Wieder sieht der alte Soldat Drachmann verblüfft an. »Das weiß ich nicht …«
Aber wieder ist es laut Drachmann offensichtlich, dass innere Bilder in dem Veteranen aufsteigen. Und plötzlich spricht er, als müssten diese Erlebnisse einfach heraus: »Sie kamen in langen Reihen vor uns aus dem Boden, sprangen ebenso schnell auf, duckten sich und stürmten los; die Vordersten mit gefällten Gewehren, die anderen hielten sie vor der Brust … Wir schossen ihnen mit unseren Gewehren ins Gesicht, und dann waren sie unter uns.«
Der Veteran hält in seiner Erzählung inne, holt tief Luft und fährt fort: »Wir schlugen sie nieder, aber sie standen wieder auf. Sie kämpften hart und es waren so entsetzlich viele. Ich weiß, dass ich ihnen direkt ins Gesicht gesehen habe, und doch erinnere ich mich nicht an ein einziges Gesicht wirklich. Sie knirschten mit den Zähnen und brüllten, und wir haben vermutlich dasselbe getan. Aber, und das würde ich beschwören: Wir waren nicht betrunken. Aber vielleicht verhalten sich bei so einer Gelegenheit alle wie Betrunkene. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Denn das Ganze ist wie ein Brei. Wir kämpften auf der Brustwehr und unten in der Schanze. Solange wir noch Gewehre hatten, benutzten wir sie wie richtige Soldaten. Ich behielt meins, aber ich sah andere neben mir, die mit geballter Faust zuschlugen oder sich gegenseitig in die Kehlen bissen. Ein großer hübscher preußischer Kerl sprang mit seinen Stiefeln auf die Brust eines unserer Männer und zertrampelte sein Gesicht. Ich jagte ihm mein Bajonett in den Bauch, er fiel auf mich, und ich musste mich mit einem Stiefeltritt befreien. Tritt um Tritt, aber im Grunde mag ich nicht daran denken … So war das, bis einer mir mit einem richtig dicken Knüppel einen ordentlichen Hieb auf den linken Arm verpasste … das Blut rann mir über die Finger … Um mich herum wurde geschossen, geschrien und in Hörner geblasen, aber das weckte mich auch nicht auf. Ich war in einem totalen Dämmerzustand.«

Abb. 3: Eingegrabene deutsche Batterie vor den Düppeler Schanzen.
TEIL 1DER TAG DAVOR
… er stand ganz ruhig da und redete mit mir,
und plötzlich kam eine Granate und der Kopf war weg.
Ein unheimlicher Anblick, aber mit so etwas
müssen Soldaten sich abfinden.
Korporal Rasmus Nellemann in einem Brief
an seinen Bruder, 17. April 1864

Abb. 4: Karte der Stellungen von Düppel. Auf der linken Seite preußische Laufgräben, davor dänische Schanzreihen.
1. Düppel, Sonntag, 17. April 1864
Wenige hundert Meter Niemandsland, an einigen Stellen maximal hundertfünfzig Meter. Mehr trennte die beiden Heere nicht, die sich einander gegenüber eingegraben hatten. Das dänische Heer sah sich in die Defensive gedrängt. Es verschanzte sich hinter einer Festungslinie aus großen Erdwällen, Schützenlöchern und Laufgräben, in Pulvermagazinen und Granattrichtern – wo immer man Deckung vor den gegnerischen Granaten finden konnte. Das andere Heer, des preußische, hatte sich in einem gigantischen Netz von Schützengräben – sogenannten Parallelen – systematisch an die Schanzen herangegraben. Mehr als einhundert Belagerungskanonen hatten die Preußen in das Gebiet geschafft, um den Feind zu destabilisieren und ihn dann in einem groß angelegten Sturmangriff zu besiegen.
Keine der beiden Parteien war sich am 17. April 1864 bewusst, welche Pläne das jeweils andere Heer hatte. Die Dänen erwarteten einen Angriff, nur wann würde er kommen? Die Deutschen ließen große Truppenverbände aufmarschieren. Am kommenden Tag wollten die Preußen die dänischen Stellungen überrennen, allerdings wussten sie nicht, ob der Feind die Stellungen halten und den Angriff parieren würde. Käme es zu einem plötzlichen Rückzug beziehungsweise vielleicht sogar zu einem Ausfall? Wir hingegen können in den historischen Rückspiegel blicken und wissen, dass an diesem Tag eine Entwicklung angestoßen wurde, die sich nicht mehr aufhalten ließ.

Abb. 5: Ein preußischer Leutnant des 4. Regiments, 4. Kompanie. Wilhelm Gather gehörte diesem Regiment an, das die Schanze 6 erstürmen sollte.
Am 20. April 1864 sollte in London eine internationale Friedenskonferenz stattfinden. Bis dahin wollten die kämpfenden Parteien die bestmöglichen Verhandlungspositionen erreichen. In Berlin wurde offen von der Notwendigkeit eines großen Sieges gesprochen, um in den Verhandlungen entsprechend offensiv auftreten zu können; und die Politiker in Kopenhagen forderten die Heeresleitung auf, einem feindlichen Angriff standzuhalten, egal, ob es, wie man es den Generälen gegenüber ausdrückte, zu »bedeutenden Verlusten« kommen würde.
2. Der Ausgewählte
»Und sollte es nun morgen oder früher oder später losgehen, soll ich dann untergehen?«, fragte sich der sechsundzwanzigjährige preußische Soldat Wilhelm Gather. Es war ein kalter, aber klarer und sonniger Aprilmorgen, an dem Gather mit seiner Kompanie den Gottesdienst unter freiem Himmel besuchte. Während die Soldaten mit gebeugten Köpfen das Sakrament empfingen, kreisten Gathers Gedanken weiterhin um den Tod. »Für manch einen von uns wird bald die Stunde des Abschieds von dieser Welt geschlagen haben, und wer weiß, vielleicht auch für mich?«, überlegte er.
In der Ferne dröhnte anhaltender Kanonendonner. Wilhelm Gather, der der 4. Kompanie des 4. Regiments angehörte, lag im Dorf Nybøl, nur wenige Kilometer westlich der dänischen Festungsanlagen bei Düppel. Gather und seine Kameraden waren in einem Lager bei Varnæs in der Nähe von Åbenrå stationiert gewesen, weit entfernt von der Düppeler Front. Am 16. April hatten sie plötzlich den Befehl erhalten, die zwanzig Kilometer bis Nybøl zu marschieren, dort hatte man sie nun einquartiert. Den Soldaten war bewusst, dass der Marschbefehl nach Nybøl einen unmittelbar bevorstehenden Angriff auf die dänischen Stellungen bedeutete.
Vor einer Woche hatte die Heeresleitung entschieden, Gathers Kompanie in der ersten Angriffswelle einzusetzen. Einzelne Kompanien wurden ausgewählt, als Sturmtruppen zu fungieren: Diese Truppen sollten die Dänen überwältigen und einem eventuellen Gegenangriff standhalten, bis die preußischen Reservetruppen eingesetzt wurden. Dass die ausgewählten Kompanien große Verluste erleiden würden, war allen Beteiligten klar.
Gather hatte Angst, seit er am 13. April erfahren hatte, unter den Ausgewählten zu sein. In einem Brief an seine Eltern schrieb er an diesem Tag, »ein eigentümliches Gefühl herrscht schon in uns, das Bewusstsein zu haben, die Ersten zu sein«. Und einige Tage später heißt es: »Wenn der einzige Trost, die Hoffnung, nicht wäre, dass die Sache nicht so ganz schlimm ausfallen möge, oder der Gedanke, dass von der schlimmsten Todes-Ernte auch immer noch einige übrig bleiben und unter diesen Glücklichen zu sein, dann würde uns der Mut sinken.«
Als er von seinem Befehl erfuhr, war sein erster Gedanke: »Heute und morgen stürmen wir noch nicht und hoffen und hoffen noch immer auf ein womögliches Verlassen der Schanzen [durch die Dänen] oder auf eine glückliche [internationale Friedens-]Konferenz.«
Es handelte sich um Wunschdenken, und er wusste es. Stattdessen setzte Wilhelm Gather seine ganze Hoffnung darauf, während des Angriffs als Schütze eingesetzt zu werden. Zumindest, so schrieb er seinen Eltern, könnte man als Schütze Deckung suchen und müsste nicht in engen Reihen vorrücken und auf die gefürchteten Kartätschen warten, die mit Eisensplittern und Kugeln gefüllten Granaten.
Und mit einem weiteren Gedanken versuchte er sich in seinem Brief an die Eltern zu beruhigen: Auch bei den blutigsten Verlusten standen einige der anstürmenden Soldaten doch immer wieder auf. Stets gab es Überlebende. Er könnte doch ebenso gut einer von ihnen sein.
Gather war ein gut ausgebildeter Soldat, der wie die meisten Männer in Preußen eine dreijährige Wehrpflicht absolviert hatte. Seine Dienstzeit endete eigentlich im Jahr 1862, doch als sich der Krieg mit Dänemark abzeichnete, wurde er erneut einberufen und musste 1863 die Uniform wieder anziehen. Als Krieger fühlte er sich trotz seines ganzen Waffentrainings indes nicht. Im Gegenteil. Er hasste den Krieg und hatte es vom ersten Tag an getan, zumal er die Strapazen und Gefahren im Feld nicht ertragen wollte. Am liebsten hätte er ein friedliches Leben als Landwirt geführt. Er liebte seine Heimat und den Hof seiner Eltern. Sie waren Bauern und betrieben eine Gastwirtschaft in Hohenbudberg in der preußischen Rheinprovinz, im westlichen Teil des Deutschen Bundes – weit entfernt von Berlin, direkt am Rhein. ›Vater Rhein‹ nennt ihn Gather in seinen Briefen.
Bisher hatte Wilhelm Gather Glück gehabt und konnte seinem Schöpfer dankbar sein, als er sich am 17. April mit seinen Kameraden zum Feldgottesdienst einfand. Noch hatte er an keiner Schlacht teilnehmen müssen, obwohl der Krieg bereits am 1. Februar ausgebrochen war. Das 3. Armeekorps, zu dem sein Regiment gehörte, war im Gegensatz zu anderen Einheiten, die die Preußen und ihre Verbündeten, die Österreicher, ins Feld geschickt hatten, bisher von größeren Auseinandersetzungen verschont geblieben. Aber sonderlich erfreulich waren die Monate, die der Feldzug gegen Dänemark nun dauerte, Gathers Meinung nach dennoch nicht gewesen.
Die Tage, an denen sie vor dem Danewerk – der großen dänischen Verteidigungsanlage nördlich der Eider – gelegen hatten, waren eisig kalt gewesen. Das Danewerk einzunehmen hätte zu viele Menschenleben gekostet. Doch als sie am 5. Februar den Befehl bekamen, über die Schlei zu rudern, um die dänische Stellung von der Flanke her anzugreifen, lagen Gathers Nerven blank. In den Tagen davor war entlang der langen Frontlinie unablässiger Kanonendonner zu hören gewesen, und die ersten Scharmützel zwischen Dänen und Deutschen hatten bereits stattgefunden – man sprach mit Ehrfurcht und Schrecken über die Toten und Verletzten, die es auf beiden Seiten gegeben hatte. Zu Gathers großer Erleichterung kam es zu keinem Angriff auf das Danewerk, denn unversehens räumten die Dänen die Stellung.
In den folgenden Wochen lag Gather in Jütland, zuerst südlich des Flusses Kongeå, später vor der dänischen Festung bei Fredericia, die von preußischen und österreichischen Truppen belagert wurde und im März einige Tage unter schwerem Artilleriebeschuss stand.
Wilhelm Gather erhielt seine Feuertaufe in einem kleinen Gefecht vor Kolding, in dem er miterlebte, wie ein deutscher Soldat mit einer Schussverletzung in der Brust davongetragen wurde. Doch auch diesmal kam Gather unbeschadet davon. Dies änderte sich erst, als sein Regiment Ende März südlich der Düppeler Schanzen verlegt wurde, um an der Belagerung der dänischen Stellungen teilzunehmen. Nun wurde er häufig in den preußischen Laufgräben vor den dänischen Positionen eingesetzt: Immer dichter grub sich das preußische Heer an die Dänen heran, und Wilhelm Gathers Uniform war in den feuchten Gräben ständig durchnässt, er fror. Dazu kam die miserable Verpflegung der preußischen Soldaten. In den Briefen an seine Eltern berichtete er von kleinen Portionen, die bisweilen nicht einmal Tabak enthielten, wie er verärgert hinzufügte. Der Sold sei lächerlich gering und die Dinge, die sie in den dänischen Dörfern Nordschleswigs oder bei den Marketendern kaufen konnten, die dem Heer folgten, waren laut Wilhelm Gather noch lächerlicher. Am schlimmsten allerdings wäre, so betonte er in seinen Briefen, dass es in Dänemark weder ordentliches Bier noch anständigen Branntwein gebe.
Einen Schreck fürs Leben bekam Gather Anfang April, als die Preußen sich darauf vorbereiteten, die Insel Alsen anzugreifen. Ursprünglich hatte die Heeresleitung geplant, massive Truppeneinheiten in Hunderten von Ruderbooten über das breiteste Stück des Sunds nach Alsen zu transportieren. Der Gedanke, ungeschützt in einem Ruderboot zu sitzen, während der Feind mit Kanonen schoss, jagte Gather und den übrigen deutschen Soldaten einen gehörigen Schrecken ein. Zumal jeden Moment große Kriegsschiffe auf dem Sund auftauchen konnten. Die meisten Soldaten konnten nicht schwimmen und beobachteten daher jeden Tag ängstlich die dänischen Kriegsschiffe, die auf dem Sund kreuzten. In den Briefen an seine Eltern gab Wilhelm Gather seine Angst unverhohlen zu. Groß war daher die Erleichterung – bei ihm wie bei allen anderen Infanteristen –, als er erfuhr, dass der Angriff wegen der schlechten Wetterverhältnisse abgeblasen werden musste.
Doch von der Teilnahme an einer großen Schlacht würde er nicht länger verschont werden, das war Wilhelm Gather an diesem 17. April klar. Überall um ihn herum gab es Anzeichen, die auf einen baldigen Angriff hindeuteten. Die nahe liegenden Dörfer, die Namen wie Vester Sottrup, Avnbøl, Smøl, Stenderup, Skodsbøl und Bøffelkobbel trugen, füllten sich mit Uniformierten. In allen Höfen und Ställen waren Soldaten einquartiert. Überall wurden Barackenlager errichtet, darunter ein besonders großes Lager im Wald von Bøffelkobbel nahe Nybøl; dort stellten auch die Marketender ihre Buden und Handelszelte auf. Zwischen den Bäumen und auf den Lichtungen lagerten Soldaten in kleinen Gruppen, überall gab es Pferde, Wagen, Karren, Zaumzeug, in Pyramiden zusammengestellte Gewehre, Lagerfeuer und galoppierende Ordonnanzen.
Wilhelm Gather gehörte zu den elftausend Soldaten, die man für die erste Angriffswelle ausgewählt hatte. Bei diesen Truppen handelte es sich allerdings lediglich um einen kleinen Teil des gesamten preußischen Aufmarschs. Weitere dreißigtausend Mann wurden als Reserve vorgehalten. Dazu kamen mobile Feldbatterien und Reitereinheiten, die ebenfalls bei Düppel zusammengezogen wurden.
Als ein weiteres Anzeichen für den unmittelbar bevorstehenden Angriff galten die langen Reihen von Ambulanzwagen und Karren mit Heu für die Verwundeten, die an der Chaussee standen. Außerdem wurden die Truppen mit einer doppelten Ration Fleisch verwöhnt. Die Soldaten wussten genau, warum. Mit ihrem Sinn für Galgenhumor bezeichneten sie die größeren Portionen als ›Henkersmahlzeit‹.
Und es wurden besonders viele Gottesdienste abgehalten, darunter der, an dem Gather teilnahm. Doch trotz all dieser Hinweise auf den bevorstehenden Angriff hielt der Generalstab die Information über den genauen Zeitpunkt der Schlacht noch immer zurück. Würden sie bereits in der kommenden Nacht angreifen? Am nächsten Morgen? Oder erst in zwei Tagen? Wie lang würde Gather noch leben? Er wusste es nicht.
Nach dem Gottesdienst ging er zurück in sein Quartier, einen Kuhstall in Nybøl, in dem seine Kompanie einquartiert war. Er legte sich auf den Bauch, griff zum Briefpapier, »der Tornister dient als Schreibpult«, wie er mitteilte, und schrieb: »Haben wir diese Tage überstanden, dann wollen wir zuerst Gott danken und jeder von uns wird dann bald in die Heimat zurückgekehrt sein. Schöne Gedanken, und möge der liebe Gott unsere Wünsche in Erfüllung gehen lassen.«
3. Der Schlachtplan
Ein großer schlanker Mann mit hohen Schläfen und einem gepflegten Bart, der sich um sein Kinn zog, traf um genau zwölf Uhr mittags am Hvilhøj Kro in der Nähe von Nybøl ein. Bereits anwesend waren die preußischen Generäle Canstein, Raven, Schmidt und Goeben, darüber hinaus die Kommandeure der Angriffstruppen, der Artillerie und der Pioniereinheiten. Ergeben begrüßten sie den Mann mit der ranken Figur, der aufgrund seiner Kleidung, die er auch an diesem Tag trug, kaum zu verwechseln gewesen sein dürfte: eine rote Husarenuniform mit weißen Schnüren, weißen Schulterriemen, weißem Gürtel und langen schwarzen Stiefeln mit schimmernden Sporen. Es handelte sich um den sechsunddreißig Jahre alten Prinzen Friedrich Karl von Preußen, bekannt als ›Der Rote Prinz‹. Den Beinamen hatte er bekommen, weil er stets eine rote Husarenuniform trug. Er war der Oberbefehlshaber des preußischen Heeres und hatte diese Unterredung einberufen. Er kam direkt zur Sache.

Abb. 6: Prinz Friedrich Karl von Preußen, preußischer Oberbefehlshaber bei Düppel.
»Morgen, meine Herren, erhalten Sie die Ehre«, sagte er, »die Schanzen einzunehmen, Seine Königliche Hoheit der König hat mich gebeten, Ihnen mitzuteilen, dass er im Geiste mit uns ist und für uns beten wird.«
Während des Feldzugs gegen Dänemark hatte sich der Prinz mehrfach unsicher und nervös gezeigt. An diesem Tag jedoch wirkte er gelassen und selbstsicher. Am 18. April sollte die Entscheidung fallen. Der Zeitpunkt schien richtig gewählt zu sein.
»Ich wurde«, erklärte der Prinz später, »während des Feldzugs gehärtet.«
Der Rote Prinz war bei weitem nicht das erste Mal im Feld. Nach einem zweijährigen Universitätsstudium in Bonn hatte man den blutjungen Prinzen während des preußischen Feldzugs gegen Dänemark im Deutsch-Dänischen Krieg 1848 dem Militärstab von General von Wrangel zugeteilt. Der zwanzigjährige Prinz im Rang eines Majors hatte einige Monate als Adjutant gedient und bei der Schlacht von Schleswig ein so gutes Urteilsvermögen bewiesen, dass ihm die Tapferkeitsmedaille verliehen wurde. Darüber hinaus hatte er an der Niederschlagung der Badischen Revolution durch die Preußen teilgenommen und dabei eine Verwundung erlitten. Er galt als mutiger junger Mann mit einer gehörigen Portion Todesverachtung, die ihn zum Vorbild der Soldaten werden ließ; und die Treue, die seine Männer ihm erwiesen, wurde verstärkt durch die Aufmerksamkeit und Fürsorge, die er ihnen entgegenbrachte: Friedrich Karl verkörperte das Ideal des preußischen Offiziers, der seine Soldaten als seine eigenen Kinder betrachtete. Das hieß nicht, dass es nicht zu Züchtigungen kam – Züchtigungen galten als gängige Praxis im preußischen Heer, diese Art der Bestrafung wurde als notwendiger Bestandteil des Erziehungskonzepts insgesamt angesehen. Gleichzeitig hatte sich der ideale Offizier aber in allen Belangen um seine Männer zu kümmern.
1856 wurde Friedrich Karl zum Generalleutnant ernannt und 1860 zum Kommandeur des 3. Brandenburgischen Armeekorps befördert. Während des Feldzugs gegen Dänemark stand er zunächst an der Spitze des 1. Armeekorps, im Laufe des März 1864 wurde er jedoch zum eigentlichen Kommandeur der gesammelten preußischen Kräfte vor Düppel.
Die Anteilnahme des Prinzen am Schicksal der gemeinen Soldaten ging bisweilen so weit, dass einige seiner älteren Generäle ihn für rückgratlos und wankelmütig hielten. Tatsächlich erwiesen sich beide Vorwürfe als durchaus zutreffend – und er selbst war der Erste, der es zugab. Friedrich Karl litt, wenn die Soldaten unnötig allzu großen Gefahren ausgesetzt waren. In den Nächten, in denen die dänischen Batterien den preußischen Granatenbeschuss erwiderten, konnte Prinz Karl Friedrich nicht schlafen.
Sein Mitleid mit den Soldaten lag auch daran, dass er inzwischen ein erhebliches persönliches Unbehagen verspürte, wenn er sich mitten im Kampfgeschehen befand. Am 2. Februar hatte er mit annähernd 10000 Mann die Dänen in einer vorgeschobenen Schanzenstellung bei Missunde am Danewerk angegriffen; und abgesehen von der großen Zahl Infanteristen hatte ihm dabei ein geradezu gigantisches Angebot an Feldartillerie zur Verfügung gestanden: 66 Kanonen. Seine Übermacht war gewaltig gewesen: Die Dänen hatten in dem Schanzenabschnitt, den er angriff, 20 Kanonen und lediglich ein einziges Regiment – ungefähr 2500 Soldaten. Und doch misslang dem Prinzen alles.
Es war grauenhafter Tag für Friedrich Karl; er fühlte sich krank durch den Nebel, die Kälte und den Druck, für das Wohl und Wehe so vieler Menschen verantwortlich zu sein und seine Entscheidungen allein treffen zu müssen. Er hätte bis in die Knochen gefroren, schrieb er später, und seine Laune verbesserte sich durch die erbitterte Gegenwehr, mit der die Dänen seine Truppen empfingen, durchaus nicht.
Die Kanonen dröhnten bei Missunde. Die Erde bebte, der Pulverdampf mischte sich mit dem Nebel, der immer dichter wurde. Rauchwolken und Flammen stiegen in dunklen Säulen am Horizont auf. Der Ort Missunde brannte lichterloh. Preußische Einheiten rückten näher auf die Schanzen vor – aber der dänische Widerstand wurde nicht gebrochen. Als der Prinz zum Sturm auf die Schanzen von Missunde blasen ließ, bäumten sich die dänischen Artilleristen in einer geradezu übermenschlichen Kraftanstrengung auf. Granaten und Kartätschen explodierten in der Luft, pfiffen über den Boden und schlugen auch dort ein, wo Friedrich Karl sich befand. Er war verunsichert und verwirrt und musste erkennen, dass es trotz der Übermacht, über die er verfügte, unmöglich war, die dänischen Stellungen einzunehmen. Der Prinz hatte notgedrungen den Befehl zum Rückzug zu geben, ein an Menschenleben teures Manöver. Kartätschen schlugen in die retirierenden Reihen und zahlreiche deutsche Soldaten blieben auf der gefrorenen Erde liegen.
Ein Fiasko. Der erste Angriff auf die dänischen Stellungen war fehlgeschlagen, und Friedrich Karl wusste, mit welchem Ernst diese Niederlage in den leitenden Kreisen in Berlin aufgenommen werden würde. Die Kriegsskeptiker hatten reichlich Gelegenheit, den König und seinen Minister Bismarck zu kritisieren, die sich auf einen Krieg gegen diese Skandinavier eingelassen hatten.
Elend hatte der Prinz sich auch Ende März gefühlt. Das schwere, regnerische dänische Wetter zehrte an seiner Gesundheit und an seiner Stimmung. In seinem Hauptquartier auf Schloss Gråsten schlief er schlecht, außerdem fror er den ganzen Tag. Als gäbe es keine Wärme in diesen Breitengraden, schrieb er später.
Zusammen mit Stabschef Oberst Blumenthal war er einer der führenden Betreiber eines groß angelegten Angriffsplans, der Ende März umgesetzt werden sollte: das sogenannte Ballebro-Projekt. Laut Plan wollte man die Dänen mit einem Angriff über den Alsenfjord überraschen, mit dem Ziel, das dänische Heer zu umzingeln und niederzuschlagen. Von dem kleinen Fährhafen Ballegård sollten große Truppeneinheiten nach Alsen gebracht werden, um dem dänischen Heer von dort aus in den Rücken zu fallen. Der Prinz ging davon aus, dass die Dänen sich aufgrund ihrer Überlegenheit zur See auf Alsen sicher fühlten. Sie würden sich nicht vorstellen können, dass Preußen auf eine derart riskante Idee wie ein Übersetz-Manöver kam. Die Überraschung wäre vollkommen, und mit einem raschen Kneifzangenmanöver ließen sich die dänischen Truppen auf Alsen und in Düppel aufreiben.
Der Gemeine Wilhelm Gather und seine Kompanie gehörten zu den Soldaten, die an diesem Manöver teilnehmen sollten. Sie fürchteten sich vor dem Angriff, und auch Friedrich Karl gefiel der Plan nicht wirklich. Einerseits war er begeistert von dem Gedanken an einen glorreichen Sieg – gelänge der Plan, würde er den Ruhm als großer Heerführer davontragen. Auf der anderen Seite war und blieb er wankelmütig. War es nicht doch ein zu gewagtes Projekt? Laut Plan wollte man nicht an der schmalsten Stelle über den Sund setzen – hier standen die Dänen bereit, um sich zu verteidigen –, sondern an der breitesten Stelle des Fahrwassers, am Alsenford. Dort allerdings bestand die Gefahr, dass die dänischen Kriegsschiffe eingriffen, wenn es nicht gelang, den Feind vollständig zu überrumpeln. Der groß angelegte Angriff könnte somit auch zu einer totalen Niederlage werden. Der Prinz wurde krank bei dem Gedanken, und er wurde krank, sich nicht entscheiden zu können. Mehrere seiner Generäle und Ratgeber stimmten gegen das Übersetzen, was ihn noch unschlüssiger werden ließ. Die Tage vergingen. Es kam der 1. April, es kam der 2. April. Ungefähr 160 Ruderboote lagen bei Ballegård bereit. Schwere weitreichende Festungsartillerie hatte man in den Stellungen verankert, um die dänischen Kriegsschiffe zu empfangen. Tausende deutscher Soldaten waren zusammengezogen worden, außerdem wurde ein Scheinangriff auf die Schanzen als Ablenkungsmanöver vorbereitet.
Sollte er, sollte er nicht? Es herrschte Uneinigkeit unter den preußischen Generälen, vor allem der aufbrausende und temperamentvolle Blumenthal regte sich auf. Auch er war deutlich nervös und voller Zweifel, doch andererseits ertrug er die Wankelmütigkeit seines Vorgesetzten nicht. Er wollte das Ganze überstanden wissen. Abmarsch und kurzer Prozess. Er beschimpfte den Prinzen bei den Treffen des Generalstabs. Die anderen Generäle hörten staunend zu, als der Oberst brüllte: »So tun Sie doch etwas! Angriff!«
Friedrich Karl indes unternahm nichts. Am 1. April zog ein schweres Unwetter auf. Die Wellen türmten sich meterhoch im Sund, und Friedrich Karl betrachtete es als ein Eingreifen des Herrgotts, der ihm ein Zeichen gab. Die Überfahrt nach Alsen wurde ad acta gelegt und stattdessen beschlossen, die Stellungen bei Düppel durch einen Frontalangriff zu nehmen.
Allerdings waren die Strategen der Ansicht, die Schanzen wären zu stark, um sie lediglich anzugreifen, ohne sie zuvor unter systematischen Beschuss genommen zu haben. Friedrich Karl und die preußischen Generäle spürten gleichzeitig, dass die Zeit gegen sie arbeitete. In Berlin wuchs die Ungeduld. Wo blieb der große Sieg? Es musste bald etwas Entscheidendes geschehen auf dem Kriegsschauplatz im hohen Norden.
Und genau das – etwas Entscheidendes – wollte der Prinz am 17. April zustande bringen. Er und seine Offiziere hatten einen sinnreichen Schlachtplan ausgearbeitet; eine organisatorische Kraftanstrengung, bei der nichts dem Zufall überlassen bleiben sollte.
Seinen Generälen und den anderen hochrangigen Offizieren im Hvilhøj Kro gab er ganz spezielle Befehle, wie die Schlacht um die Düppeler Schanzen am nächsten Tag geschlagen werden sollte. Die Instruktionen lauteten:
In der Nacht zum 18. April rückt die erste Hälfte der Angriffstruppen um 1.30 Uhr bis Bøffelkobbel vor und bezieht von dort aus im Schutz der Dunkelheit und so lautlos wie möglich die preußischen Schützengräben (Parallelen) vor den Schanzen. Um 2.00 Uhr folgt die nächste Angriffskolonne. In den Parallelen legen sich die Truppen auf den Boden und bleiben so still wie möglich liegen – gleichzeitig wird das auf diesem Feldzug heftigste Artilleriefeuer auf die dänischen Schanzen eröffnet. 102 Kanonen werden mit unerhörter Vehemenz und Geschwindigkeit Feuer speien – Granaten und Brandbomben. Sechs Stunden soll dieses Inferno dauern. Um 10.00 Uhr wird der Beschuss der Artillerie für einen Augenblick unterbrochen, die Kanonen werden auf die dänischen Truppen hinter den Schanzen gerichtet. In dem Moment, in dem die Kanonen schweigen – Punkt 10.00 Uhr –, geht es los.