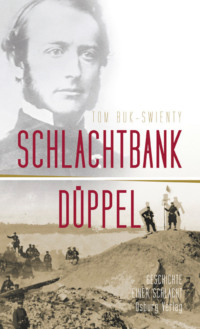Kitabı oku: «Schlachtbank Düppel: 18. April 1864.», sayfa 3
Die Generäle hörten zu. Sie waren bereit. Mehrere Tage hatten Pioniereinheiten den Sturmlauf auf Kopien der dänischen Schanzen trainiert, die man auf Broager und bei Nybøl nachgebaut hatte. Die Angriffstruppen waren aufmarschiert, alle Batterien in Stellung gebracht, die letzte Parallele gegraben.
»Noch Fragen, meine Herren?«, kam es vom Prinzen.

Abb. 7: Preußischer Artilleriepark bei Düppel.
Zunächst Schweigen. Dann durchdrang eine laute, selbstsichere Stimme den Kreis der Offiziere, die Friedrich Karl in einem Halbkreis umstanden. Adjutant von Geisler hielt die Begebenheit fest. Der Ton der Stimme, so von Geisler, war »so ruhig und geschäftsmäßig, als handle es sich um eine Frage nach der Aufnahme der Richtung. Wenn die vorderste Kolonne stutzt, Königliche Hoheit, so darf doch von hinten auf sie geschossen werden [um sie voran zu treiben]? Alles sah nach dem Sprecher hin, einem langen, hageren General mit eigentümlich spitzem Kopf, einer Brille auf der Nase und dem Habitus eines Schulmeisters. Es war Goeben. Der Prinz selbst schien einen Augenblick betroffen, doch bald erwiderte er: ›Das wird nicht vorkommen!‹ Und gleich darauf nochmals mit einer Handbewegung: ›Das wird nicht vorkommen.‹«
4. Schlachtbank Düppel
Nach der Besprechung der Offiziere im Hvilhøj Kro und ungefähr zur gleichen Zeit, als Wilhelm Gather seinen Eltern schrieb, ritt der Rote Prinz mit seinem Stab auf der breiten Sønderborg-Chaussee zur Front bei Düppel. Einen Kilometer westlich der dänischen Schanzen erreichte er den höchsten Punkt der Gegend, den Avnbjerg, von dem er eine vorzügliche Aussicht über die Landschaft hatte. »Ich kam mir vor wie jener König, der mit vergnügten Sinnen auf das beherrschte Samos blickte«, schrieb Prinz Friedrich Karl später über diesen Moment.
Er sah Buchten, Meer und Hügel. Auf der Halbinsel Broager sah der Prinz die großen Batterien bei Gammelmark, die Granaten über den Vemmingbund auf die dänischen Stellungen schossen. Diese Batterien waren die Trumpfkarte des Prinzen. Sie bestanden aus modernen, gezogenen Hinterladerkanonen, die den südlichen Teil des dänischen Verteidigungswerks, die linke Flanke, effektiv beschossen. Seit Anfang April hatten sich die Dänen auf das Duell mit den Batterien von Gammelmark eingelassen. Vor allem Schanze 2, eine der südlichen Schanzwerke, die am höchsten lag, hatte den Beschuss erwidert. Sie wurde geführt von den beiden kaltblütigen Leutnants Ancker und Castenskjold, die für ihre Männer eine Legende waren und hohen Respekt beim Feind gewannen. Aber die Düppeler Stellungen waren nicht dafür gebaut, das Feuer aus Broager zu erwidern, sondern primär, um gegen einen Feind zu kämpfen, der vor den Schanzen stand – in dem eigentlichen Schanzwerk war nur Platz für relativ wenige Kanonen, die sich auf ein Duell mit den preußischen Batterien einlassen konnten.
Dennoch waren die Kämpfe zwischen Schanze 2 und den Broager-Batterien im März und Anfang April nicht weniger heftig gewesen. Im Laufe des April jedoch wurde die Überlegenheit der Preußen immer größer, und am 17. April war die dänische Artillerie so gut wie zum Schweigen gebracht.
Die Batterien von Gammelmark waren lediglich ein Teil der zahlreichen Artilleriestellungen, über die die Preußen verfügten: Ganze 33 Batterien auf die Dänen gerichtete Geschütze hatte man vor den Schanzen eingegraben, und egal, ob Friedrich Karl seinen Blick in Richtung Westen, Osten oder Norden richtete, sah er dunkle Kanonenrohre, deren Mündungen grimmig in die Luft ragten. Er sah den Rauch von ihren Schüssen, und er hörte das dumpfe Dröhnen, das die Landschaft erzittern ließ. Und er sah die Granaten – die Dänen nannten sie ›Broager‹, ›Feldhühner‹ oder ›Störche‹ –, über das ausgedehnte preußische Laufgrabensystem fliegen. Die Laufgräben führten jetzt fast bis an die Schanzen heran – als würden sie den Hals ausstrecken, um den dänischen Stellungen den Todeskuss zu geben. Der Prinz konnte den Bahnen der Granaten folgen und ihre Einschläge in den Schanzen beobachten, die ausgebrannt und beinahe wie in den Boden geduckt vor ihm lagen.
Der viel besungene und weit geschwungene Hügelkamm, die Düppeler Höhe, hatte sich in eine graue und schartige Landschaft verwandelt. Die Höfe der Gegend waren zusammengeschossen. Das Dorf Düppel westlich der Frontlinie gleich hinter dem Avnbjerg bestand ebenfalls nur noch aus einem Haufen Ruinen, dasselbe galt für das Dorf Ragebøl im Nordwesten. Große Teile von Sønderborg im Osten existierten nicht mehr, und auch gegenüber von Sundeved gab es auf der anderen Seite des Sunds Zerstörungen (allerdings kann man vom Avnbjerg bis dorthin nicht sehen). Auf der Düppeler Seite waren die Bäume verschwunden, nur wenige verkohlte Büsche ragten noch aus der nackten Erde.
Der Ort war der Vorhof der Hölle, obwohl die dänischen Soldaten eine eher prosaische Bezeichnung für ihre Stellungen hatten: Sie nannten sie ganz einfach ›Schlachtbank Düppel‹. Ein makabrer Name. Und vielleicht noch demoralisierender war die unfassbare Trostlosigkeit des Ortes. Es sah aus, als würde sich die ganze Landschaft aus Solidarität mit den hart geprüften Truppen vor Schmerzen winden.
Einst thronte eine große, hübsche, weiße Mühle auf der Spitze des Hügels. Die Mühle wurde während eines früheren Krieges in Brand geschossen, 1849 während des Dreijährigen Krieges. Man hatte sie wieder aufgebaut, doch nun war sie erneut eingestürzt: Das Dach war zerschossen, die massiven Mauern durchlöchert, der Putz abgeplatzt und das eigentliche Mahlwerk zerstört.
Einen halben Kilometer westlich der eingestürzten Mühle lagen die dänische Festungsanlagen, die zehn Schanzen. Vor und hinter den Schanzen spann sich ein Wirrwarr aus Granatlöchern, Schützengräben und Laufgräben, von denen die einzelnen Schanzen miteinander verbunden wurden. Insgesamt zogen sich die dänischen Stellungen in einer zwei Kilometer langen Linie über die Anhöhe von Düppel, die vom Meer begrenzt wird: vom Vemmingbund im Süden und dem Alsensund im Norden.
Die dänische Stellung bei Düppel war eine sogenannte Flankenstellung. Sie lag an der östlichsten Spitze Südjütlands, wo die Landschaft wie ein Krummstab ins Wasser ragt. Der ursprüngliche Gedanke einer Flankenstellung lief darauf hinaus, hier große Teile des Heeres zu konzentrieren, um auf diese Weise einem feindlichen Heer in den Rücken fallen zu können, das in Jütland einmarschieren wollte. Weil die Dänen mit ihrer Flotte das Meer kontrollierten, konnte man jederzeit Truppen auf Alsen zusammenziehen, wenn der Druck auf die Schanzen zu groß wurde – oder wenn sie im Sturm genommen werden sollten.
Dies war jedenfalls der strategische Gedanke der Dänen, als die Schanzenreihe 1861 angelegt wurde.
Eigentlich war Düppel als eine offensive Stellung gedacht, von der aus Vorstöße unternommen werden sollten. Die Vorstöße hätten durch die befestigten Schanzen unterstützt werden können. Aber 1864 gab es keine Offensivkräfte mehr im dänischen Heer. Die Dänen verfügten über bedeutend weniger Soldaten – und selbst zu Beginn der Belagerung im Februar, als die Dänen noch in der Überzahl waren, fühlte man sich unterlegen, da man den deutschen Feind für wesentlich besser ausgebildet hielt. Auf dänischer Seite wurde eine Offensive als sinnlos erachtet.
Stattdessen richteten sich die Dänen auf eine Belagerung ein. Zwischen den Schanzen wurden Laufgräben ausgehoben, weiter zurückliegende befestigte Stellungen hinter den Schanzreihen errichtet – und bis Mitte März, als das dänische Heer noch das Terrain vor den Schanzen kontrollierte, wurden dort unzählige Beobachtungslöcher und Schützengräben angelegt.
Ausgeklügelte Hindernisse hatte man vor der Schanzlinie installiert: spanische Reiter, die vorstürmende Soldaten aufspießen konnten, Stacheldrahtzäune, die Hände, Füße und Körper der gehetzten Angreifer aufreißen sollten. Auch ein breiter Zaun angespitzter Pfähle, sogenannte Sturm-Pfähle oder Cäsar-Pfähle, wurde errichtet. Außerdem stellten die Dänen ganze Gürtel mit Eisenspitzen versehener Eggen auf. Sie sollten diejenigen töten oder verstümmeln, die im Kampfgewühl über sie stolperten.
Schließlich hob man Fallgruben aus und verteilte die berüchtigten Fußangeln – schwere sternförmige Eisenspitzen, die sich durch den Fuß bohrten, wenn man fest auf sie trat.
Friedrich Karl hatte die Schanzen zum ersten Mal Mitte Februar gesehen; er hatte den Mut verloren und seinem Onkel, König Wilhelm I., geschrieben: »Düppel war ein Stück Sewastopol. Eine von Natur starke Stellung von der Art, dass sie in der Feldschlacht nur ungern von einem weit überlegenen Feind angegriffen werden würde.«
Sewastopol. Der Name hatte einen furchteinflößenden Klang. Mit haarsträubend hohen Verlusten hatten französische und britische Truppen während des Krim-Krieges gegen Russland nach einer langen, blutigen und zehrenden Belagerung – der Typhus hatte gewütet – 1856 die stark befestigte Hafenstadt Sewastopol gestürmt. Die russischen Verteidiger waren den Angreifern zahlenmäßig weit unterlegen. Dennoch führte der Sturm auf die Stellungen zu einem Blutbad unter den Angreifern, es war ein teuer erkaufter Sieg. Ein Blutbad, das Offiziere weltweit studiert hatten, nicht zuletzt die ausgezeichnet ausgebildeten preußischen Heerführer. Ein Blutbad, dem kein General seine Truppe aussetzen wollte.
Zumal der Gedanke an eine lange und erschöpfende Belagerung bedrückend war. Monatelang hatten die Briten und Franzosen Sewastopol mit Kartätschen und Granaten überzogen, augenscheinlich ohne die Verteidiger in die Knie zu zwingen. Wieder und wieder gelang es den Russen, die Schäden an ihren Verteidigungsanlagen zu reparieren.
Der Vergleich zwischen Sewastopol und Düppel war Anfang April 1864 durchaus berechtigt. Die dänischen Verteidigungsstellungen in Düppel waren zu dieser Zeit weitaus stärker, als es die dänische Nachwelt unter dem Eindruck des verlorenen Krieges zugeben wollte – und stärker, als die dänischen Soldaten und Offiziere oft selbst glaubten.
Die Schanzen lagen hoch in der Landschaft. Von ihnen aus ließ sich ein Angriff genau überblicken. Es ist schon immer effektiver gewesen, auf Angreifer in einem offenen Gelände zu schießen, als auf jemanden, der hinter einer Brustwehr abwartet.
Sieben der zehn Schanzen waren rundum abgeschlossen, die ausgehobenen Erdbefestigungen umgaben tiefe Wallgräben und schwere Palisadenwände. Eine Zugbrücke ließ sich hinter den Schanzeneingang ziehen, der mit einem schweren Palisadentor geschlossen werden konnte. Dann befand man sich in einer Festung mit Kugelfängen für die Infanterie, Kanonenständen, sogenannten Blockhäusern (gedacht als schusssichere Aufenthaltsräume für die Soldaten; allerdings erwiesen sie sich als nicht sicher gegenüber Granaten), dunklen Pulverkammern, die aus schwerem Beton gebaut waren, und Traversen, das heißt Querwällen. Diese Querwälle sollten die Besatzung vor Granateneinschlägen schützen.
Drei Schanzen – Schanze 3, 5 und 7 – waren nach hinten offen, die sogenannten Lünetten. Auch sie verfügten über tiefe Wallgräben, Palisadenwände und Kugelfänge für die Infanterie, in erster Linie aber dienten sie als schwere Kanonenstellungen.
Dass die Landschaft im Laufe des Aprils immer düsterer und die Stellung wesentlich geschwächt wurde, war das Werk der deutschen Kanonen. Sewastopol hatte die Strategen gelehrt, dass es nicht ausreichte, die gegnerische Stellung einfach nur kräftig zu beschießen und zu zerstören zu versuchen. Man hatte systematisch vorzugehen, mit einer weit überlegenen Feuerkraft. Man musste die Verteidiger brechen, die Schanzen einreißen und gleichzeitig die über 80 Kanonen, über die die Dänen zu ihrer Verteidigung verfügten, zum Schweigen bringen. Je mehr dänische Kanonen zerstört wurden, desto besser. Mit Kartätschen geladene Kanonen waren damals die gefährlichste Waffe gegen angreifende Truppen. Eine Kartätsche entfaltete gegen die vorstürmende Infanterie eine Wirkung wie ein Maschinengewehr, nur war ihr Effekt fast noch schlimmer: Eine gut platzierte Kartätsche konnte mit einem wüsten Knall eine ganze Abteilung Soldaten in Stücke reißen.
Bis zum 2. April hatten die Preußen Batterien vor den dänischen Stellungen und an den Flanken eingerichtet. Der Granatregen, der sich über Düppel ergoss, hatte eine Intensität, die im Grunde unfassbar ist. Es übertraf bei weitem alles, was man bei Sewastopol gesehen hatte, meinten ausländische Beobachter. Doch nicht nur die Intensität war unerhört. Auch die Ausdauer war es. Es hatte etwas mechanisch Destruktives. Ein absurdes Beispiel der Industrialisierung: Kanonen, die mit einer Präzision auf eine Landschaft einschlugen, als wären es gigantische Dampfhämmer. Im April fand der Beschuss Tag und Nacht statt, rund um die Uhr. Manchmal ließ der Granatregen ein wenig nach, doch nicht allzu lange. Sobald die Kanonen abgekühlt waren, ging es wieder los.
Lange hielten die Dänen aus, und mit einer gewaltigen Kraftanstrengung gelang es ihnen, die Schanzen Nacht für Nacht auszubessern und wieder aufzubauen. Aber im Laufe des April wurde es schwerer und gefährlicher – und es kam der Tag, an dem die Festungsanlage an der linken Flanke einstürzte; die Schäden konnten nicht mehr beziehungsweise nur noch teilweise ausgebessert werden.
Die Anhöhe von Düppel war am 17. April 1864 Niemandsland. Eine Bezeichnung, in der natürlich ein gewisser ironischer Unterton mitschwingt, denn wenn Düppel etwas nicht war, dann entvölkert. Es wimmelte von Menschen, auf der preußischen Seite wie hinter den dänischen Festungslinien.
In Düppel und auf Alsen waren ungefähr 27000 Soldaten stationiert und Tausende, die man als Nonkombattanten bezeichnete: Kutscher, Stallmeister, Depotleiter, Arbeiter, Spielmänner, Küchenpersonal, Zimmerer, Werkzeugmacher, Schmiede, Ingenieure, Feldgeistliche, Krankenschwestern, Sanitäter und Ärzte. Und es gab Tiere. Vor allem Pferde. 10000 Pferde.
Man lebte – und starb – nah beieinander in den Düppeler Schanzen. Die sanitären Verhältnisse waren schlecht. Die Truppen wurden geplagt von ansteckenden Krankheiten, auf der dänischen Seite insbesondere vom Typhus; die elenden sanitären Verhältnisse im vordersten Frontabschnitt waren unvorstellbar. In der ersten dänischen Frontlinie lagen konstant zirka 5000 Mann. Es gab Latrinen direkt hinter den Schanzen. Aber sie wurden allmählich durch den Beschuss zerstört – und wenn Granaten dicht an dicht fallen, geht ein Soldat, wenn ihn ein Bedürfnis überkommt, auch nicht mehr auf die Latrinen, die noch intakt sind. Der Soldat bei Düppel hatte Angst, sich auf offenem Terrain zu bewegen, also verrichtete er seine Notdurft ungefähr dort, wo er stand.

Abb. 8: Laufgrabensysteme zwischen Schanze 3 und Schanze 4. Zu erkennen sind die Löcher, in denen die dänischen Soldaten während des Beschusses Schutz suchten.
Exkremente der Soldaten, Pferdemist, Küchenabfälle, abgeschossene Körperglieder und die Eingeweide von Menschen und Tieren, die jeden Tag zerfetzt wurden, vermischten sich zu einem widerwärtigen Morast. Die Schanzen wurden, wie Holger Drachmanns Soldat es formulierte, zu einem großen Misthaufen.
Auch in den äußersten preußischen Laufgräben nahe den dänischen Stellungen war es nicht viel besser. Hier standen die Soldaten ebenfalls im Dreck. Ständig mussten sie kriechen oder sich bücken. Sobald sie den Kopf über den Rand des Grabens hielten, wurde aus den dänischen Stellungen geschossen. Sie lagen auf die Erde gepresst – bis zu vierundzwanzig Stunden hintereinander. In den Parallelen waren die deutschen Soldaten so gut wie immobil, hier herrschten nach und nach ebenso widerliche sanitäre Verhältnisse wie in den Schanzen und den dänischen Laufgräben.
Zumindest würde es nicht mehr lange dauern, bis die Preußen aus den Parallelen herauskamen, die der Rote Prinz mit Zufriedenheit von seinem Aussichtsposten auf dem Avnbjerg überblickte. Vermutlich lief es ihm jedoch bei einem Aspekt der dänischen Verteidigung kalt über den Rücken. Die Dänen hatten einen unbekannten Faktor auf ihrer Seite, den man auch an diesem Tag vom Avnbjerg klar erkennen konnte. Ein Ungeheuer aus preußischer Sicht. Ein schwarzes, feuerspeiendes Ungeheuer, von dem die Deutschen fürchteten, dass es bei einem Sturmangriff zum Leben erweckt würde. Ein Ungeheuer, das dort draußen am Horizont jederzeit auf der Lauer zu liegen schien: »Rolf Krake«.
5. Das Panzerschiff
Im Grunde genommen war es ungeschickt, ein Kriegsschiff nach dem Sagenkönig Rolf Krake zu benennen. Sicher war Rolf Krake laut Saxo Grammaticus ein Kriegerkönig, der bekannt dafür war, viele Kriege gewonnen zu haben. Und doch ging es nicht gut für ihn aus. Er hatte mit Skuld eine intrigante Stiefschwester in Schonen, die mit ihrem Mann Hjarvad Krake vom Thron stoßen wollte. Die beiden schmiedeten einen boshaften Plan.
Skuld und Hjarvad trafen zu einem Fest bei Rolf Krake mit einem Schiff ein, das angeblich voller Geschenke war. Doch bevor die Geschenke präsentiert wurden, fand im Königsschloss von Lejre das Fest statt. Es wurde viel getrunken, und Krake und seine Männer sanken berauscht zu Boden. Auf dem Schiff von Skuld und Hjarvad befanden sich indes keine Geschenke, sondern Krieger, die nun das Schloss stürmten. Rolf Krake und seine Männer erwachten und kämpften heroisch gegen die Übermacht. Doch der Kampf war aussichtslos: Krake und alle seine Krieger wurden getötet.

Abb. 9: Das Panzerschiff »Rolf Krake«. Es existieren keine Fotografien des Schiffes, nur Holzschnitte, die in der Tagespresse als Illustrationen verwendet wurden.
Die Geschichte von Rolf Krake lässt sich als eine Parabel auf den dänischen Kampf gegen die Übermacht 1864 lesen. Aber man hatte kaum König Krakes Ende im Kopf, als die dänische Marine 1863 ihr neues Panzerschiff, das bei Napier & Sons in Glasgow gebaut worden war, auf den Namen des Sagenkönigs taufte. Es wurde auch kein Gedanke daran verschwendet, dass mit ›krake‹ im Dänischen ein hoch aufgeschossener und etwas schwächlicher Baum bezeichnet wird. Der Sagenkönig war als kluger und mutiger Mann bekannt, nicht aber als Muskelprotz. Als das Kriegsschiff auf seinen Namen getauft wurde, dachte man offensichtlich nur an den ersten Teil der Geschichte, an den unbesiegbaren Rolf Krake.
Und dazu hatte man auch allen Grund: Das Panzerschiff war ein König der Meere und ein Stück dänischer Kriegstechnologie auf der Höhe der technischen Entwicklung. Ja, das Schiff hatte etwas von einem Seeungeheuer.
Innerhalb der Seefahrt hatte sich viel ereignet, seit die dänische Flotte 1824 ihr erstes dampfbetriebenes Kriegsschiff hatte bauen lassen. Konservative Kräfte hatten Dampfschiffen damals ausgesprochen skeptisch gegenübergestanden. Was war denn an Segeln falsch? Doch schon bald erwiesen sich Dampfschiffe als weit überlegen. Sie waren schneller, unabhängig von Wind und Wetter, und sie waren besser zu manövrieren. Das musste auch der verstockteste Seeoffizier zugeben.
Das letzte dänische Kriegsschiff, das ausschließlich besegelt werden konnte, war die Fregatte »Dannebrog«, die 1850 fertiggestellt wurde: ein annähernd 5000 Tonnen schweres, 65 Meter langes Holzschiff mit 70 Kanonen. Nur acht Jahre später kam es ins Dock und wurde vollständig umgebaut. Es wurde mit Eisenplatten ausgekleidet und bekam eine Dampfmaschine. Und zu diesem Zeitpunkt war ein Dampfschiff nicht mehr nur ein Dampfschiff. 1836 erfand der schwedisch-amerikanische Kapitän John Ericsson die Schiffsschraube. Damit war der Weg geebnet von den Raddampfern zu den weit schnelleren, durch eine Schraube angetriebenen Dampfschiffen. Allerdings waren bis ins letzte Drittel des 19. Jahrhunderts die meisten Schiffe Holzsegelschiffe mit Masten, auf denen sich Dampf- und Windkraft kombinieren ließen.
1864 umfasste die dänische Flotte fünfzehn große Kriegsschiffe, von denen die größten das schraubengetriebene Linienschiff »Skjold« und die Schraubenfregatten »Jylland«, »Sjælland« und »Niels Juel« waren. Es war keine überwältigende Flotte. Dänemark war nicht mehr die maritime Macht, die das Land bis 1807 gewesen war, als die Dänen gezwungen wurden, ihre Flotte an Großbritannien abzutreten. Damals verlor Dänemark dreißig schlagkräftige Linienschiffe. Aber im Verhältnis zu den deutschen Nachbarn war die dänische Flotte ausreichend, weil die durch Schrauben angetriebenen Dampfkriegsschiffe die modernsten ihrer Art waren. Preußen, das mit großem Eifer versuchte, eine Flotte aufzubauen, verfügte über lediglich vier kleinere Schraubenkorvetten und eine überschaubare Flotte kleiner Kanonenboote zur Küstenverteidigung. Österreichs Flotte war der dänischen zwar überlegen, lag aber an der Adria, und niemand erwartete sie in der Ost- oder Nordsee.
Weil Dänemark nach dem Verlust von 1807 eine neue Flotte von Grund auf aufbauen musste, war man in Marinekreisen neuen Ideen relativ aufgeschlossen, und genau hier kommt die »Rolf Krake« ins Bild. Auf der ganzen Welt wurde damit experimentiert, Kriegsschiffe mit Eisenplatten zu verkleiden. Diese Entwicklung war notwendig geworden, weil Holzschiffe allzu leicht von den modernen gezogenen Geschützen zerstört werden konnten.
Während des amerikanischen Bürgerkriegs (1861–1865) wurden nicht nur mit Eisenplatten verkleidete Holzschiffe eingesetzt, sondern auch Schiffe, deren gesamter Rumpf aus Eisen bestand und die über Kanonen in rotierenden, runden Kanonentürmen verfügten. Bereits während des Krim-Krieges wurden schwimmende Geschützbatterien aus Eisen verwendet, aber aus Eisen hergestellte Schiffe – das war etwas vollkommen Neues. Allein deren Erscheinung verbreitete Angst und Schrecken. Die Panzerschiffe waren schwarz, und aufgrund ihrer großen Dampfmaschinen hingen immer schwere, drohende Rauchwolken über ihnen. Tatsächlich umgab sie eine Aura der Unbesiegbarkeit.
Der erste Kampf zwischen zwei Panzerschiffen, der USS »Monitor« der Nordstaaten und der CSS »Virginia« der Südstaaten-Armee, 1862 auf den Hampton Roads in Virginia, dauerte mehrere Stunden. Die beiden Schiffe beschossen sich gegenseitig mit Granaten, aber keines der Schiffe nahm sonderlich Schaden durch die vielen Volltreffer.
Die dänische Marine verfolgte die Entwicklung sehr genau, und als sich ein Krieg um ›die schleswigsche Frage‹ am Horizont abzeichnete, gab man ein nach allen Regeln der Kunst gebautes Panzerschiff in Auftrag: ein stolzes, 56 Meter langes Schiff, 12 Meter breit, mit einer Tonnage von 1235, 750 Pferdestärken und zwei Kanonentürmen mit vier schweren 64-Pfund-Kanonen. Der schwarze, gepanzerte Rumpf war 12 Zentimeter dick.
Die »Rolf Krake« wurde von den Preußen mit Respekt behandelt, sie legten im Vemmingbund Fischernetze aus, um zu verhindern, dass das Schiff allzu nah an Land kam. Aber die Preußen konnten das Kriegsschiff kaum daran hindern, bei einem Sturmangriff auf die dänischen Stellungen einzugreifen. Doch wie gefährlich war das Schiff überhaupt? Die preußische Heeresleitung tat sich schwer in der Einschätzung. Das Schiff war eindeutig ein unvorhersehbares Element, das den Deutschen Probleme bereitete. So gesehen war die »Rolf Krake« vor allem eine psychologische Waffe – und eine Waffe, die die Dänen in einem Krieg brauchten, bei dem es aus militärischer Sicht nicht allzu viel zu prahlen gab. In beinahe allen Punkten war Dänemark seinem Gegner unterlegen.
Im April hatte Dänemark 52000 Mann unter Waffen, und damit waren bereits alle kampffähigen Männer des Landes mobilisiert. Bei den Truppen, die von den Preußen und Österreichern geschickt wurden, handelte es sich hingegen nur um das Expeditionskorps. Erst waren es 56000 Mann, im Laufe des Krieges wurden es 100000. Voll mobilisiert konnten Preußen und Österreich jeweils eine halbe Million Männer ins Feld schicken.
Im Gegensatz zu Dänemark verfügten Preußen und Österreich außerdem über gut ausgebildete Soldaten. Der dänische Rekrut erhielt ein Jahr Ausbildung, der preußische drei Jahre. In Dänemark wie in Preußen gab es die allgemeine Wehrpflicht, doch Dänen aus den besseren Kreisen konnten sich vom Militärdienst befreien, indem sie einen sogenannten Ersatzmann bezahlten, der für sie die Uniform anzog. Das führte dazu, dass der größte Teil der Gemeinen des dänischen Heeres aus Landarbeitern, Arbeitern, Tagelöhnern und anderen ärmeren Schichten bestand.
Die Deutschen hingegen waren in der komfortablen Lage, sich auch die Offiziere für den Feldzug aussuchen zu können. Ein gut funktionierendes Heer brauchte viele gute Offiziere. In Dänemark gab es tüchtige Vorgesetzte, aber viel zu wenige. In aller Hast musste man auf schlecht ausgebildete Reserveoffiziere zurückgreifen, und von ihnen gab es obendrein nicht einmal eine ausreichende Anzahl.
Das dänische Heer war andererseits nicht so schlecht ausgerüstet, wie es in der Literatur über den Krieg von 1864 häufig dargestellt wird. Die Truppen waren ausgestattet wie durchschnittliche Einheiten in ganz Europa. Es gab einen Mangel an Uniformjacken, aber nicht an Gewehren oder Artillerie. Die schweren dunkelblauen Uniformen, die Mützen und Stiefel, mit denen die dänischen Soldaten ausgerüstet wurden, waren von so guter Qualität, dass viele Preußen sie darum beneideten. Die dänischen Waffen konnten sich in technischer Hinsicht mit den Waffen messen, die vom größten Teil der europäischen Heere eingesetzt wurden. Wie die Dänen benutzten die meisten anderen Truppen Vorderladergewehre mit gezogenen Läufen, die bis zu einer Entfernung von vierhundert Metern präzise treffen konnten.

Abb. 10: Dänische Soldaten ruhen sich aus, die Gewehre zu Pyramiden zusammengestellt.
Diese Präzision war der Grund, warum die meisten Armeen der Welt, inklusive der Massenheere im amerikanischen Bürgerkrieg, am Vorderlader festhielten und nicht sofort auf die neueste Generation von Gewehren umstellten: Hinterlader oder Zündnadelgewehre.
Unglücklicherweise verfügte Preußen (nicht aber Österreich) über die vorausschauendsten Heerführer, die erkannten, dass man sich waffentechnologisch und strategisch gesehen auf dem Weg in eine neue Ära befand. In den Napoleonischen Kriegen stießen Heere noch in massiven Reihen aufeinander: Sie marschierten aufeinander zu und feuerten dabei Salven ab, bis die Schlacht schließlich in einem Bajonettkampf endete. Aber preußische Militärstrategen wie General Helmuth von Moltke (siehe auch Seite 163) standen für eine weit mobilere Kriegsführung. Statt die Soldaten in Reih und Glied vorrücken zu lassen, griffen sie in beweglichen Truppenschwärmen an. Ein Zug bot weniger körperliche Angriffsfläche, daher wurden auch weniger Soldaten getroffen, wenn man auf einen schießenden Feind zustürmte. Die Überlegungen liefen darauf hinaus, einem Angriff die notwendige Wucht zu verleihen, indem man die Soldaten mit schnell schießenden Hinterladern ausrüstete – Zündnadelgewehren –, die im Gegensatz zu den Vorderladern im Laufen oder in liegender Position nachgeladen werden konnten. Auf diese Weise ließ sich im Gegensatz zu den Vorderladern eine hohe Feuerkraft aufrechterhalten, auch wenn sich die Soldaten auf den Feind zubewegten. Laut den Dienstbüchern des preußischen Heeres konnte ein Zündnadelgewehr vier bis fünf Schüsse in der Minute abfeuern. Ein geübter Schütze schoss infolge der dänischen Dienstordnung mit dem Vorderlader ungefähr zwei Schuss pro Minute (aber das erforderte, dass man aufstand – und still stehen blieb). Mit anderen Worten, mit einem Zündnadelgewehr ließ sich doppelt so schnell schießen.
Der Vorderlader war auf größere Entfernungen etwas treffsicherer als die erste Generation der Hinterladergewehre, aber es zeigte sich sehr rasch, dass die größere Geschwindigkeit der Hinterlader diesen Nachteil aufwog. In dänischen Tagebüchern und zeitgenössischen Briefen ist immer wieder zu lesen, wie sich Soldaten und Offiziere darüber beklagen, dass man während eines Angriffs Schwierigkeiten hatte, mit der ›Feuergeschwindigkeit‹ des Gegners mitzuhalten.
Unterlegen war auch die dänische Artillerie. Es fehlte nicht an Kanonen. Lange verfügte die dänische Armee bei Düppel über ebenso viele Kanonen wir die Preußen. Außerdem gehörten die Artilleristen zu den am besten ausgebildeten Soldaten des dänischen Heeres. Sie konnten sich mit Artilleristen anderer Armeen durchaus messen. Und hätte es sich bei dem Gegner nicht ausgerechnet um Preußen gehandelt, wäre ein Artillerieduell bei Düppel vermutlich erfolgreicher verlaufen. Doch unglücklicherweise besaßen die Preußen weit mehr Kanonen mit gezogenen Läufen als die Dänen, und gezogene Kanonen schossen weiter. Die Preußen konnten ihre Batterien also weit entfernt in Stellung bringen und die Dänen erreichen, ohne dass diese den Beschuss effektiv beantworten konnten.
Den halben Sieg errangen die Preußen somit allein durch ihren technologischen und militärstrategischen Vorsprung.
Aber es gab ja noch das Kriegsschiff »Rolf Krake«, das dort draußen am Horizont lauerte. Auch mit ausländischen Augen gesehen eine der großen Attraktionen dieses Krieges. Die zahlreichen ausländischen Kriegskorrespondenten, die sich auf Alsen und bei Düppel befanden – einige kamen sogar aus Japan –, brauchten viel Spaltenplatz, um über die »Rolf Krake«, das erste moderne Panzerschiff Europas, zu berichten.
Seeungeheuer lieferten schon immer eine gute Story.