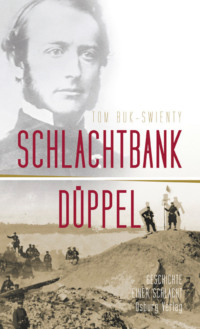Kitabı oku: «Schlachtbank Düppel: 18. April 1864.», sayfa 5
4. April: Heute Nacht um 3 Uhr versuchten die Preußen, die Schanzen zu stürmen. Lebhaftes Kanonen- und Gewehrfeuer. Der Himmel rot vom Feuer … Ein cand. jur. Larsen aus Kopenhagen … wurde in einem Zustand ins Lazarett gebracht, der es mir verbot, ihn weiter ins Lazarett von Augustenborg zu schicken, nachdem ich ihn verbunden hatte. Aus Furcht, er würde während des Transports sterben. (Nachdem er drei Tage mit Fieberfantasien gelegen hatte, starb er.)
5. April: Die Granaten bewirken fürchterliche Läsionen. Zerschmetterte und zerfetzte Glieder. Herausgerissene Eingeweide, weit umherspritzende Gehirnmasse der Unglücklichen, die am Kopf getroffen werden. Sønderborg ist an vielen Stellen abgebrannt, ein nicht geringer Teil des Ortes liegt bereits in Schutt und Asche. Die Brandgranaten fliegen wie Drachen aus Broager über diese unglückliche Stadt. Bei Sundeved stehen Höfe in Flammen, schwarzer Rauch wälzt sich über das Land.
8. April: Ungefähr 60 Verwundete jeden Tag. Heftige Schießereien. Stellung kritisch.
10. April: Gestern kamen 5 Verwundete ins Lazarett. 2 Amputationen, Arm und Schenkel. Heute ein fürchterliches Bombardement, 24 Verletzte im Lazarett.
11. April: Heftiges, ununterbrochenes Bombardement. 60–70 Verletzte wurden nach Sønderborg gebracht. Man rechnet mit 10 Amputationen.
12.–13. April: In der Nacht zwischen den beiden Tagen unablässige Kanonade. Die Schüsse lassen sich nicht zählen, sie klingen wie die Salven eines Bataillons. 98 Verletzte wurden nach Sundeved gebracht.

Abb. 16 und 17: Abbildungen aus dem Handbuch der Kriegschirurgischen Technik (1877) des deutschen Chirurgen Friedrich von Esmarch. Die Studien dafür nahm Esmarch u.a. in Düppel vor.
14.–15. April: Ich amputierte bis 1.30 nachts. Viele Verletzte.
17. April: In der Nacht besonders grässliche Kanonade.«
Einen Bericht, den Reymert nach seiner Rückkehr aus dem Krieg für norwegische Militärstellen schrieb, verfasste er in einem mehr beschreibenden Ton. Er berichtete, wie die am schwersten Verwundeten eigentlich aussahen. So hatte es einen Soldaten gegeben, dessen gesamtes Gesicht weggeschossen war. »Beide Kiefer waren zerschmettert, alle weichen Teile und die Zunge waren verschwunden, bei jedem Atemzug kam Blut, das gleichsam in seinem Schlund zu kochen schien. Die Weichteile des Gesichts hingen zerfetzt an der elastischen Haut über seiner Brust …«
Henri Dunant wollte eine internationale humanitäre Organisation gründen, um gerade die Schmerzen solcher armen Menschen zu lindern. Um zu verstehen, was van de Velde in Düppel tat, muss man die Geschichte Dunants und seiner Initiative verstehen, die zur Gründung des Roten Kreuzes führte.
Man schrieb das Jahr 1859. Der junge Schweizer Geschäftsmann Henri Dunant hatte ökonomische Schwierigkeiten, weil seine Investitionen in Ländereien in Algerien aufgrund der Trockenheit keinen Ertrag brachten. Er musste den französischen Kaiser Napoleon III. sprechen, vielleicht konnte der Kaiser ihm helfen, ein groß angelegtes Bewässerungsprojekt zu finanzieren. Dunant wollte Napoleon überzeugen, dass Nordafrika zu einer Speisekammer für Frankreich werden könnte.
Doch den Kaiser zu sprechen war nicht so einfach. Frankreich befand sich im Krieg mit Österreich. Man hatte sich mit italienischen Separatisten aus Sardinien verbündet, die ein geeintes Italien und damit eine Loslösung von der österreichischen Herrschaft wollten.
Dunant, ein Zivilist in weißem Anzug, reiste den Heeren nach, und so kam es, dass er am 24. Juni 1859 Zeuge wurde, wie 200000 Soldaten bei Solferino aufeinandertrafen. Dunant besaß großes Talent zum Schreiben, und das Buch, das er über seine Erlebnisse auf dem Schlachtfeld verfasste – Eine Erinnerung an Solferino – sollte Weltgeschichte schreiben.
Die Hitze bei Solferino war unerträglich. Die Soldaten erstickten beinahe in ihren Uniformen. Es herrschte ein furchtbarer Wassermangel, und das Einzige, was die Soldaten an diesem Junitag zu trinken bekommen hatten, war Branntwein. Gleichzeitig waren sie ausgehungert von den tagelangen Märschen. Die Schlacht war nicht geplant und entwickelte möglicherweise deshalb eine derartige Grausamkeit: Man wurde von einem furchterregenden Feind überrascht und schlug blindwütig um sich. Beide Parteien wollten das hügelige Gelände um Solferino besetzen, doch aufgrund mangelhafter Aufklärung hatten die Armeen sich erst entdeckt, als es zu spät war. Fünfzehn wahnsinnige Stunden dauerte die Schlacht, die schließlich mit einem französisch-italienischen Sieg endete.

Mitten im Kampfgeschehen befand sich dieser weiß gekleidete Mann; ein Mann, der ähnlich wie van de Velde leicht zu erschüttern war. In seinen Erinnerungen schrieb Dunant:
»Fest geschlossene Kolonnen werfen sich mit unwiderstehlicher Heftigkeit übereinander wie ein zerstörender Mahlstrom, der auf seinem Weg alles umreißt; französische Regimenter rennen in verteilter Schusslinie gegen die österreichischen Massen an, die unablässig erneuert werden, sie werden immer zahlreicher und immer bedrohlicher und halten den Angriff energisch aus, als wären es Mauern aus Eisen; ganze Divisionen werfen ihr Gepäck ab, um mit größerer Leichtigkeit und gefälltem Bajonett dem Feind entgegenstürmen zu können; ein Bataillon wird zurückgetrieben, aber ein anderes folgt ihnen unmittelbar auf den Fersen. Jede einzige Erderhebung, jeder einzelne Hügel, jeder einzelne Felskamm ist Schauplatz eines hartnäckigen Kampfes.«
Nach der Schlacht hinterließ das Schlachtfeld einen besonderen Eindruck auf Henri Dunant. Drei Tage wanderte der erschütterte Schweizer zwischen Toten, Sterbenden und Verletzten umher.
»Als die Sonne am 25. aufgeht, beleuchtet sie eines der abscheulichsten Schauspiele, das die menschliche Fantasie hervorzubringen vermag. Überall ist das Schlachtfeld mit den Leichen von Menschen und Pferden übersät … Die armen Verletzten, die man den ganzen Tag über aufsammelt, sind bleich, fahl und vollkommen entkräftet, einige, nämlich die, die stark verstümmelt wurden, haben trübe Augen und scheinen nicht zu verstehen, was man zu ihnen sagt.«
Es herrschte Wassermangel und es wurden verzweifelt Ärzte und Krankenpfleger benötigt. Der Sanitätsdienst wurde teilweise in der Schlacht aufgerieben, die Leiden schienen kein Ende nehmen zu wollen. Dunant versuchte, nach bestem Wissen zu helfen. Er kniete neben den Schwerverwundeten, die ihn anflehten, bis zu ihrem letzten Atemzug an ihrer Seite zu bleiben, damit sie nicht allein sterben mussten.
Dunant versuchte auch, Helfer unter der örtlichen Bevölkerung zu organisieren, und er überzeugte die Franzosen sogar, österreichische Ärzte aus der Kriegsgefangenschaft zu entlassen, damit auch sie helfen konnten. Doch trotz aller Anstrengungen war die Hilfe unzureichend. Allerdings erlebte Dunant auch einen Lichtblick in dieser entsetzlichen Situation: Viele Menschen aus der Bevölkerung, insbesondere Frauen, zögerten nicht, die Verwundeten zu pflegen, und die Italiener taten es ohne Rücksicht auf die Nationalität der Verwundeten. Die spontane Hilfe wurde unter der Devise ›tutti fratelli‹ geleistet – wir alle sind Brüder.
Das Erlebnis von Solferino ließ Dunant nicht los, und 1862 schrieb er Eine Erinnerung an Solferino. Er finanzierte das Erscheinen des Textes selbst und schickte das Buch seinen Freunden. Dann begann er in Europa herumzureisen, um Regierungsführern und Fürsten sein Werk zu überreichen und darüber zu sprechen, was er gesehen hatte.
Er wollte eine neutrale internationale Institution aus Ärzten und Krankenschwestern schaffen, die überall auf den Kriegsschauplätzen zum Einsatz kommen sollten. Diese Ärzte und Helfer sollten in den Kampfzonen frei agieren und arbeiten können.
Eine Erinnerung aus Solferino erschütterte die Leser, und Dunant bekam Unterstützung. Er war nicht der Erste, der sich dafür einsetzte, dass in Kriegszonen eine weitaus bessere Krankenpflege notwendig war. Zur berühmtesten Verfechterin dieser Forderung wurde Florence Nightingale, eine Britin, die aus einer reichen Familie stammte und ihr Leben der Krankenpflege widmete. Sie war ebenso schockiert wie Dunant bei Solferino, als sie die Zustände für die Verwundeten während des Krimkrieges sah.
Dunant ließ sich von Nightingale und der humanistisch-progressiven Autorin Harriet Beecher-Stowe inspirieren, doch das eigentlich Revolutionäre an seinem Plan war die Idee einer internationalen Institution.
Zusammen mit vier einflussreichen Genfer Bürgern gründete Dunant am 17. Februar 1863 das Internationale Komitees der Hilfsgesellschaften für die Verwundetenpflege, noch im gleichen Jahr kamen Delegierte aus vierzehn Ländern, darunter Preußen – nicht aber Dänemark – nach Genf, um die Möglichkeiten zur Gründung einer internationalen Organisation zu diskutieren. Es wurde beschlossen, dass die Entsandten der Organisation in Kriegszonen ein weißes Armband mit einem roten Kreuz (eine Umkehrung der Schweizer Flagge) als Symbol der Neutralität tragen sollten.
Damit war das Rote Kreuz ins Leben gerufen. Nun ging es darum, die gesamte internationale Gemeinschaft zu überzeugen, man musste die Information über die Organisation verbreiten. Gleichzeitig galt es, die gegenwärtigen Schlachtfelder und die Verhältnisse für die Verwundeten zu studieren.
Van de Velde reiste nach Dänemark, um das Land für die Idee einer internationalen Hilfsorganisation zu gewinnen und sich das Kampfgebiet anzusehen. Außerdem wollte er sich persönlich um Verwundete kümmern, wenn die Möglichkeit sich ergab.
Wenn van de Velde angesichts seiner Erlebnisse in Dänemark häufig deprimiert war, so lag das nicht allein an den Grausamkeiten auf dem Schlachtfeld, sondern auch daran, dass die Dänen ihm sehr lange die kalte Schulter zeigten. Sie betrachten diesen Mann, der vier Sprachen sprach –, Französisch, Deutsch, Englisch und Holländisch, aber nicht Dänisch – mit Misstrauen. »Wozu braucht es eine internationale Organisation?« Die Dänen als Menschenschlag, konstatierte van de Velde in seinen Briefen, seien »verschlossen«, »insulär« und »selbstzufrieden«. Kurz gesagt, sie waren, wie er mehrfach betonte, »veritable Inselbewohner«. In einem Brief an Dunant vom 11. April schrieb van de Velde, »die Dänen halten an ihren eigenen Ideen fest und fürchten sich vor allen Vorschlägen, die von außen kommen. Sie haben eine deutliche Angst vor dem Fremden … Bei diesem Widerstand gegen neue Gedanken ist meine Aufgabe nicht leicht.«
Zumal die Dänen laut van de Velde in einem gottverlassenen Teil der Welt wohnten. Er war am 2. April von Paris mit dem Zug über Köln und Hamburg nach Lübeck gereist und von dort mit dem Dampfschiff nach Malmö gefahren. Kopenhagen erreichte er am 9. April. Die Reise »erschöpfte mich durch große Kälte und zehrte an meinen Kräften«.
Um zu illustrieren, wie schlimm die Kälte im Norden war, schrieb er, im Abteil der Waggons, in dem er von Köln nach Lübeck gesessen hatte, wären »die Fenster von einer dicken Eisschicht bedeckt gewesen, trotz der Wärme, die von sechs Deutschen im Abteil ausging«.
An Bord des Dampfschiffs nach Malmö war es noch kälter. »Die Überfahrt über das Baltische Meer dauerte achtzehn Stunden, gleichzeitig blies ein heftiger Nordwind, der das gesamte Tauwerk vereiste … Das Klima in diesen Breitengraden ist fürchterlich. Erst heute hat der Wind nachgelassen, aber er wurde ersetzt durch einen feuchten Nebel, so wie er in Genf im Februar vorkommen kann.«
Die Stimmung in Kopenhagen war düster. Die letzten Bulletins zeigten, dass es im dänischen Heer 5136 verletzte und kranke Soldaten gab, die in 26 Krankenhäusern im ganzen Land lagen. Gut die Hälfte der Verwundeten allerdings in Kopenhagen, »wo es kein Gebäude mehr gibt, das noch sehr viel mehr aufnehmen könnte«.
Van de Velde erlebte eine vom Krieg gezeichnete Hauptstadt:
»Brüder, Väter, Freunde … versammeln sich an den Straßenecken, um über die Beschießung von Düppel zu lesen, ständig werden Neuigkeiten angeschlagen. Ich fühle mit ihnen und sympathisiere mit all diesen trauernden Menschen, die ich überall treffe, und ich höre ihren Erzählungen über ihre Liebsten aufmerksam zu, die Tag und Nacht dem Kugelhagel ausgesetzt sind. Die Menschen, denen ich begegne, versuchen, ihre Liebe zum Vaterland mit ihrer Liebe zu ihren nächsten Angehörigen draußen an der Front in Einklang zu bringen, um deren Leben sie fürchten.«
In Kopenhagen traf van de Velde mit internationalen Zeitungskorrespondenten zusammen, die aus Düppel geflohen waren, weil sie »es für unmöglich hielten, mehr Zeit beim Heer zu verbringen. Sønderborg existiert nicht mehr. Die gesamte Stadt ist zerstört. In Augustenborg hat der Typhus die Armee und die Bewohner dezimiert. Lebensmittel und Unterkunft kosten wahnsinnige Preise …«
Van de Velde verbrachte eine Reihe von Tagen in Kopenhagen mit dem Versuch, die Dänen für die Idee des Roten Kreuzes zu gewinnen. Gewisse Sympathien erlangte er bei Ministerpräsident Monrad wie bei Kriegsminister Lundbye und der Königinwitwe Gräfin Danner. Doch vor allem waren die Dänen in einem Maße skeptisch, dass van de Velde, dem es normalerweise schwerfiel, sich herabsetzend über jemanden zu äußern, sich genötigt sah, festzustellen, der dänische Nationalcharakter sei »langsam«, »kalt« und nicht in der Lage, »Enthusiasmus zu zeigen«.
Vor allen sein Treffen mit dem dänischen Chefarzt Michael Djørup war niederschmetternd. Van de Velde nannte ihn hinterher »starrköpfig« und »ehrsüchtig«, weil Djørup die Idee rundweg ablehnte, Frauen könnten im Feld als Pflegerinnen fungieren – eine Idee, für die Dunant aufgrund seiner Erfahrungen bei Solferino eintrat. Krankenpflege in Kriegsgebieten sei eine Männerdomäne, für die Frauen weder die Fähigkeiten noch die Nerven hätten, meinte Djørup. Schockiert stellte van de Velde fest, dass die dänische Ärzteschaft sogar schwedische Frauen wieder nach Hause geschickt hatte, die nach Kopenhagen gekommen waren, um sich freiwillig als Pflegerinnen zu melden.
Obwohl van de Velde seinen Aufenthalt in Kopenhagen mit sehr gemischten Gefühlen betrachtete, konnte er sich doch nicht recht entschließen, nach Düppel zu reisen. Er wirkte ängstlich und schien den Termin der Abreise immer wieder hinauszuschieben. Er schrieb, er hoffe, Gott würde ihm das Leben schenken, denn seiner Ansicht nach würde der Aufenthalt bei der Armee »mit sicheren Gefahren verbunden sein … [in Sønderborg und Düppel] sind überall Bomben«.
Am 16. April traf er schließlich an der Front ein.
In seinem Brief vom 17. April beschrieb van de Velde, dass der Widerstand gegen eine internationale Hilfsorganisation, der ihm in Kopenhagen entgegenschlug, nichts war im Vergleich mit der Reaktion des dänischen Chefarztes bei Düppel, John Rørbye. Rørbye hatte ihm erklärt, es gebe keinerlei Bedarf für eine internationale Organisation. Es sei mehr als genug, wenn jedes Land seine eigenen privaten Wohltätigkeitsinstitutionen hätte.
Rørbye erzählte van de Velde, im dänischen Heer gebe es keinen Mangel an Männern, die »bei der Krankenversorgung helfen. Und wenn man etwas ganz bestimmt nicht wünschte, dann wären es ausländische Ärzte. Wegen ihrer mangelnden Dänischkenntnisse würde es nur zu Verzögerungen kommen.«
»Ich bot an«, schrieb van de Velde an Dunant, »dafür zu sorgen, Ärzte aus Holland nach Düppel zu senden, aber auch das wollte er nicht. Dann bot ich Hilfe aus Genf an. Er lehnte rundweg ab. Ich unterbreitete ihm die Ideen, wie man bessere Tragen für die Verwundeten bauen könnte. ›Nein, nein‹, antwortete Rørbye, ›es ist jetzt nicht die Zeit, um sich mit solchen Neuerungen zu befassen.‹ … Unglaublich, dass solch ein alter ruhmsüchtiger Mann an die Spitze einer so großen Unternehmung gestellt wird.«
Weitaus mehr Glück, sich für die Ideen des Roten Kreuzes Gehör zu verschaffen, hatte der zweite Abgesandte, Louis Appia. Die preußische Führung stand der Idee einer neutralen, internationalen Organisation positiv gegenüber (König Wilhelm I. war begeistert, als Dunant ihn 1863 in Berlin besuchte). Appia konnte vor den Generälen bei Düppel sprechen, er wurde von Marschall Wrangel zum Abendessen eingeladen und er bekam die Erlaubnis, sich an der Front frei zu bewegen. Dass seine Anwesenheit so positiv aufgenommen wurde, lag unter anderem an den Fortschritten auf medizinischem Gebiet. Hier waren die Preußen sehr viel weiter als ihre dänischen Gegner. Die preußische Armee hatte einige der fachlich besten Ärzte der Zeit in ihrem Stab, darunter Friedrich von Esmarch, den Vater der modernen Kriegschirurgie, auf den zahlreiche Erfindungen zurückgehen: bessere Blutstillmechanismen, Chloroformmasken, Prothesen und gefederte leichte Wagen für die Verwundeten. Gleichzeitig wurden im Gegensatz zum dänischen Heer auf deutscher Seite weit mehr freiwillige Hilfsorganisationen an der Front zugelassen, unter anderem der Johanniterorden und Diakonissen von einigen religiösen Organisationen in Deutschland.
Insgesamt hatten die Deutschen somit die Möglichkeit, für höhere hygienische Standards zu sorgen. Der dänisch-deutsche Krieg wurde der erste Krieg, in dem eine der Parteien – die Preußen – mehr Menschenleben auf dem Schlachtfeld verlor als durch ansteckende Krankheiten.
Er war somit auch ein Meilenstein in der humanitären Geschichte der Menschheit.
9. An der Front
Der Konstabler Nr. 68 der 4. Landwehrkompanie Johan Peter Larssen kniete bei einem übel zugerichteten Kameraden. Wenige Augenblicke zuvor war eine Brandgranate in der Schanze 6 eingeschlagen, die laut Larssen »die Luft mit einem hässlichen Schwefeldampf erfüllte, der geradezu erstickend war. Nichts war zu sehen in dem dichten Rauch; ich hatte einen so heftigen Schlag auf mein rechtes Schienbein bekommen, dass meine Freude groß war, als ich spürte, dass ich mein Bein ausstrecken konnte.«
Sein Nebenmann war nicht so gut davongekommen. Er jammerte: »Ich brenne, ich brenne.« Und dann fragte er Johan Peter Larssen: »Bin ich an beiden Beinen schwer verletzt?«
Larssen schrieb: »Sein rechtes Bein war direkt unter dem Knie abgerissen und lag unter ihm (er lag auf dem Rücken), es hing nur noch an einem halben Zoll dicken Hautfetzen. Sein linkes Knie war ganz weg, die Knochen lagen frei, ohne dass es blutete; vom Knie an aufwärts bis nah an die Hüfte war das Fleisch zerfetzt, und in dieser großen offenen Wunde stand seine Hose in Flammen. Ich versuchte, das Feuer zu löschen, indem ich meine Hände auf das klaffende Fleisch legte, aber nein, es gelang mir nicht. Durch mein wiederholtes Rufen nach Wasser kam schließlich ein barmherziger Mensch mit Wasser und ich konnte das Feuer löschen … Jetzt untersuchte ich ihn näher, der linke Oberarm des Menschen war gebrochen, der Mund stand voller Blut, und auch überall im Gesicht hatte er Blutspritzer.«
Der Soldat, der das Wasser gebracht hatte, verschwand wieder, überhaupt schien es so zu sein, als würden sich alle von dem malträtierten Soldaten abwenden. Vergeblich rief Larssen nach Hilfe durch die Sanitäter. Was sollte er machen? Er schaute auf den Verwundeten, der ihn anflehte zu bleiben. »Um Gottes willen, um der Barmherzigkeit Christi willen, verlass mich nicht.« Ihre Blicke trafen sich. »Ich werde es vermutlich niemals vergessen«, schrieb Larssen.
»Was ist das doch für eine merkwürdige Macht, die bisweilen im Auge des Menschen liegt? Dieser Blick, den er mir zuwarf, und der schuld daran war, dass ich sofort nach Sanitätssoldaten suchte, machte einen tieferen Eindruck auf mich als der Anblick seines erbärmlichen Zustands und seiner flehenden Worte; er verfolgte mich lange – noch in diesen Stunden steht er lebhaft vor mir, ja, in diesem Blick spiegelten sich deutlicher, als Worte es wiedergeben können, all seine Leiden, all seine Furcht und all seine Hoffnung. Er hatte das linke Bein angewinkelt, ein paar Mal musste ich es zurechtlegen, aber das verursachte nur noch größere Schmerzen. Bei jedem Schuss, der kam, während er dort lag, schauderte er vor Angst, er zitterte und drückte meine linke Hand, die er mit seiner rechten hielt, noch fester …«
Die Hilfe blieb aus. Trotz der Versicherungen des Oberarztes Rørbye gegenüber van de Velde, dass es genügend Krankenpersonal bei der dänischen Truppe gäbe. Während ringsum Granaten einschlugen, hatte Larssen alle möglichen Gründe, darüber zu spekulieren, warum in aller Welt er sich freiwillig zu diesem Krieg gemeldet hatte. So hatte er es sich jedenfalls nicht vorgestellt. Er hatte eine wogende Schlacht vor sich gesehen: rasches Vorrücken, lebhaftes Artilleriefeuer. Ruhm, Mut, Ehre. Aber das hier? Dieses Elend?

Abb. 18: Johan Peter Larssen, Konstabler, 42 Jahre alt.
Bei Johan Peter Larssen handelte es sich um eine der kurioseren Erscheinungen im dänischen Heer. Unter anderem war er mit zweiundvierzig Jahren der älteste gemeine Soldat der Armee. Dazu kam seine Bekleidung. Er hatte keine vollständige Uniform, sondern trug eine ganz alltägliche Jacke. Immerhin besaß er eine Uniformhose und einen Militärmantel nebst Artilleriekonstabler-Käppi. Larssen war ein großer, hagerer Mann mit einem langen, dunklen Vollbart.
Der 17. April war sein achter Tag als Soldat des dänischen Heeres, und die Art, wie er in der Armee aufgenommen wurde, war eher unorthodox. Larssen war ehemaliger Leutnant der Marine und während des dreijährigen Krieges Kommandant eines Kanonenbootes gewesen. Nach dem Krieg wurde er Kapitän des Feuerschiffs »Læsø Rende«, und während 1863 die dunklen Wolken im dänisch-deutschen Grenzland aufzogen, ging er seiner einsamen Arbeit auf der »Læsø Rende« nach. Am 2. Februar 1864 kam ein Schoner vorbei, und von den Seeleuten an Bord hörte er vom Ausbruch des Krieges. Bei dieser Gelegenheit erfuhr er auch vom dänischen Sieg bei Missunde.
Larssen war trotz seines ruhigen Berufs ein unruhiger Geist. Er konnte nicht einfach passiv auf seinem Feuerschiff ausharren. Wie würde es dem dänischen Heer ergehen? Er dachte an den Krieg, und zehn lange Tage vergingen, bevor das Postboot aus Sæby kam und Neuigkeiten brachte: Das Danewerk war geräumt worden.
Larssen war besorgt, schrieb sofort ans Marineministerium und teilte in dem Brief mit, er wäre bereit, wieder in den Militärdienst zu treten. Er war überzeugt, dass man sein Angebot mit Kusshand annehmen würde. Aber nein. Das Ministerium gab zur Antwort, sie würden es lieber sehen, wenn der Feuerschiffer »in diesen unruhigen Zeiten sein Schiff nicht verließe, welches das Ministerium bei ihm in guten Händen wisse«.
Doch Larsson ließ sich mit einer Absage nicht abspeisen. Er verfügte über Erfahrungen, die der dänischen Armee durchaus nützlich sein konnten. Im letzten Krieg hatte er Kanonen bedient; er hatte sich Schusswechsel mit dem Feind geliefert, und er hatte es bis zum Befehlshaber über drei Batterien, bestückt mit Schiffskanonen, bei Fredericia gebracht.
Selbstverständlich würde er nützlich sein können. Larssen schrieb seinem Bruder, Leutnant Otto Kaalund Larssen, der bei den Pionieren in Düppel lag, und einem seiner Freunde, dem Hauptmann der Artillerie Gerhard Hagerup, ob nicht »ein Mann, durchaus nicht unerfahren im Exerzieren mit Kanonen, zum Dienst an den Düppeler Schanzen angenommen werden könnte?«
Er unterließ es mitzuteilen, dass es sich bei diesem Mann um ihn selbst handelte, und als er zur Antwort bekam, der Mann dürfe gern erscheinen, kündigte er seine Stellung auf dem Feuerschiff und reiste nach Düppel. Sein Freund Hauptmann Hagerup war verblüfft und sagte rundheraus: »Was zum Teufel willst du hier? Mensch, du bist doch verrückt!«
Aber Larssen war gekommen, um im Heer zu dienen. Niemand konnte ihn daran hindern. Stur, wie er war, gelang es ihm, beim Befehlshaber der Artillerie vorzusprechen, dem beliebten Major Jonquires (der im Übrigen auch van de Velde freundlich empfangen hatte). Ihm gefiel Larssen so gut, dass er ihm eine schriftliche Empfehlung gab, und kurz darauf wurde Larssen als Konstabler in die 4. Landwehrkompanie aufgenommen. Der Hauptmann dieser Kompanie konnte ihn allerdings nicht in der regulären Form ausstatten. Larssen bekam einen Tornister und einen Säbel, aber keine Uniformjacke. Er würde seine Jacke vom nächsten Artilleristen erhalten, der fiel, bemerkte der Hauptmann trocken. Noch als Larssen mit dem Hauptmann sprach, hieß es, eine Jacke sei frei geworden. Es stellte sich allerdings heraus, dass sie unbrauchbar war – der Soldat, dem sie gehörte, war in Stücke gerissen worden. Larssen müsse auf eine Jacke warten, bis ein Artillerist in den Kopf geschossen wurde, erklärte der Hauptmann.
Am Abend des 8. April hatte Larssen zum ersten Mal Dienst auf der Schanze 6. Er befand sich auf der Anhöhe von Düppel, in einer Landschaft, in der die Granatexplosionen, wie er schrieb, »bald nah, bald fern« waren. Die Schanze, zu der er eingeteilt war, verblüffte ihn. Er hatte die Schanzen im Sommer davor gesehen, und da »sahen sie so schmuck aus, dass man am liebsten – wie es über gewisse holländische Städte heißt – die Stiefel aus- und Pantoffeln angezogen hätte, um die Straßen nicht zu beschmutzen«.
Am 8. April hatte die Schanze nichts Schmuckes mehr an sich. »Jetzt waren diese schönen Wälle und Gänge so von explodierenden Granaten zerstört und mit Sandsäcken geflickt, dass man sie nicht mehr erkennen konnte … auch der Eingang zu den Schanzen sah nicht erfreulich aus. Die Brustwehr und die Traversen waren so zerschossen, dass die Kanonen sich zwischen den abgeschossenen Schanzendeckungen und Sandsäcken nicht mehr bewegen ließen.«
Die ersten Tage versuchte Larssen eine gewisse Kaltblütigkeit zu zeigen und Optimismus um sich herum zu verbreiten. Er organisierte eine Arbeitsgruppe, die ihm half, die zerschossenen Kanonen wieder aufzustellen und an ihren Platz zu bugsieren – nur um dann zuzusehen, wie sie weitere Volltreffer erhielten.
Am frühen Morgen des 11. April wurden sie plötzlich auf den Schanzen von Gewehrkugeln beschossen; man hörte das Gebrüll der Preußen in den Parallelen, und die Dänen waren überzeugt, nun ginge es los. Mit einer Mischung aus Entsetzen und Eifer waren Larssen und seine Artilleristen zu den Kanonen gelaufen, die noch zum Einsatz gebracht werden konnten, um den Feind zu empfangen … aber – falscher Alarm.
Am 12. April war der Granatbeschuss der Schanze »so stark, dass der Boden vor Explosionen bebte, die Sandsäcke, Tornister, Ladewerkzeug und Gott weiß, was sonst nicht noch alles, nach allen Seiten verstreuten«, schrieb Larssen.
Eine Reihe von Soldaten wurde an diesem Tag getötet oder verwundet, und einer auch am Kopf getroffen, sodass der Soldat »wie wahnsinnig durch die Schanze rannte«. Die Stimmung war miserabel und Larssen hörte, wie seine Kameraden sagten, »sie seien eindeutig hier, um geschlachtet zu werden«. Im Laufe des 12. April verlor auch Larssen seinen Optimismus, denn bei all der Mutlosigkeit um ihn herum »verliere ich in der Tat das Vertrauen, dass die Stellungen bei Düppel recht viele Tage zu halten sind«.
In den nächsten Tagen fielen einige seiner Kameraden – und aus dem zweiundvierzigjährigen Mann voller Kampfgeist war bereits am 17. April ein abgehärteter, aber desillusionierter Veteran geworden, der bei einem verstümmelten Mann saß und darauf wartete, dass endlich ein paar Sanitäter kamen und sich des Schwerverwundeten annahmen. Der Verletzte drückte seine Hand. Larssen brüllte mit der ganzen Kraft seiner Lungen: »Gibt es denn niemanden, der Hilfe holen will?« Schließlich besorgte ein schwedischer Freiwilliger eine Trage, »sodass der schlimmste Moment meines Lebens überstanden war«, notierte Larssen später.
Überall in den dänischen Stellungen spielten sich an diesem Tag ähnliche Szenen ab. Am 17. April wurden 4222 Granaten auf die Schanzen abgefeuert, die Verluste in den dänischen Reihen waren weder sonderlich hoch oder gering. Sie waren durchschnittlich: 77 Tote und Verletzte.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.