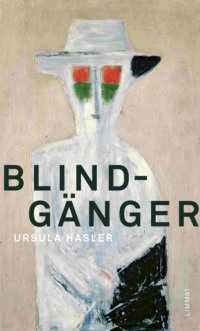Kitabı oku: «Blindgänger», sayfa 5
Royan war Mitte April 1945 während der mehrtätigen Befreiungskämpfe erneut und wiederholt bombardiert worden, 2500 Bomber warfen in der Gegend 7000 Tonnen Bomben ab, über Royan mit 72 5000 Liter Napalm, das die Amerikaner in Europa erstmals testen wollten. Das Resultat war enttäuschend, aber spektakulär. Napalm entfachte ein sinnloses danteskes Inferno, völlig nutzlos gegen die Bunker, aber die Ruinen von Royan standen in höllischen Flammen. Am Schluss blieb von der Perle des Ozeans eine verkohlte bizarre Landschaft verkrümmter Eisen, schwarzer Steinhaufen, verbrannter Erde.
Eine Woche vergeht, wieder Samstag. Er sollte dringend in Erfahrung bringen, unter welchen Umständen ein Säugling im März 1945 hier ohne Geburtspapiere zur Welt kommen und offiziell als Kriegswaise deklariert werden konnte. Wahrscheinlich ist, dass totales Chaos geherrscht und keine Zivilbehörde mehr funktioniert hat. Das würde seine Hypothese des Findelkindes nach der Bombardierung bestätigen. Erster Schritt also herausfinden, wie die Lage in der Region im Frühjahr 1945 genau war. Präzise Grenzen der poches, der besetzten Gebiete sowie der befreiten Gebiete, genaue Daten der Bombardierungen. Er braucht Bücher zur Besatzungszeit, gibt es bestimmt in der Gemeindebibliothek. Er kennt die Öffnungszeiten, seit einer halben Stunde ist die Ausleihe geöffnet, nichts wie hin.
Datei «Bombardierungen nach März 1945», 22. Mai 2003, unverändert übernommen
Die Bibliothek hat spezielle Regale voller Bücher zur Kriegsgeschichte der Region! Sehr viel Material, die Qual der Wahl. Konzentriere mich auf die Besatzungszeit, Zeugenberichte, Militärische Details zu den poches. Konnte nur fünf Bücher mitnehmen, und gegen Kaution, da kein fester Wohnsitz in Royan …
Internetrecherche mit Suchbegriff «Bombardements Charente-Maritime 1945» bringt nichts Brauchbares, außer zu Royan.
2. Bombardierung von Royan 14.–16.4.1945 (Details ville-royan.fr) ist keine brauchbare Spur. Vermutlich unsinnig, Stadt war zerstört. Keine Zivilisten mehr, sicher keine Frauen mit Säuglingen. Napalmbomben brannten den Rest der Stadt völlig aus. Bleibt einzig die andere poche, wo Deutsche die Festung hielten: La Rochelle. War die letzte befreite Stadt in Frankreich, einen Tag nach der deutschen Kapitulation am 8. Mai 1945. Aber kaum mehr Bombardierungen, La Rochelle wurde den Siegermächten ohne weitere Zerstörungen übergeben.
(Interessante These: Die Wehrmacht habe sich in den poches nicht aus Widerstand bis zum Äußersten verschanzt, sondern in relativer Sicherheit die Kapitulation im fernen Deutschland abgewartet …)
Nur die völlig unerwartete erste Bombardierung Royans am 5. Januar würde Sinn machen (so was Absurdes!), aber ausgeschlossen wegen Geburtsdatum 31. März. Die Frage ist, um wie viel sich ein Arzt im Alter bei einem schwächlichen kranken Säugling verschätzen kann. Ein bis zwei Monate höchstens. Gäbe frühestens zwischen Mitte und Ende Januar als Geburtstermin, also nach der Bombardierung. Bin ich womöglich noch älter??
Zivilgesellschaft: tatsächlich keine funktionierende Ziviladministration mehr im besetzten Royan nach Bombardierung bis zur Befreiung am 16. April. Außerhalb schon. Adoptionspapiere wurden schnell ausgestellt, ein Kind weniger in den unterversorgten Heimen.
Also, rebelote, zurück an den Start. Wie weiter? Keine Ahnung …
Royan, Freitag, 23. Mai 2003
Eine griffige Definition von Heimat wäre jetzt hilfreich. Das Problem: diffuse Heimatlosigkeit. Der Mensch gewöhnt sich an alles, an Wohnorte, an Häuser, an Orte, selbst an andere Menschen. Winkt am Ende des Gewöhnens dann Heimat? Sind Kinder und Familie Heimat? Braucht das einer (wie er)? Er hat im Unterschied zu all den andern im Leben Herumstolpernden doch eine bequeme Entschuldigung für seine Verlorenheit. Wer seine Herkunft nicht kennt, hat auch keine Heimat.
Heute weiß er, warum die Tatsache seiner Adoption ihn so aus der Bahn geworfen hat, damals. Er war nicht mehr in den Zeitstrom der Generationen eingefügt, wurde brutal hinausgeworfen. Erst die Geburt von Nadine half ein bisschen. Damit steht er am Anfang einer Generationenkette, ein Adam. Seine Tochter führt sie fort, und für alle nach ihr wird es immer unbedeutender, dass hinter ihm, dem Gründer, nur Leere ist. Annet wirft ihm vor, er weiche immer aus, würde keine Verantwortung für sein Leben übernehmen. Unsinn. Wahr ist, dass das Nichts hinter ihm oft eine praktische Ausrede liefert, wenn die Dinge falsch laufen. Die Schuld der unbekannten Gene, manchmal ganz praktisch. Ein kleiner Vorteil sei ihm vergönnt.
Die irrationale Sehnsucht, eine Geschichte zu haben, schmerzt manchmal richtig körperlich, wie jetzt. Ein Brennen hinter dem Brustbein. Ja, ein Heimweh nach Familiengeschichte. Aufgehoben sein in Geschichten, Anekdoten, über Generationen erzählt. Die Familiensagen der Martys gehen ihn nichts mehr an, nicht seine Vorfahren. Ist so verdammt wichtig, dass es seine Blutsverwandten sind. Alles, was sie taten, war notwendig und richtig, weil es zur Existenz seines Vaters und seiner Mutter geführt hat. Was die Voraussetzung für seine Zeugung und sein Leben war. Voilà. Von seinem Leben aus gesehen, ist die ganze Ahnenreihe nur dazu da, damit er gezeugt wurde. Er will wissen, welche Zufälle oder Schicksalsfügungen es brauchte, um seine Existenz zu ermöglichen. Wessen Gene seinen Körper so geformt haben, wie er ist.
Wie sah eine Frau, wie ein Mann aus, damit ein Kind wie er entstehen konnte: dunkle Haare (als Kleinkind blond), helle Augen, etwas zwischen blau und grün. An die Vererbungslehre müsste man sich erinnern, dominante und rezessive Merkmale, braune Augen dominieren blaue, schwarze Haare blonde. Haben aber zwei braunäugige dunkelhaarige Elternteile beide ein rezessives blaues Auge und verstecktes Blondhaar, besteht ein Viertel Chance, dass das Kind helle Augen und Haare hat. Also gab es in seiner Ahnengalerie blonde, helläugige Vorfahren. Ist er das Viertelskind, hatten die Eltern braune Augen. Ist er aber ein Dreiviertelskind, hatten Vater oder Mutter oder beide helle Augen. Alle Kombinationen sind möglich, er steht mit seiner lächerlichen Laiengenetik wieder am Anfang.
Wie steht es mit Körperbau und Charakter: mittelgroß, eher feingliedriger Körperbau, lange, schmale Hände, eher unmusikalisch, unsportlich, unsicher, untüchtig im Leben, aber scharfer, manchmal zersetzender Intellekt und so weiter. Anzufügen wären noch die zerfleischenden Selbstzweifel. Was angeboren, was anerzogen – nicht zu beantworten.
Datei «Charente», 13. Mai 2003, unverändert übernommen
Problem mit Departementsbezeichnung: Charente-Maritime (hier in Royan, Dept. 17) hieß bis 4. September 1941 Charente-Inférieure. Die Charente (Dept. 16, Hauptstadt Angoulême) liegt östlich, nicht am Meer.
Mutter sprach nur von Charente. Charente wurde aber im Sommer 1944 befreit, keine Bombardierungen mehr nachher. Muss sich also um die heutige Charente-Maritime handeln. Umso besser, schränkt Radius ein.
Ein weiterer Morgen. Er hat mittelprächtig geschlafen, verglichen mit den normalen schlaflosen Nächten zu Hause sogar gut. Er liegt noch ein Weilchen auf dem Rücken, wie meist, Arme hinter dem Kopf verschränkt, das Zimmer noch beinahe im Dunkeln, nur wenig Licht dringt durch die Ritzen der Läden ohne Jalousien. Zu wenig Licht, um das Wetter zu erraten. Etwa halb acht, wie immer. Er schlägt die Bettdecke zurück, die Latschen liegen nicht in der Nähe, der Boden ist kalt, wie immer, barfuß schließt er das Fenster, er kann nur bei geöffnetem Fenster schlafen, wenn überhaupt. Wie immer erster Gang auf die Toilette, auf dem Weg dorthin Kaffeemaschine anstellen, wie immer hat er am Abend Filterpapier eingelegt, dazu zwei Löffel Kaffeepulver und in den Wasserbehälter zwei Tassen Wasser geleert. Noch bevor er um die Küchentür Richtung WC biegt, blubbert sie schon, wie immer.
Wenn er danach ins Badezimmer geht, zieht bereits Kaffeeduft durch den Korridor. Jeden Morgen ärgert er sich über den Duschvorhang, der an seinem nassen Körper klebt. Vor dem Rasieren ein prüfender Blick in den Spiegel, schwere Augenlider heute, das hingegen ist nicht jeden Morgen der Fall. Anzeichen des Alters. Im Schlafzimmer faltet er die sperrigen Holzläden des Fensters zurück, heute grau verhangener, windstiller Himmel. Kaffee trinken, Zeitung von gestern nochmals durchblättern, meist ist danach bereits halb neun, Zeit sich langsam bereit zu machen, um neun beginnt der Unterricht, für den Weg braucht er kaum zehn Minuten, er mag aber nicht zu knapp eintreffen, man plaudert vorher noch ein bisschen herum. Heute ist kein Unterricht, sie sollen an ihren Projekten arbeiten.
Sein Alltag läuft am Schnürchen, ohne dass er den Kopf noch benötigt. Wann kippt das, wann beginnt beim Ungewohnten das «Un» zu verblassen und sich in das Gewohnte aufzulösen? Nach etwa zwei Wochen. Die Zeit der ersten Tage an einem fremden Ort ist dehnbar, sie kann unendlich viel aufnehmen und in Erinnerung umwandeln. Nur einer, der fremd ist, sieht die Dinge. Nur einer, der sich selbst fremd wird, sieht sich wieder.
Diesen aufregenden ersten Blick auf das Neue mit geschärften, hungrigen Sinnen. Damals, als er nach der ersten Nacht früh durch sein Sträßchen schritt. Die Frische der Morgenluft mischte sich mit der verbrauchten Nachtfeuchte aus den geöffneten Haustüren der alten Häuser. Und als er in der Dämmerung nach dem ersten Tag auf dem Balkon stand, die Silhouette der Pinien im Hinterhof schnitt eine schwarze Fläche aus dem grünen Abendhimmel, schnalzten in der Schwärze wilde Tauben im Liebeswerben oder im Träumen davon. Wie kann einer diesen Zustand halten oder immer wieder herstellen?
Die Tücke der Gewohnheit ist, dass sie das Leben erleichtert und einen blind macht. Jahrelang hat er sich mutlos nur im gewohnten Alltag bewegt, er ist ein Langweiler gewesen und die Zeit vorübergerast, nein falsch, es gab keine Zeit mehr, auf jeden Fall kein Zeitgefühl. So kommt man sich selbst abhanden. Man hat kein Sinnesorgan für Zeit. Man sieht nur die Millimeter oder Zentimeter, die Uhrzeiger auf dem Ziffernblatt sichtbar zurücklegen. Er verabscheut Digitaluhren, sie zeigen nur Zahlen, keine Bewegung mehr, du siehst nicht, wie die Zeit von Stunde zu Stunde fortschreitet.
Schluss. Er steht auf und giesst den schwarz konzentrierten Kaffeerest aus dem Glaskrug in die henkellose Tasse. Er könnte zum Beispiel: Beim Gehen durch Straßen das vorher nie Bemerkte bemerken. Vielleicht lässt sich das Gehirn so trainieren, lassen sich die Erkennungsmuster so auszuschalten, wie er es mit den Wörtern kann. Sie immerzu wiederholen, bis sich jeglicher Sinn auflöst. Etwas anschauen, anschauen, anschauen, bis man es nicht mehr erkennt. Bis der Stuhl zu einer bedeutungslosen Konstruktion aus Holz wird. Dekonstruktion der Bedeutung auch beim Sehen.
Auf der Küchenuhr, ebenfalls Relikt aus den Fünfzigern, gehen die Zeiger unaufhaltsam ihre Wege, die Zeit einer kompletten Umdrehung auf dem Ziffernblatt, bald zehn Uhr. Bon, was steht heute an?
An diesem außerordentlichen Sitzungstermin am Freitagabend, 19. September 2003, saß Marty pünktlich um fünf mir gegenüber, ordnungsgemäß auf dem Klientensessel, und erkundigte sich leicht betreten, ob ich Zeit gefunden hätte, den Text zu lesen. Ja, ich wies auf die vor mir auf dem Schreibtisch liegenden Ausdrucke und sah ihn auffordernd an, erleichterte ihm aber in keiner Weise den Einstieg in das von mir gefürchtete Eingeständnis, er sei der Aufgabe nicht gewachsen.
Es war ihm sichtlich peinlich. Er komme nicht weiter. Er habe sich völlig verheddert in den Aufzeichnungen. Dann noch diese Datei mit dem fremden Manuskript. Es bringe nichts. Es funktioniere nicht. Es könne nicht funktionieren. Nichts geschehe in seinem Kopf.
Er wartete auf Einspruch von mir, der ihm Widerspruch und Gegenargumente ermöglicht und die unangenehme Entscheidung auf uns beide verteilt hätte.
Ich konzentrierte mich auf die Blätter vor mir, ich höre.
Also fuhr er fort, unvorstellbar mühsam sei das Verarbeiten der Tagebuchnotizen. Dieses fremden Kerls. Voraussetzung sei doch, dass er sich mit dem Verfasser der Aufzeichnungen identifiziere. Der aber bleibe ein kompletter Fremdling, nicht mal in der Fantasie gelinge es ihm, in dessen Haut zu schlüpfen. Seine Aufgabe sei, sich den Inhalt anzueignen und wiederzugeben, wie ihm beliebe, nicht wahr. Genau das schaffe er nicht. Unmöglich. Mit der Zeit, ich hätte das bestimmt bemerkt, habe er mehr oder weniger nur noch abgeschrieben, was diesem Marty in Royan alles durch den Kopf ging. Und das sei ja wohl nicht der Zweck der Übung.
Ich sah kurz auf, nickte.
Schon lange bereue er seine Einwilligung, ich solle ihm bitte nicht mit den Sprüchen kommen, gerade in den Widerständen liege der Schlüssel zum verschütteten Zugang zu seinem früheren Leben.
Ich verkniff mir ein Schmunzeln.
Er gebe sich wahrhaftig alle erdenkliche Mühe. Sich aus den kargen, oft nur stichwortartigen Einträgen vorzustellen, was sich abgespielt hatte, nein, abgespielt haben könnte, sei äußerst anstrengend. Nicht machbar. Ihm fehlten Stoff, Erfahrung, Gefühle, Bilder. Höchst selten einmal laufe es wie von alleine, wenn die Sätze in die Tastatur fließen, als wäre das Denken ausgeschaltet. Meist aber, fast immer eigentlich, ende der Versuch vor einer mächtigen Wand. Da quere eine weiße Mauer sein Gehirn mit einer Selbstverständlichkeit, die keine Rechtfertigung brauche, unüberwindbar. Er könne sich nicht in diesen Jean-Pierre Marty hineinversetzen. Geschweige denn sich mit ihm identifizieren. Er wolle nicht.
Ich schwieg längere Zeit. Meinte dann, ich würde das selbstverständlich akzeptieren.
Die erwarteten und nun ausbleibenden Einwände und Überzeugungsversuche meinerseits brachten Marty aus dem Konzept. Seine Widerstandsenergie, die er im Hinblick auf dieses Gespräch mit mir kräftig aufgebaut hatte, fiel zusammen. Er war bereit, auf neue Vorschläge meinerseits einzugehen, als Wiedergutmachung für seine Unzuverlässigkeit, schließlich brach er sein Versprechen.
Ich setzte ihm meinen Vorschlag auseinander. Am Dienstag, in vier Tagen also, finde ja unsere reguläre Sitzung statt. Seine Texte, ich hielt die Blätter in die Höhe, hätten mich beeindruckt, ob er bereit wäre, zumindest für einige Tage, probehalber sein eigenes Journal zu führen, er über sich jetzt hier in der Klinik, und zwar in einer Form, welche die anschließende Lektüre durch mich erlaube.
Ich musste Marty irgendwie dazu bringen, die selbst auferlegte Fixierung zu lösen, dass er sich notwendigerweise mit «dem Andern» zu identifizieren habe, in seine Haut schlüpfen müsse, wie er es selbst ausgedrückt hatte. Der aktuelle Marty mit Amnesie sollte vielmehr, ausgehend von seiner jetzigen Verfassung, die Aufzeichnungen seines früheren Ichs frei umgestalten. Ich hoffte, dass er durch das Schreiben eines eigenen Journals mit unmittelbaren Reflexionen des gegenwärtigen Ichs die notwendige Souveränität über seine alten Tagebücher gewinnen würde.
Marty blickte mich misstrauisch an, in seinem Gesicht standen deutliche Zweifel, was das bringen solle, welche therapeutische Manipulation ich damit wieder anzuwenden gedachte. Er überlegte lange. Ohne Vorstellung einer eigenen Identität sei es ihm nicht möglich, ein Tagebuch in der Ich-Form zu schreiben, in einem eigenen Journal noch weniger als bei dem andern in Royan. Kein innerer Bezugspunkt da. Es gehe höchstens mit der Distanz der Außenbetrachtung. Er willigte unter der Bedingung ein, im Stil seiner eigenen Aufzeichnungen völlig freie Hand zu haben, was ich ihm selbstverständlich zugestand.
Vier Tage später, rund eine Stunde vor unserer Sitzung, was mir die Lektüre gerade knapp ermöglichte, warteten die ersten eigenen, vom Sekretariat ausgedruckten Journalseiten von Marty auf meinem Tisch. Das Schreibproblem löste sich unerwartet auf glückliche Weise auf.
Klinik Rychenegg, Sonntag, 21. September 2003
Es ist, wie befürchtet, nirgends ein Ich in Sicht, das den Gefühlen und Eindrücken eine Perspektive und festen Halt böte. Eine erzählende Annäherung an den Schreibenden durch den Schreibenden ist nur von außen möglich. Dr. Klarer wird es akzeptieren müssen.
Entschlossen klappte der Mann ohne Erinnerung und Identität das Laptop zu, Viertel nach zwölf, ohnehin höchste Zeit essen zu gehen, man schätzte es, wenn die Patienten pardon Gäste pünktlich bei Tisch erschienen. Er wird es heute mit der Mahlzeit kurz machen, für zwei Uhr hatte sich Besuch angekündigt, Dr. Franz Brodbeck, Studienkollege und ältester Freund des Andern, Gymnasiallehrer für Deutsch und Philosophie, ebenfalls an der Alten Kantonsschule Aarau. Von ihm erhofft sich der Mann ohne Gedächtnis wertvolle Hinweise auf die Ereignisse der vergangenen Monate.
Als er gedankenverloren die breite, mit dicken Teppichen ausgelegte Steintreppe hinunterstieg, gesellte sich im ersten Stock eine reizende ältere Dame zu ihm, begrüßte ihn freundlich, schöner Tag heute, Herr Marty, nicht wahr. Wie peinlich, er lächelte ihr verlegen zu, woher kannte sie ihn. Die Treppe machte ihr Mühe, er bot ihr seinen Arm und so blieb sie an seiner Seite bis in den Speisesaal. Das Rätsel war schnell gelöst, ihr Platz befand sich am selben Tisch, ihm schräg gegenüber, er hatte sie gestern nicht einmal bemerkt. Kaum erstaunlich, so sauer wie er gestern war. Aus gutem Grund.
Bei seiner Ankunft in Rychenegg hatte er um einen Einzeltisch gebeten, den man ihm ausnahmsweise, es war gegen die Philosophie der Klinik, für die Tage der Eingewöhnung zugestand. Er fühle sich physisch unfähig, mit andern Personen, die ihn ohnehin nicht interessierten, höfliche Tischkonversation zu betreiben. Wie könne einer, der kein Leben habe, darüber plaudern. Man zeigte Verständnis und rückte einen Zweiertisch vom Sechsertisch weg für ihn allein, dadurch saß er zwar unangenehmerweise im Verkehrsbereich des emsigen Servierpersonals, das ihn voll beladen mit Tellern oft beinahe streifte, wohl damit er sich nicht allzu sehr an den Einzelplatz gewöhnte. Aber davon ließ er sich nicht stören, Hauptsache, sie ließen ihn in Ruhe.
Gestern hatte man den Ausnahmezustand beendet. Ohne ihn zu warnen. Als er am Mittag den Speisesaal betrat, war sein einsames Tischchen weg, es hatte Anschluss bei einem Vierertisch gefunden. Dort jedenfalls entdeckte er nach verärgertem Suchen sein Namensschildchen. Offenbar war die Gelegenheit benutzt worden, seine Rückkehr in die Gesellschaft mit der Zusammenstellung eines neuen Tisches zu kombinieren. Wie immer am Samstag, fand gestern reger Gästewechsel statt, als ob psychische Krankheiten im Wochenrhythmus ausbrachen und geheilt würden. Er war als letzter an den Tisch gekommen, hatte einen Gruß gegenüber und seitlich links gemurmelt, ein Glück, dass sein Platz am Rand war. Und unhöflich schweigend gegessen, keiner konnte ihn schließlich zur Konversation verpflichten.
Aber die reizende alte Dame verdiente seine Grantigkeit nicht, galant rückte er ihr heute den Stuhl zurecht und versuchte diskret einen Blick auf ihr Tischkärtchen zu werfen. Mathilda Trummer. Er wünschte einen gesegneten Appetit und fragte sie später, als der Hauptgang serviert war, Rinderbraten mit Kartoffelstock und mediterranem Gemüse, schmeckt es Ihnen, Frau Trummer? Fräulein Trummer, korrigierte sie, noch bevor sie die Gabel in den Mund schob. Amüsiert entschuldigte er sich. Wohl eine strenge Geigenlehrerin, die noch mit achtzig unerschütterlich optimistisch das Letzte aus untalentierten Schülern herausholte.
Er schaute sich heute seine Tischnachbarn etwas genauer an, um dann mit ausgesuchter Höflichkeit gleich klarzustellen, dass man mit ihm fürs Gespräch nicht rechnen durfte.
Ihm gegenüber war eine ziemlich verhärmte Frau mittleren Alters platziert worden, sie blieb still, schien sich ausschließlich für ihren Teller zu interessieren, stocherte aber nur im Essen herum. Von ihr hatte er nichts zu befürchten. Eher von seinem Nachbarn links, einem jovialen Mittsechziger, Typus Vertreter, der seinerseits nach links gewendet seine Nachbarin mit einem nicht unterbrechbaren Monolog unterhielt, stirnrunzelnd von Fräulein Trummer mitverfolgt. Otto Stutz. Garage Stutz, Carrosserie, Pneus, Toyota-Vertretung, freut mich, das Händeschütteln war nicht zu vermeiden. Er begnügte sich mit einem verschluckten Jean-Pierre Marty, nichts zu machen, er brachte den Namen nicht über die Lippen.
Der Rest der Mahlzeit verlief für ihn angenehm ruhig, die Garage Stutz hatte sich wieder der seinem Charme zugänglicheren Dame links zugewendet. Am weitesten von ihm entfernt, ganz links auf der andern Tischseite, saß ein weiterer Mann, um die fünfzig, hagere Sportlichkeit, vermutlich viel Selbstkasteiung. Die Vergrämte ihm direkt gegenüber hatte den Tisch mit einer Entschuldigung vor dem Dessert verlassen, von Zeit zu Zeit nickte er Fräulein Trummer lächelnd zu. Warum waren die alle hier in diesem diskreten Haus für psychische Reha? Keiner schnitt das Thema an.
Es wurde im ehemaligen Speisesaal des Kurhotels gegessen, den man allerdings vor einigen Jahren mit besten Absichten und zweifelhaftem Resultat modernisiert hatte, funktionell, praktisch, zeitgemäß. Über solch bauliche Unsensibilitäten konnte er nur den Kopf schütteln. Aber alles dezent luxuriös, Sechsertische, gepflegt gedeckt mit weißen Tischtüchern, Stoffservietten, täglich erneuert wie im Restaurant, täglich frische Blumen, auch das Servierpersonal gekleidet wie in der Gastronomie. Die Gäste ließen sich die perfekte Hotelkulisse eine schöne Stange Geld kosten. Vermutlich auch er, die Frau hatte seinen Aufenthalt hier organisiert, er musste sie dringend danach fragen. Er durfte nicht Geld verschwenden, das nicht seines war.
Vor dem Kaffee zog er sich aufs Zimmer zurück, wollte sich noch mal ein paar Fotos von Franz Brodbeck ansehen, um sich ein Bild zu machen, wortwörtlich. Das Wenige, was er über ihn wusste, hatte ihm die Frau erzählt. Es war wie eine Eingebung vor ein paar Tagen, wer denn der beste Freund ihres Mannes sei. Das Fotoalbum, das Mädchen hatte ihm die Alben der letzten Jahre hoffnungsvoll mitgebracht, lag auf der richtigen Seite geöffnet auf der Kommode. Er setzte die Brille auf und ging mit dem Album ans Fenster, Marty und Brodbeck beide mit Schürzen und Zangen in der Hand lachend hinter einem Grill stehend. Marty, Brodbeck und das Mädchen Nadine im Gras hockend mit Sandwich in der Hand, Bergpanorama, vermutlich eine Wanderung. Marty, Brodbeck und Annet in der gleichen Wanderkleidung an einem rustikalen Tisch sitzend und der Fotografin zuprostend, diesmal vermutlich Nadine. Nirgends eine Partnerin von Brodbeck zu sehen. Er schien eher klein, schlank, halblange, mehrheitlich ergraute Haare mit Mittelscheitel, randlose Brille, das Abbild eines Deutsch- und Philosophielehrers. Offener Blick, lachend, auf den Fotos zumindest, er fand ihn sympathisch.
So auch in Wirklichkeit, auf Anhieb. Sie hatten sich beim Empfang verabredet, er erkannte ihn dank der Bilder problemlos, andersherum stellte sich das Problem ja nicht, Brodbeck reichte ihm zögernd die Hand, die Verunsicherung stand ihm ins Gesicht geschrieben, vermutlich hatten sich die Freunde jeweils zur Begrüßung umarmt. Er schlug vor, Richtung Städtchen zu spazieren, er wollte raus aus der Klinik, Brodbeck war alles recht.
Mit ihm kam man leicht ins Gespräch, sogleich war eine Vertrautheit zwischen ihnen, dabei kannte er ihn seit kaum einer halben Stunde, es könnte eine neue Freundschaft entstehen. Ja, unerklärlich, weshalb ihn dieser Gedanke bisher noch nie gestreift hatte, er musste sich um neue Freunde bemühen, falls der Gedächtnisverlust irreparabel war. Mit achtundfünfzig und ohne Lebensgeschichte neue Freunde finden, wie packte man so was an? Wie wohltuend, dass er mit Brodbeck über seine groteske Erfahrung von verschwundenen Erinnerungen sprechen konnte wie über einen medizinischen Fall. Ohne die lästigen Schuldgefühle wie bei der Frau und dem Mädchen, weil er nicht wusste, was sie von ihm erwarteten. Brodbeck hörte aufmerksam zu, mit beinahe wissenschaftlicher Anteilnahme.
Erkenntnistheoretisch eine hochinteressante Ausgangslage, meinte der Philosoph Brodbeck schließlich, welchen Stellenwert Erinnerungen für das Selbstbild eines Menschen haben. Hast du mit den Erinnerungen auch deine Persönlichkeit verloren? Brodbeck blieb abrupt stehen, lachte verlegen, die Frage kannst du ja nicht beantworten, nur ich könnte. Er musterte ihn lange. Gestik, Mimik, Art zu sprechen, genau wie immer, äußerlich habe sich nichts verändert, das mache die Amnesie für seine Familie, auch für ihn, so schwer vorstellbar. Brodbeck sah ihm lange in die Augen, es wurde ihm schrecklich peinlich, sie standen mitten auf dem Trottoir, andere Passanten waren gezwungen, auf die Straße auszuweichen. Dein Blick ist anders, nicht leer, aber irgendwie ausdruckslos, nein, eher verloren.
An der nächsten Straßenkreuzung, sie spazierten langweiligen Vorgärten entlang auf der Kantonsstraße Richtung Stadt, zweigte ein Fußgängerweg ab, der ebenfalls ins Zentrum führte, aber angenehm den Fluss entlang.
Als sie die Autos hinter sich hatten, nahm Brodbeck den Faden wieder auf. Denken wir mal logisch, wenn die Persönlichkeit noch da ist, ist es auch die Identität und mit der Identität auch das Selbstbild.
Er, der Mann ohne Erinnerung, nickte, theoretisch schon, aber er könne beides nicht abrufen, leere Hülle, die Inhalte verschüttet. Er sei am 24. August auf diese Welt gekommen, im Körper und mit dem faktischen Wissen eines Achtundfünfzigjährigen, jetzt besitze er emotionale Lebenserfahrungen und erinnerbare Erlebnisse von der Dauer eines Monats.
Brodbeck schien erst jetzt wirklich zu begreifen, du hast also keine Vorstellung von dir als Person, wie du bist, was du magst, was nicht, was dich freut, dir Angst macht, was du suchst, was du vermeidest, was du liebst, was du hasst?
Wieder nickte er, er erkenne die Handschrift von Marty nicht, wisse nicht, wie er unterschreiben solle, versuchsweise habe er am Anfang mal mit Jean-Pierre Marty eine Unterschrift versucht, sie habe völlig anders ausgesehen als die früheren, die man ihm zeigte. Er esse Pfirsiche, die er gemäß Aussagen der Frau verabscheut habe, gestern Krevetten, auf die er früher allergisch reagiert haben soll, jetzt ohne Wirkung, und so weiter. Also, ist die frühere Persönlichkeit noch da oder nicht? Auch sie nährt sich doch von Erinnerungen. Die bange Frage für ihn sei, ob jetzt die Persönlichkeit, je länger die Erinnerungen abgeschnitten sind, Facette um Facette verloren gehe. Wie die Farbe von einem Bild abblättert, bis nur noch graue Leinwand da ist.
Brodbeck schwieg, was hätte er auch antworten können.
Ob er als bester Freund von Jean-Pierre ihm sagen könne, ob es sich lohne, dessen Leben weiterzuführen.
Brodbeck blieb erneut abrupt stehen, wich gar einen Schritt zur Seite, schaute ihn befremdet an. Er werde sich nicht in sein privates Leben einmischen, und wenn seine Frage darauf abziele, ob seine Ehe glücklich sei, wolle er das nicht beantworten. Warum er nicht Annet frage. Dann schien auch Brodbeck klar zu werden, dass von der Frau kaum eine uneigennützige Antwort auf eine solche Frage zu erwarten war. Gut, er verstehe, was jedoch seine berufliche Zufriedenheit betreffe, da hätte er allerdings einiges zu sagen.
Es sei ein offenes Geheimnis, dass die Arbeit als Lehrer sie beide schon lange nicht mehr befriedige, oft hätten sie diskutiert, ob der Verlust der Motivation eine unvermeidliche Entwicklung sei oder ihre Schuld. Nämlich zu viel enttäuschter Enthusiasmus. Ja, da waren diese vielen Schulreformen in den letzten Jahren, und kein Ende in Sicht, fortschrittsgläubig haben auch wir geglaubt, dass neu immer besser bedeutete. Bis wir erlebten, mehr als einmal übrigens, wie Lehrpläne, in die wir Herzblut und viel Freizeit investiert hatten, durch die nächste Reform einfach über den Haufen geworfen wurden. Es gab gehässige Spannungen in der Lehrerschaft. Junge Kollegen sind gekommen, nicht so dumm wie wir, für die der Lehrerberuf ein Job ist, den sie professionell erledigen. Aber keine Berufung, an der man in der heutigen Zeit ja nur scheitern kann. Wie wir.
Erregt machte Brodbeck ein paar Schritte, kam zurück, setzte ihm den Zeigfinger auf die Brust. Ja, wir beide hatten die größte Lust, den Lehrerberuf hinzuschmeißen. Wir fantasierten verrückte Alternativen, tun, was uns Spaß macht, ein Antiquariat führen, alte Manuskripte aufstöbern, schreiben. Im Träumen sind wir beide gut, im Umsetzen weniger. Zu wenig Mut. Die finanzielle Sicherheit, halt das bequeme Leben. Tja, Feiglinge eben. Brodbeck ließ die Hand sinken, dein Unfall, nein, dein Gedächtnisverlust hat für dich alles weggefegt, dich auf einen Schlag von all dem befreit. Ich beneide dich. Komm nie wieder in die Schule zurück.
Brodbeck brach ab. Es war deutlich.
Der Fußweg endete vor der Holzbrücke und führte über eine lange Treppe zur Straße hoch. Oben angekommen, keuchte er, und was er, Franz, zum Thema Sportlichkeit zu berichten habe.
Der lachte ebenfalls, du bist sogar auf das Wort allergisch.
Beruhigend, offensichtlich ein solider Teil seiner Persönlichkeit, er verspürte nach wie vor keinerlei physischen Betätigungsdrang. Das nächste Stück, es blieben nur noch rund zweihundert Meter bis ins Zentrum, mussten sie wieder der belebten Straße entlanggehen, reger sonntäglicher Ausflugsverkehr herrschte.
Da geschah es. Eine empörte Autohupe heulte von links an ihm vorbei, im letzten Moment wurde er am Rücken zurückgerissen, er verlor das Gleichgewicht. METRO, weiße Schrift auf rot, Réaumur-Sébastopol, ein poetischer Doppelname durch zufällige Kreuzung zweier Boulevards, er mag den Namen, Köpfe hetzen vorbei, viele unter Regenschirmen, die Autos geben nervös Gas, da sie endlich Grün haben, ein Gedränge quillt aus dem Untergrund.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.