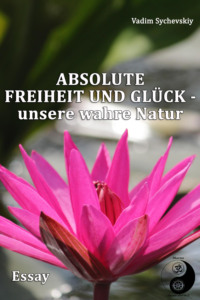Kitabı oku: «Absolute Freiheit und Glück – unsere wahre Natur», sayfa 11
IV. Vollkommenheit der Beharrlichkeit
(Sanskrit: Virya Paramita; Pali: Virya Paramita)
Nachdem wir ein solides Fundament in Form der Paramitas des Opfers, der Gebote und der Geduld gelegt haben, beginnen wir mit der Praxis der Beharrlichkeit. Kurz gesagt; das Bestreben ist die vollständige Umwandlung unseres Lebens als gewöhnlicher Mensch in das Leben eines spirituell Praktizierenden.
Die Sechs Paramitas rufen uns nicht dazu auf, unser weltliches Leben aufzugeben und ein Mönch oder Einsiedler zu werden, aber dennoch sollte sich unser Lebensstil im Laufe unserer spirituellen Praxis deutlich verändern. Der Unterschied zwischen einem Mönch und einem Laien ist die Zeit, die man der Praxis widmet. Ein Laie kann Erleuchtung und Befreiung erlangen, wenn er die Zeit für die Praxis in seinem täglichen Leben allmählich erhöht und in den letzten Stadien in eine intensive Praxis rund um die Uhr eintritt.
1. Anstrengungen in der Praxis
Spirituelle Praxis kann in zwei Arten eingeteilt werden.
Die erste Art ist die Praxis, die wir im täglichen Leben ausüben sollten. Etwa das Studium des Dharmas und die Betrachtung der Phänomene auf seiner Grundlage, das Ausführen tugendhafter Handlungen, das Sammeln von Verdienst, das Einhalten der Gebote und das Üben von Geduld. Mit anderen Worten ist es eine Praxis, die keine besondere Form hat. Es ist eine Praxis, die in unserem Geist ausgeführt wird. Die höchste, formlose Praxis ist perfekte Achtsamkeit im täglichen Leben.
Die zweite Art ist im Gegensatz dazu eine Praxis, die eine konkrete Form hat. Zum Beispiel yogische Asanas, Pranayamas und Mudras. Taoistisches Qigong. Buddhistische Gehübungen (obwohl sie in fast allen Übungssystemen verwendet werden), Mantra-Rezitation. Mit anderen Worten handelt es sich um eine technische Praxis, die in erster Linie darauf abzielt, den physischen Körper zu entwickeln und die Energie anzuheben.
Die Spitze oder das Ergebnis beider Praktiken ist Meditation, deren Essenz die perfekte Konzentration des Bewusstseins ist. Das heißt, nachdem wir eine solide Grundlage in Form von vorbereitenden formlosen Praktiken geschaffen und eine ebenso solide Grundlage durch äußere und innere technische Praktiken gelegt haben, können wir mit der vollwertigen Praxis der Meditation beginnen. Durch diese Praktiken können wir in einen Zustand völliger Gedankenlosigkeit gelangen, indem unsere Energie auf- und absteigt, was der Einstieg in die wahre tiefe Meditation ist.
Meiner Erfahrung nach brauchen wir in der heutigen verschmutzten Welt eine tägliche technische Praxis von mindestens 2 bis 3 Stunden, um einfach nur unsere Energie und unser geistiges Niveau aufrechtzuerhalten. Wenn wir jedoch wirkliche Fortschritte machen wollen, sollte unsere tägliche Praxis, die Techniken und Meditation umfasst, sechs Stunden umfassen. Mit anderen Worten, wenn wir Erleuchtung und Befreiung verwirklichen wollen, müssen wir im Wesentlichen 24 Stunden am Tag praktizieren: sechs Stunden technische Praxis und Meditation; der Rest der Zeit ist formlose Praxis: Dharma-Achtsamkeit, Verdienst, Gebote, Achtsamkeit.
Da wir nicht wie Mönche oder Einsiedler vierundzwanzig Stunden am Tag meditieren können, muss unsere meditative Praxis maximiert werden. Dazu brauchen wir eine konsequente technische Praxis, die der Meditation vorausgeht. Unsere Praxis muss so konzentriert wie möglich sein, damit wir in sechs Stunden die gleichen Ergebnisse erzielen wie in vierundzwanzig Stunden. Mit anderen Worten müssen wir uns doppelt oder sogar dreifach anstrengen.
Wie ist das möglich? Hier kommen die Ergebnisse unserer Praxis der vorangegangenen Paramitas ins Spiel: Unser Bewusstsein ist ruhig, wir haben viele Tugenden und Verdienste, wir haben viel schlechtes Karma „abgestreift“, und wir sammeln kein neues Karma an, weil wir die Gebote strikt einhalten. Der entscheidende Faktor dafür, ob wir in der Praxis wirklich unser Bestes geben können, ist jedoch Geduld. Wenn wir die Vollkommenheit der Geduld erlangen, gewinnen wir eine mächtige „Waffe“, die „Willenskraft“ genannt wird. Dadurch wird unsere Praxis mit verdoppeltem Elan fortgesetzt – dieses „große, kämpferische Streben“, wie Meister Hakuin zu sagen pflegte.
Der erste Aspekt der Paramita der Hartnäckigen Bemühung ist also die Bemühung an sich: eine hundertprozentige Bemühung um die Praxis, basierend auf Dharma-Verständnis und Willenskraft.
2. Vier Rechten Anstrengungen
Die zweite Komponente der Praxis der Hartnäckigen Anstrengung besteht darin, Verdienst zu vermehren und schlechtes Karma abzubauen – mit anderen Worten, rechte Gedanken, Reden und Handlungen zu entwickeln und falsche zu unterdrücken:
Die Praxis zu tun, die jetzt getan werden kann. Zum Beispiel ist ein Praktizierender in der Lage, in diesem Moment materielle Spenden zu machen und Verdienst durch selbstloses Dienen anzuhäufen. Deshalb sollte er diese Praxis fleißig weiterführen.
Er soll sich in der Zukunft bemühen, die Praktiken zu tun, die jetzt nicht getan werden können. Zum Beispiel kann ein Praktizierender den Dharma bis jetzt nicht anderen erklären, weil er die Lehre bislang nicht ausreichend gemeistert hat. Er sollte sich also bemühen, den Dharma zu studieren, damit er die Lehren in der Zukunft frei darlegen kann.
Das Anhäufen von schlechtem Karma zu stoppen, das jetzt gestoppt werden kann. Zum Beispiel kann ein Praktizierender, anstatt sich Unterhaltungsprogramme im Fernsehen oder im Internet anzusehen, diese Zeit der Meditation widmen. Das sollte er also tun.
Er soll sich bemühen, in der Zukunft die Ansammlung von schlechtem Karma zu unterdrücken, die jetzt nicht unterdrückt werden kann. Zum Beispiel kann jemand schlechte Angewohnheiten, wie Rauchen oder die Sucht nach Süßigkeiten, nicht loswerden. Daher sollte diese Person alle Anstrengungen unternehmen, um diese Gewohnheiten in der Zukunft loszuwerden. Im Falle des Tabakrauchens z.B. sollte er spezielle Pranayama- und Reinigungstechniken anwenden.
Abgesehen davon besagt der vierte Punkt, dass Anstrengungen unternommen werden sollten, damit falsche Gedanken, Worte oder Handlungen in Zukunft nicht mehr auftauchen. Zum Beispiel hat der Praktizierende seine eigene Reizbarkeit und Verleumdung unterdrückt. Dann sollte er sich bemühen, die gewonnene Gelassenheit zu fixieren und nicht zuzulassen, dass Reizbarkeit oder Böswilligkeit wieder von ihm Besitz ergreifen.
Auf diese Weise erhöht die Praxis der Vier Rechten Anstrengungen die Menge der Daten (Karma) der hohen Welten in unseren Fünf Ansammlungen und hilft, die Menge der gegenteiligen Daten zu reduzieren.
3. Achtsamkeit und Konzentration
Durch all die oben genannten Praktiken beginnen wir, unser Bewusstsein zu kontrollieren und kommen zuerst zur Achtsamkeit im täglichen Leben und dann zur gerichteten Konzentration oder Fokus in der Meditation. Mit anderen Worten ist die dritte Komponente der Praxis der Beharrlichen Anstrengung das Bemühen, in jedem Moment in einem Zustand der Achtsamkeit zu sein und immer die Kontrolle über das eigene Bewusstsein zu haben:
„Das Bewusstsein regiert die Welt' sagte der Buddha. Ein gut kontrolliertes Bewusstsein ist der nützlichste Freund, aber wenn es unkontrolliert ist und umherwandert, wird es zwangsläufig zum schlimmsten Feind. Ein gut kontrollierter, gezähmter Geist bringt Frieden und Glück.“
(Ehrwürdiger Ananda Maitreya26)
Achtsamkeit und Konzentration sind ruhige, auf ein Objekt gerichtete Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit auf das Objekt wird durch Willenskraft gehalten – wir erlauben unserem Geist nicht, sich vom Objekt unserer Konzentration zu entfernen, noch erlauben wir ihm, sich durch Willenskraft in Bewegung zu setzen.
Achtsamkeit bedeutet, dass man seine Aufmerksamkeit auf einen Prozess oder eine Handlung richtet. Wir gehen z.B. die Straße entlang, fahren Auto, kochen eine Mahlzeit oder putzen das Haus. Es kann sich um einen Arbeitsprozess handeln, wie z. B. den Prozess des Zusammenbaus von etwas. Es kann ein Lernprozess sein, bei dem wir uns eine Abfolge bestimmter Bewegungen einprägen müssen, wie z. B. beim Erlernen des Autofahrens, von Kampfsportarten oder von Computern. Es kann die Kontemplation und Bewusstheit unserer Empfindungen sein, wie beim Üben von yogischen Asanas oder taoistischem Qigong. Mit anderen Worten: Bei Achtsamkeit geht es nicht darum, ein einziges Objekt zu haben, auf das unsere Aufmerksamkeit gerichtet ist. Achtsamkeit ist eine ruhige Aufmerksamkeit, die auf einen Prozess gerichtet ist, bei dem eine Reihe von Objekten miteinander interagieren. Wenn ich zum Beispiel putze, benutze ich einen Staubsauger, wische Staubtücher, rücke Stühle, bringe den Müll raus und so weiter. Das heißt, ich muss meine Aufmerksamkeit konstant von einem Objekt zum anderen lenken und bewusst eine bestimmte Abfolge von Handlungen ausführen.
Konzentration ist dagegen eine ruhige Aufmerksamkeit, die ausschließlich auf ein einziges Objekt gerichtet ist. Normalerweise bezieht sich Konzentration oder zielstrebige Fokussierung auf unsere Meditation und innere Ruhe. Wenn wir unter anderem ein Mantra rezitieren oder uns beim Pranayama auf unseren Atem konzentrieren, gibt es in diesem Moment nichts anderes als das rezitierte Mantra oder den Atem. Unsere Achtsamkeit verschmilzt mit dem Objekt der Konzentration und bleibt stehen.
Achtsamkeit ist also in erster Linie die äußere Welt und das tägliche Leben, und Konzentration ist unsere innere Welt und die Meditation. Wir können also sagen, dass die Achtsamkeit im täglichen Leben die Grundlage für die ausgerichtete Konzentration in der Meditation bildet.
Mit fortschreitender Praxis werden die äußere und die innere Welt für uns eins, und wir erkennen die Fähigkeit, sowohl im täglichen Leben als auch in der Meditation natürlich präsent zu sein.
Die zwei Komponenten von Achtsamkeit und Konzentration
Achtsamkeit und Konzentration unterscheiden sich also in ihrer Form leicht, aber ihr Wesen ist identisch, denn sowohl Achtsamkeit als auch Konzentration haben zwei Komponenten. Und wenn eine davon nicht erfüllt ist, handelt es sich nicht um vollständige und echte Achtsamkeit und/oder Konzentration.
Die erste Komponente ist die Grundlage, ohne sie gibt es keine Achtsamkeit und Konzentration. Sie ist jedem bekannt, leicht zu erklären und zu verstehen, aber ziemlich schwierig zu erfüllen. Die erste Komponente besteht darin, im gegenwärtigen Moment völlig präsent zu sein. Was bedeutet es, präsent zu sein? Im gegenwärtigen Moment präsent zu sein bedeutet, sich zu konzentrieren, sich zu fokussieren, aufmerksam zu sein, sich nicht ablenken zu lassen, durch Willenskraft ganz im Hier und Jetzt präsent zu sein. Tatsächlich ist dies die Definition von Willenskraft selbst, d.h. die Arbeit des Bewusstseins, sich weiter zu konzentrieren, die Arbeit des Bewusstseins, das zu tun, was man im gegenwärtigen Moment tut. Es ist die Fixierung des Bewusstseins auf ein Objekt. Das Bewusstsein bewegt sich nicht weg, weicht nicht von dem Objekt unserer Aufmerksamkeit oder Konzentration ab. Was hindert uns also daran, im gegenwärtigen Moment präsent zu sein und unser Bewusstsein auf das Objekt zu richten? Fremde, bedeutungslose Gedanken, die sich gewöhnlich entweder auf die Vergangenheit oder die Zukunft beziehen. Mit anderen Worten, wir werden abgelenkt, indem wir in Erinnerungen an die Vergangenheit schwelgen oder von der Zukunft träumen. Deshalb spricht man von Präsenz, Achtsamkeit oder der Konzentration auf den gegenwärtigen Moment. Die Anwesenheit oder Abwesenheit von Gedanken über den gegenwärtigen Moment selbst wird weiter unten besprochen.
Die erste Komponente ist also die Praxis der Gelassenheit: Wir müssen unseren Geist beruhigen oder leeren und einen Zustand erreichen, in dem keine fremden Gedanken auftauchen. Wir kontrollieren unser Bewusstsein durch Willenskraft und lenken es vollständig auf das Objekt unserer Aufmerksamkeit oder Konzentration.
Die zweite Komponente von Achtsamkeit und Konzentration ergibt sich aus der ersten. Wir können sagen, dass diese zweite Komponente der wesentliche Aspekt ist, durch den Achtsamkeit und Konzentration realisiert werden. Im Gegensatz zur ersten kann die zweite Komponente nicht intellektuell oder logisch verstanden werden, denn wenn diese zweite Komponente vollständig verwirklicht ist, befindet sich unser Bewusstsein in seinem natürlichen Urzustand. Mit anderen Worten, unser Bewusstsein und damit auch das falsche Selbst werden verschwinden.
Wir konnten uns also auf das Objekt konzentrieren, fremde Gedanken sind verschwunden, und unser Bewusstsein ist klarer. Nun stellt sich die Frage: Was sollen wir mit dem eigentlichen Objekt der Konzentration tun? Wenn wir zum Beispiel ein Mantra rezitieren oder Pranayama durchführen – wie sollten wir mit dem Mantra oder unserem Atem umgehen, was sollten wir denken und sollten wir denken? Andererseits gibt es weniger Gedanken, aber die weltlichen Begierden sind nicht verschwunden – was ist zum Beispiel mit Anhaftung oder Ärger, die in der Meditation auftauchen können?
Die übliche dualistische Denkweise besagt, dass Mantra oder Atem „gute“ Objekte sind, auf die man sich also „konzentrieren“ sollte. Anhaftung oder Ärger hingegen sind „schlechte“ Objekte, auf die man sich nicht „konzentrieren“ sollte, sondern die man negieren sollte. In Wirklichkeit bezieht sich dieses Denken jedoch auf die anfängliche Ebene der Rechten Sichtweise, nicht auf die Meditation. In der richtigen Meditation konzentrieren wir uns gleichermaßen auf den Atem und auf Anhaftungen. Natürlich müssen wir zuerst die Konzentration auf „gute“ Objekte beherrschen und uns dann auf „schlechte“ Objekte konzentrieren, um deren Auswirkungen zu stoppen. Folglich kann das Objekt unserer Konzentration oder der Prozess, den wir verwirklichen, letztlich alles Mögliche sein: „gut und richtig“ kann zum Beispiel das sein, was wir studieren, unsere Praxis, unser Training, unsere Arbeit usw.; und „schlecht und falsch“ zum Beispiel unsere Schwächen, Unzulänglichkeiten, weltliche Wünsche oder unangenehme Gedanken, schmerzhafte Erinnerungen usw.
Wenn man sich jedoch zumindest theoretisch nicht bewusst ist, was der ursprüngliche Bewusstseinszustand ist, wird es an diesem Punkt zwangsläufig zu Verwirrung und Ersetzung von Konzepten kommen. Aber dies ist der wesentliche Teil der Konzentration, ihr wahrer, tiefster Teil, zu dem der Praktizierende kommen muss, und wenn dies nicht geschieht, dann sind die vorherigen Praktiken vom Standpunkt der Erleuchtung aus gesehen nutzlos.
Es gibt nur zwei entgegengesetzte und sich gegenseitig ausschließende Arten oder Prozesse, jegliches Objekt, jegliche Handlung oder jegliches Phänomen wahrzunehmen. Die erste ist die Ergriffenheit vom Objekt, die zweite ist die Konzentration auf das Objekt. Im normalen Leben werden sie jedoch als ein und dasselbe angesehen. Das Problem besteht darin, dass wir die Ergriffenheit und die Konzentration verwechseln, mit anderen Worten, wir werden ergriffen, an das Objekt gebunden, anstatt uns des Objekts unvoreingenommen bewusst zu sein.
Es gibt einen Prozess: Bewegung des Bewusstseins – Wahrnehmung des Objekts – Identifikation mit dem Objekt – Unterscheidung des Objekts auf der Grundlage früherer Erfahrungen und Informationen – Entstehen von Verlangen oder Unwillen für das Objekt – Leiden27.
Es gibt jedoch noch einen anderen Prozess, oder vielmehr dessen Abwesenheit. Das Bewusstsein wird angehalten und bleibt in seinem ursprünglichen Zustand der Ruhe und Kontemplation. Es erscheint ein Objekt, das wir wahrnehmen. Es ist jedoch eine Wahrnehmung ohne Wahrnehmung. Unser Bewusstsein kommt nicht in Bewegung, und so folgen wir nicht dem Prozess des Ergreifens. Infolgedessen hat das Objekt keine Wirkung auf uns.
Wenn wir diesen Zustand des vollständigen Aufhörens des Denkens noch nicht erfahren haben, nutzen wir die Konzentration auf ein „gutes“ Objekt, um diesen Zustand zu erfahren. Durch Willenskraft erlauben wir unserem Bewusstsein nicht, sich auf das Objekt zuzubewegen, vom Objekt ergriffen zu werden, den Pfad der Unterscheidung und das Aufkommen von Wünschen zu betreten. Das „Objekt“ ist das Objekt unserer Konzentration oder unseres Gewahrseins. Wir versuchen, den Prozess der gewöhnlichen Wahrnehmung und Unterscheidung durch ruhige Kontemplation ohne Anhaftung zu ersetzen. Wir können sagen, dass wir an diesem Punkt den ursprünglichen Zustand unseres Gewahrseins imitieren.
Wenn wir ein vollständiges Aufhören des Denkens auf der Ebene des Oberflächenbewusstseins erfahren, wird der Ort, an dem der Prozess des Unterscheidens und Ergreifens stattfand, durch den Zustand ersetzt, der schon immer da war – den Zustand der natürlichen Präsenz, des kontemplativen Friedens oder der Ruhe und Kontemplation. Wenn dies verwirklicht ist, werden wir in der Lage sein, unsere Schwächen und weltlichen Begierden (d.h. die „schlechten“ Objekte) von Angesicht zu Angesicht zu konfrontieren und sie durch Konzentration und Kontemplation in weiterer Meditation zu beenden.
Die zweite Komponente von Achtsamkeit und Konzentration ist also die Nicht-Anhaftung. Zunächst richten wir unser Bewusstsein auf das Objekt unserer Konzentration und lassen nicht zu, dass es durch Gedanken an die Vergangenheit oder Zukunft abgelenkt wird. Dann erlauben wir dem Bewusstsein nicht, sich zu bewegen: sich auf das Objekt zuzubewegen, das Objekt der Konzentration selbst zu unterscheiden oder zu interpretieren, sich mitreißen zu lassen, von dem Objekt oder Prozess, auf den unsere ruhige Aufmerksamkeit gerichtet ist, absorbiert zu werden. Deshalb nennt man Konzentration auch ruhige, auf ein Objekt gerichtete Aufmerksamkeit. Die Kontrolle des Bewusstseins wird von uns auf Kosten der Willenskraft ausgeübt. Willenskraft wird durch Geduld und Beharrlichkeit entwickelt.