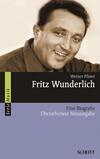Kitabı oku: «Fritz Wunderlich», sayfa 6
Zu Fritz Neumeyer fand Wunderlich bald einen besonders herzlichen Kontakt. Er war fasziniert von Neumeyers gesanglichem Instinkt und seiner Phrasierungskunst, die Neumeyer ganz vom Gesanglichen her entwickelte. Als Dozent für historische Tasteninstrumente riet er seinen Studenten immer wieder, sie sollten auf ihrem Instrument singen. Die Artikulation der Phrasen müsse sängerisch sein. Das war damals, als man Cembalospiel meistens noch mit der starren Mechanik einer klappernden Nähmaschine assoziierte, etwas ganz Neues. Und Neumeyer setzte alles dran, seine Studenten von dieser starren, leblosen Spielmotorik wegzubringen. Er war übrigens ein humorvoller Lehrer, stets zu einem Witz aufgelegt. Schüttelreime waren seine eigentliche Spezialität, und jeder, der sie nur einmal gehört hatte, behielt sie im Gedächtnis. Zweizeiler zum Beispiel, oft auf seine Kollegen gemünzt. Aber auch anspruchsvolle Vierzeiler gab Neumeyer zum besten – etwa bei einem gemeinsamen Bier das Thema »Gaststätte« in einer besonders intrikaten Variation aufnehmend:
Die Frau sich aus dem Felle hüllt,
Während der Ober schon Helle füllt.
Ob aber auch die Fülle hält,
Wenn einmal die Hülle fällt?
In jenen Monaten wurde Fritz Wunderlich auch für eine ganz andere Sparte von Musik entdeckt. Willi Stech, der Leiter des Kleinen Rundfunkorchesters des Südwestfunks mit Sitz im Landesstudio Freiburg, wollte Aufnahmen mit Fritz machen: Schnulzen, Operettenlieder, Walzermelodien – U-Musik nach heutiger Klassifizierung. Mehrere Male schon hatte Wunderlich im Freiburger Landesstudio vor dem Mikrofon gesungen, allerdings ernste Musik, Motetten etwa von Heinrich Schütz oder Solomadrigale von Claudio Monteverdi. Das waren jeweils Beiträge für Schulfunksendungen, die Reinhold Hammerstein, der Freiburger Professor für Musikgeschichte und Formenkunde, für den Südwestfunk produzierte. Stets nahm er die besten Studenten der Hochschulgesangsklassen mit: Katharina von Mikulicz und Andrea von Ramm, Wunderlich und Hackbarth. »Das war für uns sehr wichtig, denn man verdiente recht schön Geld«, erinnerte sich Katharina von Mikulicz. »Zwanzig Mark kriegte man pro Auftritt. Das Geld mußte man sich Ende des Monats stets persönlich im Studio abholen. Auf dem Weg dahin war eine Metzgerei. Und auf dem Rückweg gingen Fritz und ich oft beim Metzger vorbei und legten unser Geld in Würste an . . . «58
Nach diesen Madrigalen und Motetten sollte Wunderlich nun plötzlich U-Musik singen, begleitet von rund einem Dutzend Berufsmusiker. Bisher hatte er Unterhaltungsmusik in erster Linie unter dem Zwang des Geldverdienens gemacht: Tingeleien und Tanzmusik, vor allem übers Wochenende. Nun wurde daraus plötzlich Ernst: Am 8. Dezember 1953 wurde er für eine erste Aufnahmesitzung ins Aufnahmestudio geladen. »Fritz hatte damals kaum etwas Rechtes zum Anziehen«, erzählte Hackbarth. »Ganz aufgeregt kam er zu mir und sagte: ›Du, gib mir doch mal deine Kordjacke!‹ Auch passende Strümpfe hat er sich bei mir geliehen. Und dann ging er stolz ins Landesstudio.«59 Die ersten Titel, die er dort aufnahm: »Veilchen, Liebe, Frühling und Du« von Emil Kaiser, und »Mädele« von Walter Jäger.60 Offenbar hat diese Stimme, als sie über den Äther ging, Eindruck gemacht. Bereits einen Monat später stand Wunderlich schon wieder vor dem Mikrofon – diesmal aber nicht mehr im kleinen Freiburger Landesstudio, sondern in der SWF-Zweigstelle Kaiserslautern, und hier wurde er vom Großen Unterhaltungsorchester unter der Leitung von Emmerich Smola begleitet. Mehrere Aufnahmesitzungen waren anberaumt und auf zwei Tage verteilt worden. Robert-Stolz-Titel standen diesmal auf dem Programm: »Erst hab’ ich ihr Komplimente gemacht« aus der Operette Venus in Seide sowie »Einmal hat mir zur Frühlingszeit das Glück gelacht« aus der Operette Prinzessin Ti-Ti-Pa. Am folgenden Tag kam die Sopranistin Ilse Hübner hinzu; gemeinsam nahmen sie die Duette »Zum ersten Mal allein« und »Mädi, mein kleines Mädi« aus der Stolz-Operette Mädi auf.61 »Er war schon ein toller Musikant, dieser Fritz«, erinnerte sich Emmerich Smola an diese Aufnahmesitzungen. »Er verstand es, selbst aus der kleinsten Sache noch etwas zu machen. Sein Stilgefühl war untrüglich, und es war für ihn die natürlichste Sache der Welt, auch der leichten Muse jenen Stellenwert zuzumessen, den sie für ein breites Publikum eben hat. Für ihn bedeuteten diese Aufnahmen eine große Aufgabe und einen Mordsspaß zugleich.«62
Auffällt bei diesen Aufnahmen der perfekte Sitz von Wunderlichs Stimme, die in diesen frühen Jahren noch auffallend hell timbriert, aber in allen Lagen ebenmäßig durchgebildet ist. Und jedes Wort, das er singt, ist verständlich: Die typische Wunderlich-Diktion ist hier schon perfekt ausgebildet. Sein Stilgefühl zeigt sich vor allem im Maßhalten – keine Übertreibungen, keine Seichtheiten und kein Schmalz, dafür aber Charme. In rein vokaler Hinsicht hält sich Wunderlich auffallend zurück. Streckenweise tönt das fast wie ein frequenzbeschnittener Richard Tauber. Was aber ausnahmslos zu fesseln vermag: Wunderlich gestaltet jede Phrase souverän, er kennt seine Stimme und deren vorläufige Grenzen offenbar sehr genau. Er kommt ohne Druck auf die Stimme aus und ohne einen einzigen Drücker; kein angestrengter, kein verquälter Ton. Wie hat es Katharina von Mikulicz formuliert? »Wenn wir andern uns total verausgabt hatten, dann merkten wir: Der Fritz hat das gleichsam nur von der Oberfläche genommen, hatte stets noch viele Reserven.« Darauf ließ sich eine Zukunft bauen.
Neue Aufgaben warteten an der Hochschule. Ein Semester lang besuchten Wunderlich und Hackbarth den Italienischunterricht, der für Gesangsstudenten als Nebenfach erteilt wurde und also an den Rand des Stundenplans gedrückt war – nämlich einmal die Woche frühmorgens von halb acht bis neun. »Da lagen wir uns jeweils gegenüber in unseren Betten«, erzählte Hackbarth, »hatten den Wecker gestellt auf halb sieben. Er schellte pflichtgetreu, und wir schauten uns verschlafen an. ›Gehen wir?‹ ›Gehen wir nicht!‹ Und jeder zog sich seine Decke wieder über den Kopf.« Manchmal konnte Fritz noch hinzufügen: »Weißt du, Hackbraten, das einzig Anständige an mir bist du!«63
Fragte man Fritz, ob er mitgehe, es sei da ein interessantes Konzert in Freiburg, so konnte er sagen: Nein, er gehe nur noch in seine eigenen Konzerte. Überheblichkeit oder Selbstschutz eines Vielbeschäftigten? Gleich in zwei großen Chorwerken sollte er demnächst zum ersten Mal auftreten: am Palmsonntag in der Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach, und zwar in einer von Hermann Meinhard Poppen geleiteten Aufführung in der Lutherkirche zu Worms, und am Karfreitag in der Matthäus-Passion in der Michaeliskirche in Hof. In Worms erwartete ihn ein besonders anspruchsvolles Pensum: Er sollte nicht nur die Partie des Evangelisten singen, sondern zusätzlich auch noch die Tenorarien. Sicher eine der größten Anforderungen, die es für einen Konzertsänger überhaupt gibt, zumal das Nebeneinander von rezitativischem Erzählbericht des Evangelisten und den weitausladenden Arien ein besonders breites Ausdrucksspektrum erfordert.
Das Engagement in Hof hatte ihm übrigens Klaus Hertel vermittelt – der Tenorist im Freiburger Bachchor, der ihn im vergangenen Dezember eben erst im Weihnachts-Oratorium erlebt hatte. »In einem kurzen, zerschlissenen Mäntelchen und mit einem Pappkoffer unter dem Arm kam Wunderlich am Bahnhof Hof an. Mein Freund, der Dirigent Hans Gebhard, holte ihn persönlich ab – und war entsetzt: ›Um Gottes willen, wen hat mir Hertel da nur als Evangelisten aufgeschwatzt!‹ In seiner Verwirrung fuhr er mit Fritz gar nicht erst ins Hotel, sondern direkt in die St. Michaeliskirche. Hier mußte Fritz probeweise erst einmal einige Töne von sich geben, um den Dirigenten zu beruhigen: daß er in der Tat singen könne.« Hertel übernahm in der Aufführung ebenfalls eine kleine Solopartie. »Bei dieser Gelegenheit hörte mich Fritz zum ersten Mal – wir hatten bis dahin ja noch keinen persönlichen Kontakt gehabt –, und er sagte sofort zu mir: ›Du mußt unbedingt Stunden nehmen. Und zwar bei meiner Lehrerin.‹ So kam ich als junger Referendar an die Freiburger Musikhochschule, und zwar in die Meisterklasse von Margarethe von Winterfeldt. Da war nicht nur Fritz drin, sondern auch meine spätere Frau: Katharina von Mikulicz.« Schnell wurde Hertel in die Gemeinschaft aufgenommen, absolvierte mit Fritz und seinen Kommilitonen unzählige Skatrunden in der »Villa Heuboden«. Übrigens war Fritz ein herrlicher Gastgeber, ein leidenschaftlicher Koch. Er hatte sich aus Brettern ein kleines Regal zusammengebastelt. Zuunterst war Platz für Schuhe, in der Mitte wurden ein paar Kochtöpfe verstaut, und oben stand sein kleiner Kocher. Da konnte er einen ganzen Abend lang brutzeln und braten. War Hertel mit dabei, so fragte Fritz unweigerlich nach den neuesten Gerichtsfällen, denn Hertel mußte als Referendar oft für die Staatsanwaltschaft vor Gericht plädieren. »Und dann kam jeweils die ganze Horde in den Verhandlungssaal, angeführt von Fritz; alle haben sie meinen Plädoyers zugehört und ihre Witze gemacht. Ich mußte den Amtsrichter vorher jeweils warnen.«64
»Jugendfrischer Mozart« – unter diesem Titel berichtete die Freiburger Zeitung, und zwar in leidenschaftlich begeisterten Worten, über eine recht außergewöhnliche Opernaufführung. Seit Monaten nämlich war man an der Freiburger Musikhochschule mit der Einstudierung von Mozarts Zauberflöte beschäftigt. Chor und Orchester wurden ausschließlich aus Hochschulstudenten rekrutiert, und die Leiter der beiden Gesangsmeisterklassen, Margarethe von Winterfeldt und Fritz Harlan, wählten unter ihren Studierenden die begabtesten aus für die anspruchsvollen Solopartien. Reinhard Lehmann, Intendant der Freiburger Städtischen Bühnen, übernahm die szenische Betreuung und führte die Gesangsstudenten in die Geheimnisse des Rollenspiels ein. Denn Bühnenerfahrung hatte keiner der Studenten, dramatischen Unterricht oder gar eine veritable Opernschule gab es in Freiburg nicht. Lehmann mußte sich in seiner Arbeit also weitgehend auf ein szenisches Arrangement beschränken, Auftritte und Abgänge einüben, Standorte festlegen, Gesten einstudieren. Fritz sang den Tamino, Katharina von Mikulicz war seine Pamina, Wolfgang Anheisser, damals ein junger Tenor aus der Meisterklasse Fritz Harlans, sang den Ersten Geharnischten, und Hackbarth profilierte sich als Sprecher und Zweiter Geharnischter. »Was haben wir gelacht während der Proben! Wenn ich mit Fritz auftauchte, sagte Lehmann stets: ›So, jetzt kommen die beiden Spaßmacher.‹«65 Die Proben fanden in einem Nebengebäude der Hochschule in der Schusterstraße statt, aufgeführt wurde die Zauberflöte im Paulussaal.
»Die Proben mit Fritz waren herrlich«, bestätigte Katharina von Mikulicz. »Überhaupt war er in diesen Wochen sehr feinfühlend, merkte sofort, wenn ich irgendwelche Probleme hatte. Einmal lud er mich sogar zu sich nach Hause ein; er spürte, daß ich mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, und wollte mich trösten. Er kochte für mich und steckte mich vorsorglich sogar in sein Bett.« In der Zauberflöte kommt bekanntlich ja alles zu einem guten Ende; Tamino gewinnt seine Pamina, nachdem die beiden zuvor etliche Prüfungen bestehen mußten. »Nun, wir beide hatten damals auch so einen Abend, wo wir uns über einiges in dieser Richtung aussprachen. Wir waren uns aber bald im klaren, daß zwischen Bühne und Leben ein Unterschied besteht, daß mit uns beiden also nie etwas werden wird. ›Leider, schade‹, sagte Fritz damals. Und dennoch blieb er, was er bis dahin war: ein durch und durch guter Kerl.«66
Am 21. Juli 1954, abends um acht Uhr fand die erste Aufführung statt. Lampenfieber, ein Nervenkrieg, Ängste unter den Sängern, wohin man nur schaute. Fritz hat seiner »lieben, guten Mutter« in einem ausführlichen Brief davon berichtet:67
Vor der Aufführung befand ich mich in einem Zustande völligen Betäubtseins. Als dann die Ouvertüre vorbei war und ich auf die Bühne sprang, um das Stück zu eröffnen, da wußte ich, daß diese Aufführung über mein ganzes Leben entscheiden würde . . . Als ich dann gleich am Anfang die Bildnis-Arie sang, hatte ich plötzlich alle Energie wieder; ich sah die 2000 Zuschauer nicht mehr, ich wußte nur noch, wenn Du Dich jetzt nicht fangen kannst, dann ist alles aus. Und als ich den letzten Ton gesungen hatte, dachte ich: Gott im Himmel, laß sie klatschen! Und als dann brausend der Applaus an mein Ohr drang, begeisterter Beifall von 2000 Hörern, da brach ich fast zusammen vor Freude. Ich wußte, ich hatte gesiegt. Und im Folgenden sang ich, getragen von dem Gefühl dieses Kontakts zum Publikum, wie noch nie in meinem Leben…
Als ich nach Schluß der Aufführung allein auf die Bühne kam, wurde der Applaus zum Orkan, mir wurden Blumen auf die Bühne geworfen, ich stand wie belämmert und wußte nicht, wie mir geschah. Ich konnte es nicht fassen, daß ich beim Freiburger Theater-Publikum so schnell anerkannt würde. Ich habe mit diesem Erfolg endgültig das Tor zu meinem über alles geliebten Beruf aufgestoßen! Alle Entbehrungen und alle Sorgen finden jetzt ihren Lohn. Immer wieder mußte ich auf die Bühne . . . Ich bin in tiefster Seele glücklich und auch ein bißchen stolz.

Und auch ein bißchen stolz . . . Fritz hatte dazu reichlich Anlaß, was ihm tags darauf von der Kritik bestätigt wurde: »Nun, da die erste Aufführung vorüber ist, muß man sagen: Es ist geglückt, sogar über alle Erwartungen hinaus geglückt… In erster Linie ist hier der Tamino Fritz Wunderlich zu nennen, ein Tenor von einer seltenen Weichheit und einem bestrickenden Timbre, geführt mit Geschmack und sicherer Musikalität, eine Stimme, die ohne Zweifel Zukunft besitzt.«68
Nach all dem ausgestandenen Lampenfieber und den Nervenkriegen rund um die Zauberflöte beschloß Wunderlich mit einigen Kollegen, seiner Gesangslehrerin zum Geburtstag nun noch eine »eigene« Version der Zauberflöte zu schenken. Und zwar eine Jux-Zauberflöte. In Zusammenarbeit mit Hertel und Hackbarth wurde Emanuel Schikaneders Operntext durch einen neuen ersetzt, der so ziemlich alles Ernsthaft-Erhabene durch den sprichwörtlichen Kakao zog. Noch in derselben Nacht wurde dieses neue Zauberflöten-Produkt aufgenommen, und zwar mit Wunderlichs brandneuem Grundig-Tonbandgerät. Dabei konnten sie auf frühere Erfahrungen zurückgreifen: Vor einiger Zeit hatten sie schon ein Hörspiel, »Mörder an Bord«, improvisiert – mit Morsezeichen, Schiffshupen, Wellenrauschen und verfremdeten Akkordeonklängen. Sogar im Hausflur hatten sie damals Aufnahmen gemacht, wegen des gespenstischen Halls. Diesmal ging es nicht weniger professionell zu. Hackbarth spielte die Juxoper am Klavier, Hertel und Wunderlich sangen die diversen Solopartien. Und während der Wasserprobe Taminos und Paminas ließ Wunderlich Wasser in die Badewanne plätschern, um diese Probe möglichst naturgetreu hinzukriegen Eine halbe Nacht arbeiteten sie wie besessen an dieser Zauberflöte und spielten das Band dann ihrer Gesangslehrerin zum Geburtstag vor. Es soll eine Mordsgaudi gewesen sein.
Wenige Wochen später wurde Wunderlich erneut eine große Zukunft prophezeit – diesmal in Triberg, wo die Freiburger Musikhochschule mit einer Zauberflöten-Aufführung gastierte. »Von den Sängern darf wohl dem Tamino des Fritz Wunderlich mit Recht der erste Platz eingeräumt werden. Hier ist an allerbestem Material schon sehr viel gebildet worden. Sein strahlend schöner Tenor von fast italienischer Klangfärbung sitzt fest in allen Tönen, kommt in allen Lagen klar zum Klingen und beherrscht das Belcanto in einer Weise, die eine erfreuliche Zukunft verspricht.« Besonders erfreulich sah diese Zukunft vorerst aber nicht aus. Im Gegenteil: In gewisser Hinsicht war Fritz sogar enttäuscht. Seine Pamina, Katharina von Mikulicz, war aufgrund ihres Erfolgs in der Freiburger Zauberflöten-Aufführung als erste lyrische Sopranistin an die Freiburger Städtischen Bühnen engagiert worden. Und zwar schon für die kommende Saison. Mit Wunderlich schien die Intendanz zwar auch einiges vorzuhaben, doch zu einer verbindlichen Anfrage kam es vorerst nicht. Obwohl sich vor längerer Zeit schon sein Hornlehrer Lothar Leonards diesbezüglich für ihn eingesetzt hatte: »Ich habe gesehen, daß es ihm damals wirtschaftlich nicht gut ging, und so bin ich zum Generalmusikdirektor gegangen und habe gesagt: ›Ich hab’ da einen jungen Mann; ich glaube, der kann singen. Hören Sie sich den einmal an.‹ Wunderlich ging dann zum Theater und sang dort vor. Man hielt zwar sehr viel von seinem Gesang, hatte aber kein Geld, um ihn zu engagieren . . . Es dauerte eine Weile, da war eine Erkrankung im Personal, und er wurde eingesetzt in einer Operette: in Millöckers Bettelstudent.«69 Ein Engagement aber stand nach wie vor nicht zur Diskussion.
Auch sonst stand es mit Wunderlichs Aussichten nicht gerade gut. Erst kürzlich hatte es Ärger gegeben, weil er wiederholt mit Willi Stech im Freiburger Landesstudio Schnulzenaufnahmen gemacht hatte. Einige Hochschulprofessoren waren offensichtlich der Ansicht, daß solche Aktivitäten seiner Stimme nicht bekommen würden und, was weit schlimmer wog, seinem Ruf als »ernsthafter Künstler« – und auch dem hervorragenden Renommee der Freiburger Musikhochschule – schaden könnten. Man denke sich: ein Gesangsstudent, und erst noch der begabteste, erfolgreichste unter allen, der, statt seine Berufung zum seriösen Künstler wirklich ernst zu nehmen, in die Unterhaltungsbranche abdriftet und Schnulzen singt. »Das hat Ärger gegeben damals. Und zwar nicht nur für Fritz. Einer von seinen Studienkollegen, der als Geiger ab und zu ebenfalls Aufnahmen machte bei Stech, wurde gar von der Hochschule gewiesen. Auch Fritz war von dieser Sache betroffen. Zumal sich auch Theodor Egel einmischte und ihn vor ein Ultimatum stellte: ›Entweder du singst draußen beim Stech – oder bei mir.‹«70 Das ließ sich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Egel war ein einflußreicher Musiker, er beherrschte die Freiburger Musikszene und pflegte weitreichende Kontakte bis hin zu den renommierten Bachwochen in Ansbach. Mit ihm zu musizieren war wichtig: für junge Sänger ein eigentliches Sprungbrett.
Nun, Fritz sang weiterhin für Willi Stech: Am 14. September nahm er »Nacht überm See« von Hans Anders auf. Und er sang weiterhin unter Theodor Egel: ein Konzert mit Bach-Kantaten »am Vorabend des 27. November«, wie es speziell auf dem Programmblatt vermerkt steht. Zehn Jahre war es her, seit Freiburg – am 27. November 1944 – durch Luftangriffe der Alliierten weitgehend zerstört worden war. Ein Gedenkkonzert also, für das Freiburger Publikum von ganz besonderer Bedeutung. Drei der schönsten Bach-Kantaten hatte Egel aufs Programm gesetzt: »Komm, du süße Todesstunde«, anschließend die berühmte »Kreuzstabkantate« und, zum feierlichen Abschluß, »Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit«. Neben Wunderlich sangen Marga Höffgen sowie der Bassist Franz Kelch, als Instrumentalsolisten im Orchester hörte man den Oboisten Lothar Koch, den Gambenspezialisten August Wenzinger sowie Fritz Neumeyer am Cembalo. Wunderlich scheint sich ernsthaft, ganz ohne vordergründige Stimmprotzerei, in den Dienst dieser musikalischen Feierstunde gestellt zu haben – was ihm von der Badischen Zeitung prompt einen Vorwurf einbrachte: »Der Tenor hätte getrost viel mehr von seinem erst kürzlich wieder bewiesenen italienischen Opernschmalz in die Kirche hinüberretten dürfen.«71
Opernschmalz in der Kirche? Belcantodemonstrationen bei geistlicher Musik? Ein Dilemma, aus dem der Konzertsänger Wunderlich fortan kaum mehr herausfinden sollte. Hielt er als Oratoriensänger nämlich mit dem Opernschmalz, mit der spezifischen Sinnlichkeit seiner Stimme bewußt zurück, so konnte er sicher sein, daß es tags darauf zumindest in einer Kritik hieß, er habe sich ungebührlich zurückgehalten, er habe sich geschont, habe fahl und ohne Stimmglanz gesungen, kurz: er hätte mehr geben dürfen. Und gab er dann wirklich mehr, sang er in den Passionen und Messen mit vollendetem belcantistischem Schmelz, so hagelte es unweigerlich entsprechende Verdikte: Es gehe ihm das Stilgefühl für geistliche Musik ab, er habe nur vokale Selbstinszenierung betrieben, statt der Musik zu dienen, er habe sich ungebührlich in den Vordergrund gesungen, habe die Kirche oder das Konzertpodium fatalerweise mit der Opernbühne verwechselt. Wie gesagt: ein Dilemma, aus dem kein Weg hinausführte, das sich im Gegenteil noch verschärfte, als zum Opern- und Konzertsänger Wunderlich noch der Liederinterpret hinzukam.
Tags darauf fuhr Wunderlich mit Katharina von Mikulicz nach Kusel. Der Musikverein rüstete zu einem Festkonzert anläßlich seines 65jährigen Bestehens und hatte seinen berühmten Musensohn als Solisten eingeladen. Auf dem Programm standen zwei Arien und ein Duett aus Mozarts Oper Die Entführung aus dem Serail; nach der Konzertpause spielte der Musikverein mit immerhin einem halben hundert Orchestermitgliedern Schuberts Unvollendete. Anschließend wurde das stolze Jubiläum mit einem festlichen Ball gefeiert. Knapp zwei Monate später, am 16. Januar 1955, absolvierte Wunderlich sein erstes Auslandsgastspiel. Weit über die Grenze Deutschlands hinaus ging die Reise allerdings nicht, sondern nur auf die andere Seite des Rheins hinüber, nach Colmar, 50 Kilometer von Freiburg entfernt. Für ein »Grand Concert« wurde er erwartet; auf dem Programm stand der erste Teil des Oratoriums Der Messias von Georg Friedrich Händel. Der Dirigent Rolf Ummenhofer war zuvor wiederholt nach Freiburg gekommen, um mit Fritz zu proben: »Wunderlich war durch Aufführungen an der Musikhochschule bekannt geworden, als Sänger mit einer besonders schönen Stimme. Um zu proben, suchte ich ihn gelegentlich in seinem Zimmer in der Tellstraße auf. Er pflegte lange zu schlafen, war aber nie unfreundlich oder gar mürrisch, wenn ich ihn weckte. Es war erstaunlich, wie schnell er lernte oder Anregungen aufnahm. Mir war bald einmal klar, daß ich es mit einem außergewöhnlichen Sänger zu tun hatte: probebereit, mit einer herrlichen Stimme und schneller Auffassungsgabe.«72
Am 27. März sang Wunderlich erneut Bachs Matthäus-Passion – wiederum in der Lutherkirche zu Worms, mit dem Bachverein Heidelberg unter der Leitung von Hermann Meinrad Poppen. »Den Part des Evangelisten sowie die anfallenden Tenor-Rezitative und Arien gestaltete Fritz Wunderlich«, las man später in der Allgemeinen Zeitung. »Diese Partien stellen an den Solisten ja ganz besonders hohe Anforderungen … Fritz Wunderlich, begabt mit einem lyrisch temperierten Stimmorgan, löste diese Aufgabe in imponierender Weise. Besonders auffallend war die Vielseitigkeit seiner Ausdrucksgebung.«73 Ein schönes Lob. Ob Wunderlich damals schon ahnte, wie stark er einst mit diesem Werk verwachsen würde? Zwei Wochen später, am Karfreitag, sang er in Schweinfurt Bachs Johannes-Passion, auch hier die Partie des Evangelisten sowie die Tenorarien. Wiederum erntete er ungeschmälertes Lob: »Von den Solisten verdient Fritz Wunderlich, der den technisch recht heiklen Evangelistenpart und die Tenorarien gestaltete, die höchste Anerkennung. Er führte seinen sehr durchgebildeten, beweglichen und wohlklingenden Tenor mit müheloser, heller Höhe und mit eindrucksvoller Leichtigkeit.«74 Am 11. Juni gab es für Wunderlich gar eine Premiere: In der Freiburger Stadthalle sang er unter der Leitung von Rolf Ummenhofer zum ersten Mal die Partie des Lukas in Joseph Haydns Oratorium Die Jahreszeiten.
Höhepunkt und zugleich auch Abschluß dieser Saison: die Oper Orfeo von Claudio Monteverdi. Die traditionellen »Sommerlichen Musiktage« des Zonengrenzstädtchens Hitzacker an der Elbe feierten ihr zehnjähriges Bestehen mit einem denkwürdigen Ereignis und Wagnis zugleich. Monteverdis musikhistorisch einst revolutionäre »Favola in musica« sollte, beinahe 350 Jahre nach ihrer Uraufführung in Mantua, wieder möglichst originalgetreu dargeboten werden. August Wenzinger hatte die Partitur Monteverdis nach den Quellen erstmals in einer kritischen Edition für den Bärenreiter-Verlag bearbeitet. Das Originalinstrumentarium mit Blockflöten, Zinken und verschiedenen Posaunen, mit Streichern von den Violini piccoli bis zur Kontrabaßgambe, mit Harfe, Chitarronen und Theorben konnte zum Teil unter Mithilfe des Funkhauses Köln beschafft werden, mußte aber auch speziell für diese Produktion nachgebaut werden. Zwei Aufführungen fanden im Rahmen der to. Sommerlichen Musiktage Hitzacker statt, am 23. und 24. Juli. Unter den Sängern:
Orfeo
Helmut Krebs
Euridice
Elisabeth Schmidt
Musica / Proserpina
Margot Guilleaume
Speranza / Messagera
Ulrike Taube
Pluto
Horst Günter
Caron
Peter Roth-Ehrang
Apollo / Pastore / Spirito
Fritz Wunderlich
Pastore / Spirito
Peter Offermanns
August Wenzinger dirigierte die Aufführungen. Im Orchester saßen einige Freiburger Hochschulprofessoren: Gustav Scheck (Blockflöte), Ulrich Grehling (Violine) und Fritz Neumeyer (Cembalo) – schönster Beweis, daß Fritz Wunderlich kein Student mehr, sondern ein professioneller Sänger und gleichwertiger Kollege geworden war. Im Beethovensaal in Hannover wurde die Oper anschließend von der »Archiv-Produktion« der Deutschen Grammophon Gesellschaft aufgenommen: die erste Einspielung einer Oper Monteverdis mit Originalinstrumenten und in authentischer Aufführungspraxis. Und Wunderlichs erste Schallplattenaufnahme. Sie beeindruckt auch heute noch, nach 35 Jahren.
Höhepunkt und zugleich auch Abschluß dieser Saison, wie gesagt. Und mehr noch: nämlich der Abschluß von Wunderlichs Studienzeit. »Fritz Wunderlich, der an der Musikhochschule in der Meisterklasse von Frau Professor Margarethe von Winterfeldt studiert, wurde von der Leitung der Württembergischen Staatstheater Stuttgart für drei Jahre als lyrischer Tenor verpflichtet«, hatte die Badische Zeitung schon am 4. April 1955 gemeldet. Und dabei leicht untertrieben: Einen Fünfjahresvertrag hatte man Wunderlich angeboten. Wie war es dazu gekommen? »Eines Tages berichtete man mir von einem jungen Mann aus der Pfalz«, erzählte Ferdinand Leitner, damals Generalmusikdirektor an der Württembergischen Staatsoper. »Ein junger Mann, der übers Wochenende Tanzmusik macht, Jazz singt und Trompete bläst. Das scheine eine besonders schöne Stimme zu sein, wurde mir versichert. Also sagte ich zu unserem Regisseur: ›Hören Sie sich den doch mal an.‹ Und er kam zurück und sagte mir: ›Wunderschön.‹«75 Noch ein anderer hatte Wunderlich gehört: der Theateragent Felix Ballhausen. Und zwar an der Freiburger Oper, als Fritz in einer Bettelstudent-Aufführung eingesprungen war. Ballhausen empfahl ihn darauf nach Stuttgart. »So kam Wunderlich – ich sehe ihn noch genau vor mir – zum Vorsingen. Ganz langsam kam er auf die große Stuttgarter Bühne. Wahrscheinlich hatte er noch nie eine so große Bühne gesehen. Und dann sang er. Für alle, die anwesend waren, war eines sofort klar: Das war eine ganz außergewöhnliche Stimme, wenn auch noch mit sehr vielen Einschränkungen. Zum Beispiel kiekste er: Jedesmal, wenn es höher als f ging, dann kiekste er. Und er kiekste so oft, bis er zu weinen anfing, bekam dann einen Schrecken und wollte abgehen. Ich hatte mich längst mit dem Intendanten abgesprochen und sagte zu Wunderlich: ›Kommen Sie doch in mein Büro.‹ Dort begann ich: ›Also, Herr Wunderlich…‹ Aber er fiel mir sofort ins Wort und sagte: ›Das eben war gar nichts!‹ Ich aber mahnte ihn zur Ruhe: ›Jetzt passen Sie mal auf! Sie mögen schon recht haben. Dennoch: Ich gebe Ihnen einen Fünfjahresvertrag.‹ Und da sagte er völlig entgeistert: ›So was können nur Wahnsinnige tun.‹ ›Na ja‹, gab ich zur Antwort, ›lassen Sie uns wahnsinnig sein. Sie kriegen vorerst auch nur einen kleinen Vertrag, und Sie müssen genau tun, was wir Ihnen sagen.‹«76
Wenige Wochen zuvor hatte Wunderlich auch von der Freiburger Oper ein Angebot bekommen. »Eigentlich war Fritz Feuer und Flamme gewesen für dieses Angebot aus Freiburg«, erinnerte sich Studienkollege Manfred Schuler; »und in gewisser Weise hatte er auch eine provisorische Zusage gegeben. Doch dann kam Stuttgart, und ich weiß noch genau, wie mir Fritz gesagt hat: ›Nun habe ich plötzlich zwei Angebote. In Freiburg könnte ich sofort die großen Rollen singen, in Stuttgart dagegen kriege ich nur einen kleinen Vertrag. Dennoch gehe ich lieber nach Stuttgart; in Freiburg würde ich zu schnell ausbrennen. Da müßte ich jeden Abend auf der Bühne stehen, und das ist nichts für einen Anfänger.‹«77
Stuttgart also. Schon auf den 1. August wurde er erwartet. Das hieß: Abschied nehmen von Freiburg. Von den Kolleginnen und Kollegen, von seiner großartigen Lehrerin Margarethe von Winterfeldt und von den übrigen Lehrern an der Hochschule, aber auch vom Studentenalltag und überhaupt von seiner Lehrzeit. Fünf Jahre hatte sie gedauert – »die wertvollsten und schönsten meines Lebens«, wie er in einem Abschiedsbrief,78 gerichtet an die Staatliche Hochschule für Musik, freimütig festhielt:
Betrifft: Bitte um Beurlaubung und Abschluß des Studiums an der Hochschule.
Ich bitte für den Rest des Semesters vom 1. Juli an um Beurlaubung, da ich durch Konzerte, Rundfunk- und Grammophonaufnahmen derartig in Anspruch genommen bin, daß es mir nicht möglich ist, meinen Unterricht ordnungsgemäß bis zum Semesterende zu absolvieren.
Wie an der Hochschule bekannt ist, beginnt am 1. August mein Vertrag mit dem Württembergischen Staatstheater in Stuttgart. Das bedeutet, daß mit dem laufenden Semester mein Studium an der Hochschule beendet ist.
Zum Wintersemester 1950/51 kam ich nach Freiburg, um auf Anraten von Herrn Professor Dr. Müller-Blattau, der am Gymnasium meiner Heimatstadt Kusel mein Musiklehrer war, Gesang zu studieren. Damals war es für mich nicht leicht, dieses Studium zu beginnen, von dem ich nicht einmal wußte, ob es mir das heiß ersehnte Ziel, Sänger zu sein, bringen würde. Wirtschaftliche Schwierigkeiten stellten mich häufig vor unlösbar scheinende Probleme. Gesundheitsschäden, bedingt durch die nächtelangen Tanzmusiken, die mir meinen Lebensunterhalt einbrachten, stellten sich ein. Oft war ich fest entschlossen, diesen mir sinnlos erscheinenden Kampf aufzugeben. Daß ich dieses nicht tun mußte, daß ich aus allen diesen tiefen Depressionen immer wieder herausfand, ist zuallererst das Verdienst meiner Lehrerin, Frau Professor Margarethe von Winterfeldt. Sie war es, die mich sängerisch denken und fühlen lernte, die mir in liebevollem, sorgfältigem Unterricht den Weg aufzeigte, den ich gehen mußte. In den langen Jahren meines Studiums war sie mir mehr als eine Lehrerin, sie war mir das Ideal und Vorbild des künstlerischen Menschen und wird dies für mich immer sein. Ihr gilt mein Dank und meine tiefe Verehrung, solange ich denken kann.
Jedoch auch der Hochschule möchte ich danken, ganz besonders Herrn Professor Dr. Scheck, für die wirtschaftliche Hilfe, ohne die es mir nicht möglich gewesen wäre, mein Studium zu vollenden. Ich möchte meinen Dank dadurch abstatten, daß ich alles daran setzen werde, das Vertrauen, das die Hochschule und alle meine Lehrer in mich setzten, zu rechtfertigen und ein guter Sänger zu sein.
Die nun hinter mir liegenden 5 Jahre meines Studiums waren die wertvollsten und schönsten meines Lebens. Sie haben aus mir einen Menschen gemacht, der weiß, wo sein Ziel ist und für den es nur eins gibt, dieses Ziel nun auch zu erreichen.
Lassen Sie mich noch einmal meinem tiefen Dank Ausdruck verleihen. Mögen alle jungen Menschen, die an der Hochschule studieren, soviel wertvolle Erfahrungen mit ins Leben nehmen, wie ich es nun darf.
Fritz Wunderlich