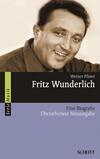Kitabı oku: «Fritz Wunderlich», sayfa 7
ZWEITER TEIL
STUTTGART
1955–1960
FÜNFTES KAPITEL
Traxel, Windgassen, Wunderlich: Drei Tenöre und eine Zauberflöte
Was wußte Wunderlich von Stuttgart? Von den Württembergischen Staatstheatern, wie es offiziell und im Plural hieß? Der Betrieb umfaßte Oper und Schauspiel, Musiktheater und Sprechbühne. Und Tanz selbstverständlich: das Stuttgarter Ballett, auch wenn dieses im Jahre 1955 noch nicht weltweit von sich reden machte. Dennoch hatte Stuttgart, hatten die Württembergischen Staatstheater einen hervorragenden Ruf. »Winter-Bayreuth« nannte man das Große Haus, anspielend auf die großen Bayreuther Sängerdarsteller, die in Stuttgart zum festen Ensemble gehörten: der Heldentenor Wolfgang Windgassen, die Wagner-Tragödin Martha Mödl, dazu Gustav Neidlinger sowie die unvergleichlichen Sängerdarstellerinnen Res Fischer und Grace Hoffman. Inge Borkh sang hier als ständiger Gast, auch Leonie Rysanek, Ira Malaniuk und Karl Schmitt-Walter. Wieland Wagner inszenierte regelmäßig in Stuttgart – seit 1954, als er mit »Fidelio« seinen Einstand gegeben und Kontroversen, ja beinahe einen Skandal ausgelöst hatte. Stuttgart als heimliche Hochburg des modernen Musiktheaters – davon hatte man gehört, weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Zumal das Stuttgarter Opernensemble beinahe Jahr für Jahr zu ausgedehnten Gastspielreisen eingeladen wurde und sich längst das Renommee der weitaus begehrtesten deutschen Reiseoper eingehandelt hatte.
Stuttgart, so scheint es rückblickend, hatte Opernglück. Der vom Architekten Max Littmann konzipierte dreigliedrige Hoftheaterkomplex aus dem Jahr 1912 – mit Großem und Kleinem Haus samt Verwaltungsgebäude und Kulissentrakt – blieb während des Zweiten Weltkriegs zwar nicht unbeschädigt. Im September 1944 fiel das Kleine Haus, wo das Schauspiel einquartiert war, einem Bombenangriff zum Opfer, während das Große Haus, Heimstätte der Oper, als eines der wenigen Monumentalgebäude im ganzen Stadtzentrum der Zerstörung entging. Gleich nach dem Krieg konnte man den Opernbetrieb wieder aufnehmen, in einem intakten Haus und ohne auf Provisorien angewiesen zu sein. Und nun sollte es sich zeigen: Stuttgart hatte in der Tat Opernglück. Auch mit seinem Intendanten. Seit 1950 amtierte Walter Erich Schäfer, zuerst als »Sparkommissar«, der auf behördliches Geheiß die Betriebskosten zu reduzieren hatte. Mit der Währungsreform war zwar das deutsche Wirtschaftswunder noch nicht ausgebrochen, waren aber immerhin die Grundlagen für einen neuen Aufschwung gelegt, und Schäfer verstand es, den Wind der Wirtschaftskonjunktur durch geschickt gesetzte Segel einzufangen. »Am besten spart, wer die Einnahmen erhöht«, hieß seine Devise.79 Und er sollte recht bekommen: Bereits drei, vier Jahre nach seinem Amtsantritt spielten die Württembergischen Staatstheater beinahe die Hälfte der staatlichen Subventionen wieder ein.
Die Bedeutung Stuttgarts als einer ernstzunehmenden, keineswegs provinziellen Musikstadt beschränkte sich aber nicht nur auf die Staatstheater. Stuttgart konnte zu Recht den Rang der »geheimen Chorhauptstadt Deutschlands«80 beanspruchen. Unzählige Chorgemeinschaften in und rund um Stuttgart traten Jahr für Jahr mit neuen Programmen an die Öffentlichkeit, opferten ihre Freizeit für die Einstudierung der großen Chorwerke: der populäre Stuttgarter Liederkranz, der traditionsreiche Philharmonische Chor, der Stuttgarter Oratorienchor sowie der Hymnuschor mit Knaben-Sopran- und Altstimmen. Zudem war eine Reihe bedeutender Orchester in Stuttgart zu Hause: das Württembergische Staatsorchester als Opernorchester, das Orchester des Süddeutschen Rundfunks, die Stuttgarter Philharmoniker sowie Karl Münchingers Stuttgarter Kammerorchester. Eine unüberblickbare Vielfalt an musikalisch-kulturellen Institutionen und Aktivitäten. Daß Fritz Wunderlich hier zahlreiche neue Aufgaben finden würde, lag auf der Hand.
Stuttgart 1955, eine Randbemerkung: Am 9. Mai, einem Sonntagmorgen, gelang es einem einzigen Mann, die gespannteste Aufmerksamkeit nicht nur der einheimischen Bevölkerung, sondern aller Deutschen auf sich zu lenken und Stuttgart für ein, zwei Tage ins Zentrum des weltpolitischen Interesses zu rücken. Der Deutschen Dichter, Thomas Mann, knapp vor seinem 80. Geburtstag stehend, war in die Württembergische Metropole gekommen, um zum 150. Todestag Schillers im Großen Haus auf Einladung der Deutschen Schillergesellschaft seinen Essay »Versuch über Schiller« vorzutragen. Unweit jener Stelle, wo der junge Schiller einst die Karlsschule erduldet und die Räuber entworfen hatte. Einige Tage später wiederholte Thomas Mann seinen Vortrag im anderen Deutschland, in Weimar. Glaubte er an einen Erfolg seiner symbolischen Reise in die beiden deutschen Staaten? In Stuttgart jedenfalls war sein Auftritt nicht überall auf Gegenliebe gestoßen: »Er und wir wurden mit Protestbriefen überschüttet«, erinnerte sich Generalintendant Schäfer, »weil wir einen Mann über unseren ›Nationaldichter‹ sprechen ließen, der sich im Ausland schriftlich und funkmündlich als eine Art Vaterlandsverräter erwiesen habe. Immerhin: 1955!«81
1955, am 1. August, begann Wunderlichs Vertrag mit den Württembergischen Staatstheatern. Friedrich Wunderlich – so steht sein Name zuunterst auf der alphabetisch gereihten Ensembleliste im Verzeichnis der Spielzeit 1955/56, gleich nach Wolfgang Windgassen. Und Windgassen war es auch, der den jungen Kollegen gleich in den ersten Tagen beiseite nahm, mit ihm in die Garderobe ging und sagte: »Ich will Ihnen gleich jetzt etwas sagen: Alkohol hat hier, in der Garderobe, nichts zu suchen. Und falls Sie hier einen Kollegen mit Alkohol antreffen, so merken Sie sich das genau: Dann wissen Sie, daß Sie länger singen werden als Ihr Kollege.«82 Gestrenge Sitten und keine unbeschwert-leichtlebige Bühnenmoral – darauf achteten die erfahrenen Kollegen und arrivierten Kammersänger unerbittlich. Für Wunderlich war das, nach seinen im ganzen doch wohlgeordneten fünf Freiburger Lehrjahren, eine ganz neue Welt, mit neuen Gesetzen und neuen Ansprüchen, aber auch mit neuen Verlockungen und Versuchungen. Es war eine Welt für sich, mit Bretterboden und Kulissenpappe, mit dem Geruch von Schminke und Klamotten. Hier galten andere Gesetze, hier war man ganz anderen Empfindlichkeiten ausgesetzt. Extreme Freude herrschte unmittelbar neben extremer Angst. Erfolg und die ständige Furcht vor dem Versagen waren die beiden Pole, zwischen die ein jeder eingespannt war. Eine Belastung, Tag für Tag, und sie kann jedem Neuling gefährlich werden.
»Ich habe da einen neuen Tenor, frisch von der Hochschule weg engagiert«, sagte Generalmusikdirektor Ferdinand Leitner zu Beginn dieser Spielzeit zu seinem Solokorrepetitor und Übungsmeister Walter Hagen-Groll. »Kümmern Sie sich mal ein bißchen um den. Der ist nämlich gut.« Also wurde Wunderlich bei Hagen-Groll zum Korrepetieren eingeteilt. Richard Wagners Meistersinger standen auf dem Programm; Wunderlich hatte die kleine Rolle des Würzkrämers Ulrich Eisslinger zugeteilt bekommen. Eine kleine Partie, im ersten und dritten Aufzug fast ausnahmslos Ensembles, im Verein mit den anderen Meistersängern zu singen. Schwierig war allenfalls das große Finale des zweiten Aufzugs, die sogenannte »Prügelfuge«, wo auf der Bühne jeder auf jeden losschlägt und dabei stets genau mitzählen muß: auf daß er seine diversen Einsätze, manchmal nur kleinste Einwürfe, nicht verpasse. »Die erste Korrepetitionssitzung wurde anberaumt«, erzählte Hagen-Groll, »ich warte und warte, war recht gespannt auf den Neuen. Aber der kam nicht. Eine halbe Stunde vielleicht habe ich gewartet, dann bin ich zur nächsten Probe gegangen. Von Wunderlich habe ich den ganzen Morgen nichts gehört. Mittags ging ich dann nach Hause. Da sagte mir meine Frau: ›Du, da war ein gewisser Herr Wunderlich bei mir, ein netter Kerl übrigens. Und er war ganz außer sich und hat sich bei mir entschuldigt – er habe den Herrn Hagen-Groll in der Oper einfach nicht gefunden.‹ Am nächsten Tag war wieder eine Korrepetitionssitzung anberaumt. Diesmal erschien Wunderlich selbstverständlich, und Hagen-Groll merkte sofort, daß Ferdinand Leitner nicht übertrieben hatte. »Bei Wunderlich war einfach alles da. Da saß jeder Ton, die Stimme sprach sofort an, und zwar auf alles, was er zu machen sich vorgenommen hatte.« Für ihn schien es keinerlei gesangliche Schwierigkeiten zu geben. »Man hatte, so paradox das letztlich klingt, nie den Eindruck, daß er irgendeine Gesangstechnik hatte.«83
Am 30. September war es soweit: Wunderlichs Debüt an der Stuttgarter Staatsoper, in Wagners Meistersingern und in einer imponierenden Runde erlauchter Kollegen wie Wolfgang Windgassen, Otto von Rohr, Fritz Ollendorff, Lore Wissmann und Hetty Plümacher. Der Dirigent, der alles überwachte: Generalmusikdirektor Ferdinand Leitner. Keine Neuinszenierung, sondern eine Wiederaufnahme einer längst eingespielten Inszenierung. Wunderlich hatte man notdürftig eingewiesen: von wo er aufzutreten und wo er abzutreten habe und dergleichen mehr. Für einen Bühnenneuling jedenfalls ein schwieriger Start. Und er sollte doppelt schwierig werden – weil ihm einige Bühnenkollegen nämlich einen Streich spielten. Bei der Prügelszene am Ende des zweiten Aufzugs stellt die Bühne bekanntlich ein Abbild Nürnbergs dar, mit Gassen und Hausfassaden: links, rechts und hinten je den Bühnenraum begrenzend. Aus einem dieser Häuser, oben im zweiten Stockwerk durch das geöffnete Fenster, sollte Wunderlich seine Partie singen. Um dieses Fenster überhaupt zu erreichen, mußte er auf der Hinterseite der Kulisse, vom Publikum selbstverständlich nicht zu sehen, eine Leiter emporsteigen, die genau zur entsprechenden Fensteröffnung hinaufführte. Nun hatten sich ein paar seiner Kollegen einen Spaß daraus gemacht, diese Leiter etwas zu verschieben, nach links oder nach rechts. Jedenfalls, als Wunderlich im entscheidenden Moment die Leiter hinaufstieg, fand er oben, am Ende der Leiter, partout kein Fenster mehr, kein Loch und keine Öffnung, wo er seine paar Sätze auf die Bühne hätte hinaussingen können… Nach dem Aktschluß kam dann Generalmusikdirektor Leitner persönlich auf die Bühne und fragte den gänzlich Verzweifelten augenzwinkernd im breitesten Berlinerisch: »Na, Kleener, haste überhaupt jesungen?«84
Im Oktober kamen vier neue Rollen hinzu, kleine Rollen ausnahmslos, »Wurzen«, wie man sie im Theaterjargon nennt; aber gelernt werden mußten auch die und geprobt werden auf der Bühne ebenfalls. Zuerst sang Wunderlich den Kilian in Webers Freischütz, eigentlich eine Baß-Bariton-Partie. Sie beschränkt sich auf ein dreistrophiges Lied zu Beginn des ersten Aufzuges. Vier Tage später stand Richard Wagners Tannhäuser auf dem Programm; Wunderlich sang die Rolle Heinrich des Schreibers. Auch sie besteht vornehmlich aus Ensembles, zu singen im Verein mit anderen Rittern und Sängern, die – im zweiten Aufzug – am berühmten Sängerkrieg auf der Wartburg teilnehmen. Ganz sicher scheint er sich dabei nicht gefühlt zu haben. Jedenfalls zischte Kammersängerkollege Windgassen, der den Tannhäuser sang, während der Aufführung plötzlich: »Herr Wunderlich, das muß ich Ihnen sagen: Lernen Sie bitte mal Ihre Ensembles. So geht das nicht bei uns.«85 Zwei Tage später wieder eine neue Oper: Giuseppe Verdis Othello, in deutscher Sprache gesungen, wie es damals an deutschen Opernhäusern üblich war. Wunderlich sang den Rodrigo. Neun Tage später ging Wunderlichs erste veritable Neuinszenierung über die Bühne, die über Wochen geprobt und auch musikalisch neu einstudiert worden war: Boris Godunow von Modest Mussorgsky. Gustav Neidlinger sang die Titelpartie. Von den einundzwanzig Mitwirkenden, die der Besetzungszettel auflistet, steht Wunderlich als Leibbojar an viertletzter Stelle: auch das eine kleine Rolle.
Im November und Dezember wiederholte Wunderlich diese vier Partien in insgesamt zwölf Aufführungen. Einzige Abwechslung: das Weihnachts-Oratorium von Johann Sebastian Bach, ein Konzert mit den renommierten Stuttgarter Hymnus-Chorknaben, begleitet vom Sinfonieorchester des Süddeutschen Rundfunks. Aufgeführt wurden traditionsgemäß nur die ersten drei Kantaten des sechsteiligen Werks, »ergänzt durch die beiden letzten Nummern des sechsten Teils«, wie das aus dem Aufnahmeprotokoll des Süddeutschen Rundfunks genau hervorgeht. Denn der SDR war live mit dabei an diesem 18. Dezember in der Stuttgarter Markuskirche. Und selbstverständlich auch die Presse: »Aus dem Gesangsquartett (Friederike Sailer, Erika Winkler, Fritz Wunderlich, Hannes Swedberg) ließ der junge Tenor als Evangelist und ungewöhnlich koloraturengewandter Solosänger aufhorchen«, schrieb Kurt Honolka, Stuttgarts maßgebender Musikkritiker, in den Stuttgarter Nachrichten.86 Ein respektabler Einstand mithin, auch als Konzertsänger.
Was auffällt: In drei dieser vier Opern – nicht im Boris Godunow – sang Wolfgang Windgassen die Hauptpartie. Und zwar in jeder Aufführung. Kein Startheater somit, jedenfalls nicht nach heutigem Wortgebrauch, sondern Ensembletheater. Obwohl Windgassen durchaus ein Star war und es an entsprechenden Angeboten von anderen Bühnen, von München, Wien oder Berlin, nie fehlte. »Der wichtigste Grund, weshalb ich in Stuttgart geblieben bin, ist der, daß ich hier sehr schöne Aufgaben hatte«, bekannte Windgassen rückblickend. »Ich halte es für richtig, daß man irgendwo ein Domizil hat, wo man immer wieder etwas erarbeiten kann … Unser Stuttgarter Generalintendant … hat es verstanden, uns, die wir plötzlich interessant wurden, einfach hier zu halten. Er hat uns die Freiheit gegeben, überall zu gastieren … Er hat unsere Tätigkeit außerhalb Stuttgarts dazu benutzt, das Stuttgarter Haus aufzuwerten … Mit ihm konnte man wie mit einem Vater reden. Was will man mehr?«87
Schäfer hat sie geliebt, die Mitglieder seines Ensembles. »In dieser Liebe (und der Gegenliebe) hat sich dieses Ensemble zu einer echten Familie zusammengeschlossen«, erzählte Schäfer später. »In einem Arbeitsgeist und einem Arbeitsklima, die von allen Hinzukommenden gespürt wurden. Dieser Ensemblegeist hat alle… durchdrungen und zu Gliedern der Familie gemacht.« Und besonders wichtig: »Dieser vielberufene Ensemblegeist war kein Veilchen, das im verborgenen blühte, sondern er dokumentierte sich… in den Vorstellungen, die von diesem Ensemblegeist getragen, von ihm durchtränkt waren und deshalb eine Einheit und eine Konzentration zeigten, die man nicht alltäglich nennen kann. Im extremen Gegensatz zum Startheater wollte sich nicht jeder nur selbst darstellen, sondern das Interesse aller war auf das Zusammenspiel… gerichtet.«88
Selbstverständlich war das alles nicht. Zumal Walter Erich Schäfer eigentlich kein Opernspezialist war, sondern vom Sprechtheater her kam, Bühnen- und Schriftstellererfahrungen mitbrachte und, von Natur aus, weniger ein handelnder, sondern mehr ein betrachtender Mensch war. Er konnte sehr hart sein – in seinem Urteil, seinen Reaktionen, aber auch in seinen Forderungen an die Künstler. Und an sich selbst. Im Umgang war er nicht immer leicht; zuweilen wirkte er fast schwäbisch bieder, vor allem im Vergleich zum mehr weltmännisch gewandten Generalmusikdirektor Leitner. »Ein introvertierter Denker«, resümierte Hagen-Groll, »und genau von dieser Eigenschaft her muß er auch als Intendant beurteilt werden. Er hatte eine unglaubliche Nase dafür, welche Leute an welchen Ort gehören, welche Sänger in welchem Moment ihrer Entwicklung mit welchen Partien betraut werden sollen. Oft habe ich ihn im Dunkel des Zuschauerraumes entdeckt, habe gesehen, wie er das Probegeschehen auf der Bühne aufmerksam beobachtete – still, ohne daß ihn einer bemerkt hätte. Er wußte genau, was ist – und er wußte ebenso genau, was sein könnte.«89
Nach und nach lernte Wunderlich die Stuttgarter Ensemblemitglieder kennen: Trude Eipperle mit ihrem hellen, strahlkräftigen Sopran, gefeierter Gast auf allen ersten Bühnen Europas. »Schon als er sich jedem einzelnen Ensemblemitglied vorstellte, fiel er vor der großen Kollegin Trude Eipperle auf die Knie und machte ihr Komplimente«, erzählte die Mezzosopranistin Hetty Plümacher später. »Er wußte, wie man die Herzen der Damen erobert.«90 Dann die Sopranistin Lore Wissmann, die Gattin Windgassens, eine Darstellerin von unvergleichlicher Ausstrahlung, sowie Res Fischer, Altistin mit einer monumentalen Stimme. Auch sie eine imposante Darstellerin, Bayreuth-erprobt wie ihre Kollegen Gustav Neidlinger, Gerhard Stolze und Martha Mödl, die zwar nie ganz makellos sang, aber eine unerreichte Bühnenkünstlerin war. Neidlinger und Windgassen gastierten damals oft zusammen. Und jedesmal mußte Windgassen auf seinen Kollegen aufpassen: daß er nicht vorzeitig schon wieder nach Hause fuhr. Denn Neidlinger hatte stets Heimweh und wollte möglichst schnell wieder nach Stuttgart zurück. Überhaupt die Stuttgarter Tenorgarde: der heldische Windgassen, der lyrisch-dramatische Josef Traxel, der stimmstrahlende Eugene Tobin für das italienische Fach, dazu Gerhard Stolze und neu noch Wunderlich – diese Tenorgarde war zweifellos einmalig in ganz Deutschland. Und sie ist einmalig geblieben bis heute.
Zwischen den Stars und dem »Fußvolk«, den Arrivierten und den Jungen wurden keinerlei Rangunterschiede gemacht. Es gab einen Stammtisch in der Künstlerkantine, und da saßen sie alle nebeneinander: Hans Günter Nöcker, Wolfgang Windgassen, Hubert Buchta, Gustav Grefe und Walter Hagen-Groll. Auch Generalmusikdirektor Leitner kam oft in die Kantine, setzte sich an den Tisch und war zum jüngsten Eleven genauso freundlich wie zum Herrn Kammersänger. Wunderlich wurde von allen, speziell auch von den Bühnenarbeitern und den Orchestermusikern, geliebt wegen seines offenen, unkomplizierten Wesens. Auch Leitner mochte ihn: »Unser privater Kontakt war so, daß wir uns alles sagen konnten. Wenn ich ihm technisch etwas zeigen wollte, hat er sich sofort dafür interessiert und hat das auch angenommen.« Ferdinand Leitner, 1912 in Berlin geboren, hatte einst selber Gesang studiert – nicht weil er Sänger werden wollte, sondern weil er sich damals an den Rat Bruno Walters gehalten hatte: daß ein guter Operndirigent singen können müsse. Und Leitner konnte sogar noch mehr: Er war ein ausgezeichneter Pianist, hatte sich, vor allem während des Zweiten Weltkriegs, einen hervorragenden Namen als Liedbegleiter gemacht, als Partner von Walther Ludwig, Erna Berger oder Margarethe Klose. Schon 1947 war er von der Münchener Oper nach Stuttgart gekommen; seit 1950 amtierte er als Generalmusikdirektor der Württembergischen Staatstheater. Für die Sänger war er ein idealer Dirigent. Selbst die »dicksten« Wagner- oder Strauss-Partituren legte er »schlank« an – und dies zu einer Zeit, als die vielbeschworene Transparenz noch kein abgegriffenes Modewort war. Ein eigentlicher Stimmenfachmann, was nun auch Fritz Wunderlich zugute kam. »Weil sein Vater ja so früh starb, hat er mir immer gesagt: ›Jetzt müssen Sie mich erziehen!‹ Das habe ich dann auch getan, oft mit einem nicht sehr angenehmen Nachdruck. Manchmal wußte er beispielsweise nicht, wie er sich auszudrücken hatte – und prompt kam es dann falsch heraus, ungewollt jovial oder gar verletzend. Nicht immer war seine Naivität reizend. Und noch eine Unart hatte er: Stets, wenn er sich irgendwo hinsetzte, machte er sofort seine Stiefel auf. Das machte mich nervös, denn so mit herabhängenden Schnürsenkeln – das war ja auch gefährlich für ihn und wurde ihm letztlich gar zum Verhängnis.«91
Bald freundete sich Wunderlich mit Hans Günter Nöcker an, Baßbariton, gleichaltrig, aber schon das zweite Jahr in Stuttgart. »Wir beide waren die Jüngsten und waren sehr schnell sehr gut miteinander. Auf der Probebühne haben wir jeweils Tischtennismatchs ausgetragen, und zwar mit den beiden ältesten Söhnen des Dirigenten Josef Dünnwald. Mit der Zeit fanden wir das allerdings etwas langweilig und haben dann Fußball gespielt. Immer mal ging wieder etwas kaputt, obwohl wir die Fensterscheiben mit Brettern vermachten. So mußten wir regelmäßig zum Verwaltungsdirektor Hans Dick. Er hat uns dann die Leviten gelesen: Wozu eine Probebühne da sei. Und wozu nicht.«92 Auch auf der Bühne standen sie oft zusammen: im Boris Godunow, im Tannhäuser und im Freischütz. Hier mimte Nöcker den Samiel, eine Sprechrolle. Die beiden ältesten Söhne von Staatskapellmeister Dünnwald, der die Freischütz-Aufführungen gewöhnlich dirigierte, wirkten als Statisten mit, der jüngste Sohn sang im Kinderchor, so daß die Kollegen dann witzelten: vier Dünnwälder in einer Aufführung!
Im neuen Jahr, gleich in den ersten Januartagen, kam für Wunderlich wiederum eine neue Partie hinzu, auch sie klein und eigentlich kaum der Rede wert: der Bote in Verdis Aida. Ein einziger Auftritt nur, kurz nach Beginn des ersten Aktes, genau zwanzig Takte lang. Nicht der Rede wert? Zumindest eine gewisse Schwierigkeit ergab sich bei italienischen Opern dadurch, daß in einer gewöhnlichen Vorstellung die Oper in deutscher Sprache gegeben wurde, daß aber, wenn italienische Starsänger gastierten, wenigstens ein Teil des Stuttgarter Hausensembles ihre Partie ebenfalls italienisch sang. »Zebravorstellung« nannte man das: halb italienisch, halb deutsch. Für Wunderlich kein Problem: Mit Italienisch hatte er sich ja schon an der Freiburger Hochschule abgegeben, und seine zwanzig Takte lange Partie lernte er im Handumdrehn in beiden Sprachen. Gastierte nun ein italienischer Radames in Stuttgart oder eine italienische Aida, so sang Wunderlich seine Partie ebenfalls italienisch. Es muß in dieser Zeit gewesen sein: eine Aida-Vorstellung, Wunderlich wartete hinter der Bühne auf seinen kurzen Botenauftritt, alberte mit den Dünnwald-Söhnen noch herum – und eilte dann, aufs Stichwort genau, hinaus auf die Bühne und ließ dort seinen Botenbericht abspulen. In italienischer Sprache – nur leider mitten in einer rein deutschsprachigen, gewöhnlichen Repertoirevorstellung. Wie peinlich! Und wie er die Hälfte seines Textes hinter sich gebracht hatte, bemerkte er seinen Fauxpas und schaltete, nochmals peinlich, auf die deutsche Sprache um.
18. Februar 1956. Eine Repertoirevorstellung der Zauberflöte stand auf dem Programm. Die Sängerbesetzung war achtunggebietend: Otto von Rohr als Sarastro, Josef Traxel als Tamino und Friederike Sailer als Pamina, dazu Olga Moll als Königin der Nacht und unter den drei Damen Grace Hoffman und Res Fischer. Selbst kleine Partien waren namhaft besetzt: Die beiden Geharnischten sangen Wolfgang Windgassen und Hans Gunter Nöcker. Josef Dünnwald dirigierte. Doch am Morgen schon rief man bei ihm an: Traxel habe leider abgesagt. »Ich bin dann hinüber ins Betriebsbüro gegangen, um zu hören, wer nun singt«, erzählte Staatskapellmeister Dünnwald. »Sofort schickte man nach Windgassen – er war im Haus auf einer Probe –, um ihn zu bitten, den Tamino zu übernehmen. Meistens sang Windgassen zwar heldische Partien, Lohengrin, Siegmund, Othello oder den Max im Freischütz, aber er wurde regelmäßig auch noch für lyrische Partien angesetzt. Windgassen kam ins Betriebsbüro. ›Der Traxel hat abgesagt. Würden Sie so freundlich sein und den Tamino übernehmen?‹ ›Na klar, mach ich‹, sagte er bereitwillig und ging wieder auf seine Probe.«
Ende gut, alles gut? »Nach zwei, drei Minuten kam Windgassen wieder zurück: ›Sagt mal, warum laßt ihr eigentlich nicht den Wunderlich singen?‹ Darauf meinte der Betriebsdirektor: ›Entschuldigung, Herr Kammersänger, aber wir können Ihnen doch nicht zumuten, daß ein Anfänger den Tamino singt und Sie nur die kleine Partie des Geharnischten!‹ ›Ja, warum denn nicht?‹ konterte Windgassen. ›Der muß doch auch mal ran. Ich weiß, daß er die Partie studiert hat. Also laßt ihn ruhig singen; das ist eine gute Gelegenheit.‹ Und doppelte nach: ›Selbstverständlich bleibt es dabei, ich sing’ den Geharnischten.‹« Dünnwald willigte ein; man rief bei Wunderlich an, und Fritz sagte begeistert zu. Was auf dem Betriebsbüro damals allerdings keiner gewußt hat: daß Wunderlich vor geraumer Zeit den Kammersänger Windgassen schon mal auf dieses Thema angesprochen hatte. Ob Herr Windgassen, falls er in nächster Zeit einmal als Tamino angesetzt werde, nicht ihn, den Neuling, »einspringen« lassen würde. Windgassen hatte damals zugesagt – und nun sein Versprechen gehalten.
»Ich habe dann eine kurze Verständigungsprobe mit ihm gemacht. Am Abend, kurz vor Vorstellungsbeginn, hat ihn der Abendregisseur in die Aufführung eingewiesen: von welcher Seite welcher Auftritt zu machen sei, wo er wann wie zu stehen habe. Fritz war ein kolossal musikalischer Mensch; er hat aufgepaßt, ich habe aufgepaßt, und so ging diese Vorstellung mühelos über die Runden.« Kollegen erzählten später, Wunderlich habe für seinen ersten Auftritt zehn oder gar fünfzehn Meter Anlauf genommen in der Gasse hinter der Bühne – damit er mit der richtigen Intensität auf die Bühne eile, immerhin auf der Flucht vor einer giftigen Schlange … Es wurde eine umwerfende Vorstellung. Wunderlich stürzte sich mit der ihm eigenen Intensität in diese Aufgabe – beeindruckend, ein Riesenerfolg im Publikum und auch bei seinen Kollegen. Kurz: ein einmaliger Durchbruch.93
Gleich am folgenden Tag gab es für Wunderlich ein neues Debüt: Erstmals sang er in München, in der Markuskirche, und erstmals unter der Leitung von Karl Richter. Drei Bach-Kantaten standen auf dem Programm: »Jesus nahm zu sich die Zwölfe« BWV 22, die berühmte Kreuzstabkantate BWV 56 sowie »Du wahrer Gott und Davidssohn« BWV 23. Seit 1951 wirkte der in Plauen im Vogtland geborene und in Leipzig in der Thomaskantorentradition ausgebildete Organist, Chorerzieher und Dirigent in München – als jüngster Dozent an der Staatlichen Musikhochschule, als Leiter des 1953 von ihm gegründeten Münchener Bach-Chores sowie des zwei Jahre später formierten Münchener Bach-Orchesters. Seit 1955 war er zudem Mitglied im Direktorium der Bachwoche Ansbach, der wohl renommiertesten Pflegestätte für Bachs Musik in Deutschland. In den wenigen Jahren seines Wirkens in München hatte Karl Richter die bayerische Metropole, die bis dahin ausschließlich für ihre römisch-katholische Kultur berühmt gewesen war, zu einem Weltzentrum evangelischer Kirchenmusik gemacht. Hier nun durfte Wunderlich seinen Münchner Einstand geben, im Kreise Bach-erfahrener Sängerkollegen: Antonie Fahberg, Hertha Töpper und Kieth Engen. Wunderlich scheint sich mit einer vorzüglichen Leistung eingeführt zu haben. »Der junge Tenor Fritz Wunderlich machte durch schöne stimmliche Mittel und Intensität seines Vortrags auf sich aufmerksam«, resümierte Karl Heinrich Ruppel am 22. Februar in der Süddeutschen Zeitung.
Seit Ende Januar weilte Wieland Wagner in Stuttgart, wo er die Erstaufführung von Carl Orffs Trauerspiel Antigonae vorbereitete. Volle vier Wochen Probezeit hatte er verlangt. Unerbittlich. Für Wunderlich, der einen der Thebanischen Alten singen sollte, gab das unerwartete Probleme, wie er Margarethe von Winterfeldt, seiner »lieben, verehrten Meisterin«, schrieb:94
… Weil das Stück so irrsinnig schwer ist und er die 4 Wochen ganz braucht, sind alle Urlaube im Februar für die Beteiligten gestrichen worden. Das hat für mich zur Folge, daß ich 8 Februartermine auf März und April verschieben muß, das heißt, ich kann nur die beweglichen Termine wie Rundfunk und Schallplattenaufnahmen verlegen, die Konzerte gehen mir verloren … Ich habe durch ein persönliches Gnadengesuch an Wieland Wagner erreicht, daß er mich für zwei Tage im Februar entläßt trotz des Urlaub-Verbotes unserer Intendanz … ich bin diese beiden Tage also in Freiburg zu Stech-Aufnahmen.
Dazu kommt noch, daß ich 2 neue Partien für Konzert (Honegger: Johanna auf dem Scheiterhaufen, und Messias) sowie 3 Bach-Kantaten für die französische Schallplatten-Gesellschaft Discophile, ferner eine Lieder-Platte mit Friederike Sailer zusammen lernen muß. Das sind alles Dinge, die mir erstens viel Geld und zweitens neue Beziehungen einbringen… Ich habe im Süddeutschen Rundfunk das Weihnachtsoratorium gesungen, und daraufhin hagelte es von Angeboten aus allen Richtungen, ich bin, ohne zu übertreiben, voll und ganz ausgelastet und muß nur aufpassen, daß ich mich nicht übernehme … Manchmal habe ich Angst, richtige Angst. Ich bin doch noch nicht so gut, ich habe wenigstens das Gefühl, daß ich noch nicht so gut bin, um derartig von allen Seiten mit Angeboten überhäuft zu werden. Ich fürchte, daß ich, wenn das noch in dem Maße weitergeht, die Kontrolle eines Tages verlieren werde…
Herrgott, wie war das alles so einfach damals, ich ging zu Ihnen und Sie wußten immer einen Rat. Als ich wegging, fühlte ich mich so stark und fertig. Nun, wo ich alles, aber auch jede Spannung, jede kleine und große Sorge und alle Angst mit mir allein, ganz allein abmachen muß, merke ich erst, was mir alles noch fehlt. Oh, es ist manchmal nicht einfach…
Angst vor den Anforderungen, die plötzlich von allen Seiten an ihn gestellt wurden, und Angst vor Überforderung. Was auch verständlich ist: Tag für Tag Antigonae-Proben an der Oper, daneben Konzerte, Rundfunkaufnahmen bei Willi Stech in Freiburg, Schallplatteneinspielungen von Bach-Kantaten und eine Liedplatte zusammen mit Friederike Sailer: ein beachtliches Pensum für einen 25jährigen Sänger. Was am meisten erstaunt: Fritz Wunderlich mit Bach-Kantaten auf Schallplatte. Bekannt geworden sind aber nur die beiden Kantaten »Ich hatte viel Bekümmernis« BWV 21 und »Nun ist das Heil und die Kraft« BWV 50. Tatsächlich aber hat er im Frühjahr 1956 drei weitere Bach-Aufnahmen gemacht: die Kantaten BWV 31 »Der Himmel lacht« und BWV 249 »Kommt, eilet und laufet«, besser bekannt unter dem Namen Oster-Oratorium, dazu das Magnificat. Diese Aufnahmen sind auch veröffentlicht worden, und zwar auf zwei Platten. Nur sucht man auf den entsprechenden Schallplattenhüllen den Namen Fritz Wunderlich vergebens. Neben Friederike Sailer (Sopran), Margarete Bence (Alt) und August Messthaler (Baß), alles bekannte Stuttgarter Sänger, steht Werner S. Braun (Tenor). Man wird ihn in keinem Sängerlexikon finden – weil es ihn nicht gibt, nie gegeben hat: Es ist ein Pseudonym für Fritz Wunderlich. Wunderlich war nämlich seit kurzem heim Europäischen Phonoklub Stuttgart unter Vertrag, und zwar exklusiv. Jeden Monat hatte er eine bestimmte Anzahl Aufnahmen zu machen, die nach Minuten genau berechnet und mit einem monatlichen Fixum honoriert wurden. Anderweitige Schallplattenaktivitäten waren ihm verboten – also blieb nur die Idee mit dem Pseudonym. Übrigens das einzige Mal, daß Wunderlich davon Gebrauch gemacht hat.