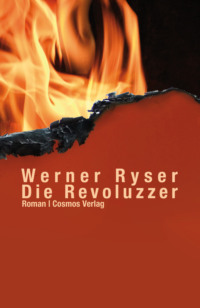Kitabı oku: «Die Revoluzzer», sayfa 2
2
Dorothea liebte das Land am Oberen Hauenstein mit seinen steilen Hügeln, den schroffen Kalksteinfelsen, dem lichten Mischwald und den Waldweiden. Sie liebte den weiten Blick nach Norden über die Hochebenen des Tafeljuras bis zum fernen Schwarzwald. Sie liebte Sankt Wendelin, ihren Hof, mit seinen aus hellem Jurakalk gefügten Bruchsteinmauern und dem mit Ziegeln bedeckten Satteldach. Es beschirmte den grossen Stall, das Tenn und die beiden Wohnungen, von denen sie jene im ersten Stockwerk für sich bestimmt hatte. Sie oben, die Jacobs unten. Besitzer und Pächter, städtische Herrschaft und ländliche Untertanen, oben und unten – wie es im Baselbiet Brauch war.
Fünfzehn Jahre waren vergangen, seit Mathis aus seiner Haft entlassen worden war. Remigius Preiswerk, der reiche Handelsherr, und Johannes Jacob, sein Pächter auf Sankt Wendelin, hatten längst das Zeitliche gesegnet, und auch ihre Ehefrauen waren den beiden ins Grab gefolgt.
Im Dezember 1775 hatte Barbara Jacob das von Mathis in vorehelicher Lust gezeugte Kind zur Welt gebracht. Auf Martha folgte ein Jahr später Peter, der erste Sohn. 1778 schrie der zweite, Paul, in seiner Wiege. Zwölf Monate darauf gab es noch einmal ein Mädchen, Hanna. Nach einer unfruchtbaren Zeit stillte Barbara die kleine Klara, der aber lediglich drei Wochen auf dieser Welt beschieden waren. 1786 schliesslich, sieben Jahre nach Hanna, kam Samuel zur Welt. Er blieb der Jüngste der Familie Jacob.
Nach dem Tod seines Vaters wurde Mathis Pächter von Dorothea Staehelin. Auch sie war inzwischen Mutter geworden. Ihre 1784 geborene Tochter Salome wuchs vaterlos auf, denn Dorothea hatte im Jahr ihrer Geburt den Obristen Christoph Staehelin, der sie immer wieder mit losen Weibern betrogen hatte, wegen Ehebruchs vor Gericht zitiert.
Die Familie des treulosen Gatten hatte mit allen Mitteln versucht, eine Scheidung, die als schimpflich galt, zu verhindern. Als Dorothea den alten Elias Staehelin auf dessen Landgut in Münchenstein aufsuchte, um über die bevorstehende Trennung zu sprechen, verjagte der Wüterich seine Schwiegertochter mit Steinwürfen und drohte, sie zu erschiessen, falls sie von ihren Plänen nicht Abstand nehme. Sie liess sich nicht einschüchtern, und nach langwierigen Verhandlungen gelang es ihr, mithilfe eines Anwalts, die Scheidung durchzusetzen und das Sorgerecht für Salome zu erstreiten. Zum Vormund des Mädchens bestellte der Kleine Rat ihren älteren Bruder, Benedikt Preiswerk, der die väterliche Seidenbandfabrik übernommen hatte und Mutter und Tochter im elterlichen Haus zum Goldenen Falken am Nadelberg in Basel aufnahm.
Als geschiedene und alleinerziehende Frau erlitt Dorothea Staehelins gesellschaftliche Reputation Schaden. Ob sie darunter litt, liess sie sich nicht anmerken. Eines aber war unübersehbar: Die vordergründig stolze und kalte Frau blühte auf, wenn sie die Sommermonate, zusammen mit ihrer Tochter, fern der Stadt, auf Sankt Wendelin verbrachte.
Ihr Verhältnis zu Mathis blieb allerdings seltsam distanziert. Zwar sprachen sie unbefangen über Dinge, die den Betrieb betrafen, über Neuanschaffungen etwa oder Viehzucht, manchmal auch über Allgemeines, aber was sie als Kinder und Jugendliche verbunden hatte, schien zerstört. Sie nannte ihn «Ihr» und «Mathis». Er selber blieb beim nackten «Ihr». Die «Madame Staehelin» wollte ihm so wenig über die Lippen wie seinerzeit die «Jungfer Dorothea». Gleichwohl entging ihr nicht, wie er sie in Augenblicken, in denen er sich unbeobachtet fühlte, betrachtete. Sie schalt sich ein närrisches Wesen, wenn sie merkte, wie unsinnig sie sich darüber freute.
Sie liebte es, ihn bei der Arbeit zu beobachten. Mithilfe seiner beiden heranwachsenden Söhne Peter und Paul verarbeitete Mathis die Milch seiner drei Dutzend Kühe zu Butter und Käse, die er auf den Märkten in Waldenburg und Liestal verkaufte. Daneben betrieb er eine Schweinemast. Die Tiere fütterte er mit der Molke, die aus der Käseherstellung übrigblieb. Ausserdem besass er Schafe, ein Hühnervolk und zwei Pferde, die er gegen Entgelt seinem Schwiegervater, dem Fuhrunternehmer Emil Strub, auslieh, als zusätzlichen Vorspann für die schweren Deichselwagen, mit denen dieser Waren über den Oberen Hauenstein transportierte.
Jedes Jahr legte Mathis auf seinem Weideland einen neuen Acker an, auf dem er Dinkel, Hafer und Roggen ansäte. Das alte Feld überliess er dem Graswuchs. Im Gemüsegarten vor dem Haus pflanzte Barbara Bohnen, Lattich, Kresse, Spinat, Kabis, Kohl und Zwiebeln. An den Obstbäumen im Bungert wuchsen Kirschen, Äpfel, Birnen und Zwetschgen. Und aus dem nahen Wald holte man Pilze, Beeren und Nüsse. In den Abendstunden arbeiteten Barbara und ihre Töchter an den beiden Webstühlen, die in der Spinnstube standen, und verdienten so ein Zubrot für die Familie.
Im Frühsommer 1790 wurde die Wohnung im oberen Stockwerk von Barbara Jacob, Martha und Hanna gründlich gereinigt. Die Tücher, die das Mobiliar vor Staub geschützt hatten, wurden entfernt, denn Anfang Juni traf Madame Staehelin mit Salome auf Sankt Wendelin ein, zweispännig kutschiert von einem Bediensteten ihres Bruders Benedikt. Wie jedes Jahr standen die Jacobs – Vater, Mutter und die sechs Kinder – vor dem Haus und erwiesen der Besitzerin des Hofs, die in den nächsten Monaten mit ihnen unter demselben Dach leben würde, die Reverenz. Und wie jedes Jahr hatte diese Geschenke mitgebracht, dieselben wie immer: Tabak für Mathis, einen Likör für seine Frau Barbara und Süssigkeiten für die Kinder.
Madame Staehelin trug, dem sommerlich warmen Wetter entsprechend, eine Robe à la Chemise, ein hemdartiges, knöchellanges Kleid aus federleichtem, weissem Musselin. Ihr Gurt, ein aufwendig gewobenes, mit farbigen Mustern durchsetztes Seidenband aus der Fabrikation ihres Bruders, das sie im Rücken zu einer grossen Schleife gebunden hatte, betonte ihre schlanke Taille. Ihr dunkles, gewelltes Haar war bedeckt von einer weichen, ebenfalls mit einem Seidenband geschmückten Haube mit breiter Krempe, die ihr Gesicht halb verdeckte. Die sechsjährige Salome war ähnlich gekleidet wie ihre Mutter. Die beiden folgten Mathis, der dem Kutscher half, die Bagage in den ersten Stock zu tragen.
Samuel, der vor kurzem vier Jahre alt geworden war, schaute ihnen staunend nach. Sie sahen ganz anders aus als seine Mutter und seine Schwestern mit ihren dunklen Röcken und den mit Ärmeln versehenen Schnürmiedern, über denen sie Schürzen trugen. Obwohl man ihm gesagt hatte, dass Madame Staehelin und ihre Tochter schon im vergangenen Jahr hier gewesen waren, erinnerte er sich nicht mehr an sie.
Am nächsten Tag hatten Madame Staehelin und Salome die Musselinkleider gegen ähnliche Trachten ausgetauscht, wie sie Barbara und ihre Töchter trugen.
«Wir sind jetzt auf dem Land», bemerkte Dorothea, «und wollen uns nicht herausputzen.»
Salome, die entdeckt hatte, dass Hanna und Samuel keine Hüte tragen mussten und barfuss gingen, quengelte so lange, bis auch sie die Haube ablegen und ihre Schnürstiefelchen und Strümpfe ausziehen durfte. Die kleine Mamsell nahm den um zwei Jahre jüngeren Samuel, der sich ihr bereitwillig unterordnete, unter ihre Fittiche.
«Mir will scheinen», sagte Dorothea zu ihrem Pächter, der über den Hof schritt, «meine Tochter habe einen neuen Galan gefunden. Manchmal frage ich mich», fuhr sie fort, «ob Ihr Euch noch erinnert, dass wir als Kinder auch miteinander gespielt haben?» Sie sah ihm forschend ins Gesicht.
Er strählte mit den Fingern durch den schwarzen Bart. Ihre Frage war ihm unangenehm. «Ich habe in der Käserei zu tun», brummte er.
Sie sah ihm betroffen nach. Ob er ihr nicht verzieh, dass sie durch den Zufall ihrer Geburt zu jener Schicht gehörte, die Menschen wie ihn zum Stand der Leibeigenschaft verurteilte? Sie seufzte.
Dorothea glaubte, selber von ständischem Denken frei zu sein. Sie bestand darauf, auf Sankt Wendelin dasselbe zu essen wie die Jacobs: Das dunkle, von Barbara gebackene Brot, dazu Käse, ferner Gemüse aus dem Pflanzgarten, manchmal auch Fleisch und zur Nachspeise Beeren. Nach dem Vorbild von Jean-Jacques Rousseaus Émile sollte Salome ein Stück jener Natürlichkeit erfahren, die Dorothea, im Vergleich zum Leben im Stadtpalais ihres Bruders, als die wahrhaftigere Form des Daseins erschien.
Nicht ganz dazu passen wollte, dass ihr die inzwischen elfjährige Hanna auf Sankt Wendelin als Magd dienen musste. Das Mädchen hatte am Morgen als Erstes die Nachttöpfe von Madame und Salome zu leeren. Später war sie bei der Morgentoilette behilflich. Mit geschickten Händen flocht sie den dunkelbraunen Zopf, den Dorothea anschliessend à la Pompadour auf ihrem Scheitel feststeckte. Täglich fegte Hanna den Boden, denn man hielt im oberen Stockwerk auf Reinlichkeit. Ausserdem hatte sie Botengänge zu erledigen. Zu Dorotheas Vetter etwa, Pfarrer Theophil Grynäus, nach Waldenburg. Mit ihm tauschte Madame Bücher aus: Goethe, Schiller und Lessing, auch Diderot, Voltaire und eben – Rousseau. Letztere im Originaltext. Dorothea Staehelin sprach fliessend Französisch. Vetter und Base trafen sich regelmässig, um sich über ihre Lektüre zu unterhalten.
Wenn sie nicht las, unternahm sie ausgedehnte Spaziergänge, manchmal zusammen mit ihrer Tochter und dem kleinen Samuel. Meistens aber streifte sie, ausgestattet mit einer Botanisiertrommel, allein durch die Wälder am Nordhang des Oberen Hauensteins. In ihnen wuchsen neben den belaubten Buchen, Eichen, Sommerlinden und Mehlbeerbäumen auch Fichten, Eiben, Föhren und Edeltannen. Wo die Sonne durchs Geäst brach, fand sie, je nach Bodenbeschaffenheit, den leuchtend roten Pyramiden-Hundswurz, das violette Knabenkraut, den Berg-Seidelbast und die Alpenhagrose. Sie pflückte einzelne Blumen, die sie zu Hause presste. Auf einem Herbarbogen, der ihre lateinische Bezeichnung und Angaben über den Fundort enthielt, wurden sie später in ihre Sammlung aufgenommen. Daneben malte sie mit Wasserfarben Pflanzen, die ihr besonders gefielen.
Dorothea genoss die ländliche Idylle, während jenseits der Grenzen des Freistaats Basel ein Sturm aufzog. Wenn er sich ausbreitete, konnte er die Weltordnung auf den Kopf stellen. Als vor einem Jahr, im Juli 1789, die aufständische Bevölkerung von Paris die Bastille erstürmte, etwas später die französischen Standesprivilegien abgeschafft wurden und die Nationalversammlung eine Art Volksherrschaft erzwungen hatte, waren adelige Emigranten auf ihrer Flucht durch Basel gekommen. Man hatte sich wochenlang über die Sundgauer Bauern erregt, die Schlösser in Flammen aufgehen liessen und die Bezahlung von Zinsen und Zehnten verweigerten. Dorotheas Bruder Benedikt, der Besitzungen im Elsass hatte, hatte Verluste erlitten. Ob die Baselbieter Bauern auch zu solchen Aufständen fähig wären? Mathis Jacob? Sie wusste, dass er einen tiefen Groll gegen die Obrigkeit hegte. Aber sie wagte nicht, ihn zu fragen. Er selber äusserte sich nicht zu den Vorgängen in Frankreich.
Jener Teil der städtischen Oberschicht, der sich in den Reformgesellschaften traf und das Gedankengut der Aufklärung diskutierte, war überzeugt, dass man handeln müsse. Der Ratsherr Abel Merian, der mit den neuen Ideen sympathisierte, hatte mit vor Pathos bebender Stimme gefordert, die Barbarey des Mittelalters zu beenden und die Leibeigenschaft der Untertanen draussen in der Landschaft aufzuheben. Das war vor bald neun Monaten gewesen. Aber noch immer hatte man im Grossen Rat nicht über den Antrag entschieden.
3
Sankt Peter, die einzige Kirche der Talschaft, lag flussabwärts, unterhalb von Oberdorf. Am Sonntag nach ihrer Ankunft begleitete Dorothea Staehelin Barbara Jacob und deren drei älteste Kinder in den Gottesdienst. Heute war Anwesenheit Pflicht, denn die Männer des Amtes Waldenburg hatten vor dem neuen Landvogt Hans Jakob Müller den Huldigungseid abzulegen. Mathis war allerdings nicht mitgekommen. Er habe sich nachts mehrmals übergeben müssen, berichtete seine Frau. Ausserdem quälten ihn heftige Kopfschmerzen. Auch Salome und Samuel waren, unter der Obhut von Hanna, zu Hause geblieben.
Amüsiert beobachtete Dorothea, wie Müller, ein kleiner, gedrungener Mensch, hoch aufgerichtet auf dem für ihn reservierten Stuhl im Chor der Kirche sass. Er war Meister der Zunft zu Metzgern in Basel. Durch einen Losentscheid war ihm für acht Jahre die Herrschaft über das Amt Waldenburg in den Schoss gefallen. Er trug einen schwarzen Mantel, schwarze Kniehosen und schwarze, seidene Strümpfe. Den Ratsherrenhut hielt er auf den Knien. Das Kinn in die gefältelte spanische Halskrause gedrückt, betrachtete er misstrauisch seine Untertanen. Dorothea wusste, dass bei der Besetzung von einträglichen Stellen im Freistaat Basel in der Vergangenheit ein unschöner Ämterschacher üblich gewesen war. Neuerdings liess man sich bei der Vergabe von Landvogteien vom Zufall leiten – nach dem Grundsatz, wonach Gott jenen, denen er ein Amt gibt, auch den notwendigen Verstand schenkt.
Ihr Vetter, der Pfarrer, hatte an diesem Tag auf Anordnung des Antistes einen Text aus dem Römerbrief auszulegen: Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Ordnung; die aber widerstreben, werden über sich ein Urteil empfangen.
Während er predigte, fragte sich Dorothea, ob es Theophil Grynäus, mit dem sie zuweilen geistreiche Gespräche über Freiheit und Menschenrechte führte, nicht genierlich war, von seiner Gemeinde bedingungslosen Gehorsam gegenüber dem Bürgermeister, dem Oberstzunftmeister und dem Landvogt zu verlangen.
Nachdem er endlich zum Schluss gekommen war, sprach er den Männern der Talschaft, die sich erhoben hatten, den Treueeid vor, den sie Wort für Wort dumpf nachbeteten.
Hans Jakob Müller stand vor dem Altartisch und schien in den verschlossenen Gesichtern seiner Untertanen nach Widerborstigkeiten zu suchen. Die Hand auf dem Zierdegen an seiner Rechten war er bereit, sie im Keim zu ersticken. Ein kleiner, kampfbereiter Mann. Was für ein aufgeblasener Frosch, dachte Dorothea halb belustigt, halb ärgerlich. Sie war froh, dass Mathis nicht an diesem Ritual der Unterwerfung hatte teilnehmen müssen.
Theophil Grynäus war wie so viele zweit- und drittgeborene Söhne von Basler Handelsherren, denen es nicht vergönnt war, das väterliche Geschäft zu übernehmen, vor die Wahl gestellt worden, Offizier in fremden Diensten oder Geistlicher zu werden. Der durch und durch unkriegerisch gesinnte Mensch hatte sich für Gott entschieden und war nach seinem Theologiestudium vom Rat als Pfarrer in Waldenburg eingesetzt worden. Er hätte es schlechter treffen können. Wie seine Amtsvorgänger lebte er im Schönthaler Hof, dem «Steinernen Haus», wie man es im Ort nannte. Es lag in der Nordwestecke der Stadtbefestigung. Ein mächtiger, zweigeschossiger Bau, der durch einen Toreingang über den Hof zugänglich war. Ursprünglich hatte das Haus, das zu den ältesten im Städtchen gehörte, wohl als Adelssitz gedient. Er war verwitwet. Eine Magd besorgte ihm den Haushalt und kümmerte sich um seine vier Kinder. Für die kleine pfarrherrliche Landwirtschaft war ein Knecht zuständig.
Wie von jedem Pfarrer in der Landschaft erwartete die städtische Obrigkeit auch von ihm, dass er sie regelmässig über mögliche Unruhestifter in seiner Herde informierte. Da jetzt zu befürchten war, die Baselbieter könnten sich die aufrührerischen Sundgauer Bauern zum Vorbild nehmen, war das Misstrauen der Gnädigen Herren besonders gross. Grynäus richtete seine akkurat verfassten Schreiben an den Münsterpfarrer, der als Antistes Vorgesetzter aller Geistlichen im Kanton war. Die Berichte wurden an die Staatskanzlei weitergeleitet, wo man entsprechende Massnahmen gegen unbotmässige Untertanen ergriff.
Schon vor ein paar Tagen hatte Theophil Grynäus seine Base eingeladen, nach dem sonntäglichen Gottesdienst das Mittagessen mit ihm im Schönthaler Hof einzunehmen. Jetzt sass man bei Tisch in der Halle unter der Balkendecke, die mit Blumen, Granatäpfeln, Trauben und einem Hirsch bemalt war. Die Haushälterin hatte einen Braten zubereitet. Dazu gab es Kartoffeln und Apfelschnitze.
Nach dem Essen schickte der Pfarrer seine Jungmannschaft in den Hof zum Spielen und bat Dorothea zu einem Gespräch unter vier Augen in seine Studierstube. «Es geht um deinen Pächter», sagte er, als sie Platz genommen hatte. «Im Schloss oben verdächtigt man ihn der Ketzerei.»
Dorothea lachte. «Das kann nicht sein. Mathis ist ein braver Mann, der jeden Sonntag in die Kirche geht. Er hat alle seine Kinder taufen lassen und schickt sie auch in die Kinderlehre.»
«Ich weiss», seufzte der Pfarrer. «Gleichwohl hat mich der Landvogt beauftragt, der Sache nachzugehen. Er hat sogar gedroht, andernfalls selber die Obrigkeit zu orientieren.» Er schaute seine Base an. «Ich frage dich nun ganz direkt: Ist Mathis ein Täufer, wie sein Vater Johannes einer war? Und bevor du jetzt etwas sagst», schob er eilig nach, «musst du wissen, dass er sich regelmässig mit ein paar anderen Bauern in einem Hauskreis trifft, wo man die Bibel liest und das Wort Gottes auslegt.»
Davon wusste Dorothea nichts. «Wer hat dir das erzählt?»
«Heinrich Bidert, der Schuhmacher, der in Bärenwil bei Langenbruck lebt. Er nimmt in meinem Auftrag an diesen Konventikeln teil und berichtet mir darüber.»
«Du lässt die Mitglieder deiner Gemeinde heimlich überwachen?» Dorothea schaute ihn ungläubig an.
«Das gehört zu meinem Hirtenamt.» Grynäus zitierte aus dem Lukasevangelium: «Welcher von euch, wenn er hundert Schafe hat, und verliert eines von ihnen, lässt nicht die neunundneunzig in der Wüste, und gehet dem verlorenen nach, bis er es findet?»
Dorothea stellte sich den kleinen, rundlichen Vetter als Hirten vor und ihren Pächter, der ein stattliches Mannsbild war, als verlorenes Schaf. Nur mit Mühe konnte sie ein Lächeln unterdrücken. Natürlich wusste sie um den täuferischen Hintergrund der Jacobs. Tatsächlich gab es viele reiche Basler, die, wie ihr Vater, ihre Sennhöfe in der Landschaft am liebsten an Mennoniten verpachteten. Diese standen im Ruf, zuverlässig und fleissig zu sein. Ihr Glaube störte nicht, solange sie ihre Zinsen pünktlich bezahlten. Es erschien ihr als Anachronismus, jemanden als Ketzer zu bezeichnen, nur weil er einem etwas abweichenden Glauben anhing. «Aber Theophil», tadelte sie den Cousin, «denk an unsere Diskussionen über die Dichter und Denker, die in deinem Bücherregal stehen. Ich kann nicht glauben, dass du dich dafür hergeben magst, deine Schäfchen auszuspionieren.»
«Der Herr Landvogt und der Herr Antistes in Basel …» Grynäus, der wenig mutig und überdies obrigkeitsgläubig war, rang die Hände. Das Gespräch war ihm peinlich. «Mathis Jacob war heute nicht in der Kirche, als die Treue zur Stadt beschworen wurde. Der Herr Landvogt hat von mir verlangt, eine Liste jener Männer zu erstellen, die an der Zeremonie fehlten. Während des Gemeindegesangs habe ich seinen Auftrag erledigt. Mathis Jacob war nicht da!» Grynäus schaute seine Base herausfordernd an.
«Du wirst ihn von deiner Liste streichen! Er ist krank.»
«Ob das der Landvogt glauben wird?»
«Da gibt es nichts zu glauben. Er steht nicht auf deiner Liste, sonst sind wir geschiedene Leute.»
Grynäus blieb hartnäckig: «Immerhin hat dein Pächter den Ruf, wider den Stachel zu löcken. Du weisst: Man hat ihn auch schon einmal mit Kerkerhaft bestrafen müssen.»
«Mach dich nicht lächerlich.» Wie immer, wenn sie sich ärgerte, vertieften sich die zwei Falten über Dorotheas Nasenwurzel. «Erstens liegt die Sache fünfzehn Jahre zurück, und zweitens war das eine Schikane, an der mein Vater, Gott möge ihm verzeihen, ein gerütteltes Mass an Mitschuld trägt. Wie kommt der hochwohlgeborene Metzgermeister überhaupt dazu, von diesen Dingen zu wissen?»
«Das Schlossarchiv hat ein langes Gedächtnis. Nach seiner Ankunft in Waldenburg hat er sich alle Akten, die Strafsachen betreffen, vorlegen lassen. Wenn sich jetzt noch herausstellen sollte, dass er ein Ketzer ist, gerät er in Schwierigkeiten. Ich habe gehofft, dass du mir bestätigst, dass Mathis Jacob kein Täufer ist. Dann könnte ich mich in meinem Bericht auf dich berufen. Am Wort einer geborenen Preiswerk wird der Landvogt nicht zu zweifeln wagen.»
«Das würde dir so passen, die Verantwortung auf ein Frauenzimmer abzuschieben.» Wieder war eine gewisse Schärfe in ihrer Stimme. Und mit leisem Spott fuhr sie fort: «Wie du richtig gesagt hast: Du bist sein Hirte, also wirst du selber auch Zeugnis für seine brave Gesinnung ablegen. Lass deinen Knecht die Chaise anspannen, und fahr mit mir nach Sankt Wendelin. Dann kannst du ihn gleich selber fragen.»
Eine Stunde später sassen sie in der Stube von Sankt Wendelin: Mathis Jacob, der offenbar wieder munter war, seine Frau Barbara, Dorothea Staehelin und Pfarrer Grynäus. Martha, Peter und Paul hatten noch im Städtchen bleiben dürfen und würden später heimkehren. Hanna war angewiesen worden, im oberen Stockwerk auf Salome und Samuel aufzupassen. «Macht keinen Lärm!», hatte ihnen Madame eingeschärft. «Wir haben hier wichtige Dinge zu besprechen.»
Mathis war Theophil Grynäus unheimlich. Er war grösser und kräftiger als der Geistliche, und mit seinem vollen, dunklen Haarschopf und dem Bart, die sein markantes Gesicht umrahmten, schien er ihm bedrohlich. Jetzt schwieg er und wartete darauf, was Grynäus zu sagen hatte.
Der schaute um Hilfe heischend zu seiner Base. Ein spöttisches Lächeln spielte um ihre Lippen.
Der Pfarrer gab sich einen Ruck. «Ich will nicht drum herumreden, Mathis. Es geht das Gerücht, dass du zu den Täufern gehörst.»
«Unsinn!» Der Bauer sah Grynäus durchdringend an.
«Unsinn? Das musst du mir genauer erklären.» Und hastig: «Der Herr Landvogt hat mir den Auftrag gegeben, über dich einen Bericht zu schreiben.»
«Ihr wisst genau, dass ich getauft bin und dass Ihr selber meine Kinder getauft habt. Ich und die Meinen kommen Sonntag für Sonntag zur Kirche. Mein Vater war ein Taufgesinnter. Ich bin es nicht.»
«Der Herr Landvogt scheint dir nicht zu glauben.»
«So, er glaubt mir nicht?» Mathis erhob sich und trat ans Fenster.
Grynäus duckte sich, als er an ihm vorbeiging. Von dem Mann ging eine versteckte Gewalttätigkeit aus, die ihn ängstigte.
«Wenn er meinem Wort nicht vertraut», sagte der Bauer und schaute hinaus auf die Weide, «kann man nichts machen. Was wollt Ihr?» Er kehrte sich um und schaute den Pfarrer an. «Möchtet Ihr, dass ich einen heiligen Eid schwöre? Oder geht es Euch gar nicht darum? Möchtet Ihr und Euer Landvogt mich und meine Familie vom Hof vertreiben, wie es die Gnädigen Herren von Bern mit meinen Vorfahren getan haben?»
«Mathis, bitte», versuchte ihn seine Frau zu beschwichtigen.
Er wischte ihren Einwand mit einer Handbewegung weg. «Wie lange noch glaubt Ihr und Euresgleichen, über unser Gewissen bestimmen zu können?» Er schaute Grynäus feindselig an. «Selbst wenn ich Täufer wäre, so wäre das eine Sache, die ich allein vor Gott zu verantworten hätte. Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es. Das schliesst unserer Meinung nach auch das Recht auf den freien Glauben ein.»
Dorothea Staehelin hob den Kopf. Sie besass ein Exemplar der Droits de l’Homme et du Citoyen. Mathis hatte von «uns» gesprochen. Dass auch die Untertanen in der Basler Landschaft die Menschenrechte lasen und sogar daraus zitierten, verblüffte sie.
Der Pfarrer war schockiert. «Woher hast du das?»
«Glaubt Ihr, wir wüssten nicht, was in Frankreich geschieht?»
Grynäus verschlug es die Sprache. War man schon so weit? Musste man bei den eigenen Untertanen mit Gewalt und Rebellion rechnen? Der Pfarrer stand auf. Auf seiner Stirn standen Schweisstropfen. «Ich sehe schon, du bist kein Täufer, du bist ein Revoluzzer. Ich werde dies dem Herrn Landvogt mitteilen müssen.»
«Nichts wirst du!», zischte Dorothea. Und dann fuhr sie auf Französisch fort: «Was Mathis sagt, ist genau das, was auch du mir gesagt hast, als wir das letzte Mal über die Menschenrechte und die verknöcherte Herrschaft in Basel diskutiert haben. Wenn ein Wort über dieses Gespräch nach aussen dringt, wenn du es wagen solltest, Mathis Jacob zu denunzieren, wenn du erwähnst, dass er heute beim Huldigungseid nicht anwesend war, werde ich deine Vorgesetzten über deine Lektüre und deine aufrührerischen Reden ins Bild setzen, und dann wird es mit deiner Pfarrherrenherrlichkeit im schönen Waldenburg ein rasches Ende nehmen.»
«Dorothea!» Er schaute seine Base entsetzt an.
«Mathis Jacob ist mein Pächter», sagte sie jetzt wieder im Dialekt, «und ich lasse nicht zu, dass ihm ein Leid geschieht.»
Noch während sie dem Vetter zornig in die Augen starrte, hörte man einen Schrei, dann wurde die Tür zur Stube aufgerissen.
«Sämi», stammelte Hanna. Sie war kreidebleich.
Hinter ihr stand Salome. Auch ihr war der Schrecken ins Gesicht geschrieben. «Er ist tot.» Sie stürzte zu ihrer Mutter und vergrub schluchzend den Kopf an ihrer Brust.