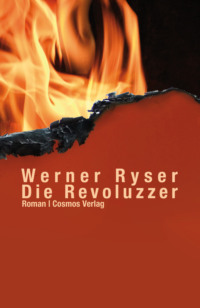Kitabı oku: «Die Revoluzzer», sayfa 3
4
So schnell sie konnte, lief Hanna über den Waldweg zur Chlusweid hinauf. Tränen flossen über ihre Wangen. Einmal stolperte sie über eine der knorrigen Flachwurzeln und fiel hin. Sie rappelte sich hoch, ohne auf die blutig geschürften Ellenbogen zu achten. Sie lief weiter, immer weiter. Nur einmal blieb sie kurz stehen und rang nach Atem, dann rannte sie wieder. In der Hand hielt sie das Papier mit der Nachricht von Madame Staehelin, die sie Doktor Alioth übergeben sollte.
«Sag ihm, er soll sich beeilen, vielleicht kann er Samuel retten», hatte sie gesagt. «Und nun lauf. Es geht um Leben und Tod!»
Hanna hatte im oberen Stockwerk die Kinder hüten müssen. «Seid leise», hatte sie gesagt, immer wieder: «Seid leise, wir dürfen die Erwachsenen nicht stören.» Aber Salome und Sämi hatten ihr nicht gehorcht. Sie waren übermütig gewesen, hatten begonnen, Fangen zu spielen und sich gegenseitig durch die Wohnung gejagt. Hanna war ihnen nachgerannt, hatte sie beschworen ruhig zu sein, aufzuhören, hatte gefleht und gedroht. «Sämi!», hatte sie gerufen und «Mamsell Salome!» Vergeblich. Für die beiden war ihre Aufregung ein zusätzlicher Anreiz, Teil des Spiels. Dann endlich hatte sie den kleinen Bruder am Arm erwischt. Sie standen am oberen Ende der Treppe. Sie hielt ihn fest, aber er konnte sich losreissen – und stürzte kopfvoran die Treppe hinunter. Zweimal überschlug er sich. Dann blieb er am Fuss der Treppe liegen. Bewegungslos. Aus seinem Mund und den Ohren floss Blut. Hanna hatte laut geschrien.
Starr vor Schreck waren Vater und Mutter vor dem kleinen, regungslosen Körper gestanden. Der Pfarrer hatte sich im Hintergrund gehalten. Madame Staehelin aber hatte sich von der weinenden Salome gelöst und war neben Sämi auf den Boden gekniet. Sie hatte ihr Ohr an seine Brust gelegt, hatte seinen Puls gefühlt und schliesslich gesagt: «Er lebt noch». Dann hatte sie Anweisungen erteilt: «Ihr, Barbara, müsst das Bett in der leeren Kammer in meiner Wohnung frisch beziehen. Sobald das getan ist, werdet Ihr, Mathis, Euer Kind ganz vorsichtig hinauftragen. Ich denke, dass sein Kopf nicht bewegt werden darf. Und du», sie hatte sich an Hanna gewandt, «wirst nach Langenbruck laufen, zu Doktor Alioth. Du bittest ihn, so rasch wie möglich hierher zu kommen. Ich gebe dir ein paar Zeilen mit. Wenn er fragt, wie es Samuel geht, so sagst du ihm, er sei die Treppe hinuntergefallen. Er habe die Besinnung verloren und blute aus dem Mund und den Ohren.»
«Er lebt noch», hatte sie gesagt. Hanna klammerte sich an dieses «noch». Inzwischen hatte sie das ehemalige Kloster Schönthal erreicht, das vor vielen hundert Jahren, mitten in der bewaldeten Hügellandschaft am Oberen Hauenstein, erbaut worden war. Abermals blieb sie stehen, um Atem zu schöpfen. Ihr Blick fiel auf die Fassade der Kirche. Über dem Torbogen war ein Lamm zu erkennen, das auf seinen Schultern ein Kreuz trug. Links davon war eine Muttergottes samt Jesuskind in den gelben Sandstein gehauen.
Hanna wusste, dass sich die Katholiken drüben im Solothurnischen an die Jungfrau Maria wandten, wenn sie ein Herzensanliegen hatten. Pfarrer Grynäus hatte in der Kinderlehre erklärt, das sei eine Art Götzendienst. Wer den wahren, reformierten Glauben habe, könne sich direkt Gott oder Jesus anvertrauen. Ergriffen von der Innigkeit, mit der Maria das Kindlein in ihrem Schoss betrachtete, schickte Hanna aber auch zu ihr ein Stossgebet. «Lass lieber mich sterben als ihn», flüsterte sie.
Doktor Alioth und seine Frau sassen bei einer Tasse heisser Schokolade und einem Stück Kuchen unter dem grossen Apfelbaum vor ihrem Haus und genossen den Frühsommernachmittag. Karl Alioth war gegen fünfzig Jahre alt. Seine ehemals blonde, inzwischen silbergraue Lockenpracht hatte sich an der Stirn ziemlich gelichtet. Aus seinem runden Gesicht blickten, umrahmt von unzähligen Lachfältchen, zwei kluge blassblaue Augen. Sie weiteten sich erstaunt, als Hanna Jacob durch seinen Garten stürmte und mit hochrotem Kopf, schwitzend und verheult, vor ihm stehen blieb. Vor elf Jahren war er wegen ihr geholt worden, da ihre Geburt mit Komplikationen verbunden gewesen war. Seither hatte er sich ab und zu nach ihrer Entwicklung erkundigt.
«Du bist ja ganz ausser dir, Kind», sagte seine Frau. «Was ist denn geschehen?»
«Sämi!», stiess Hanna hervor, und dann wurde sie von einem Weinkrampf geschüttelt.
Der Doktor strich ihr beruhigend übers schweissnasse Haar. «Nun sag schon, was mit dem Brüderchen ist.»
«Er stirbt», schluchzte Hanna. Sie reichte ihm das zerknüllte Blatt, das ihr Madame Staehelin mitgegeben hatte.
Karl Alioth las die Zeilen. «Er ist also die Treppe hinuntergestürzt?»
«Er ist ohne Besinnung und blutet aus den Ohren und dem Mund und der Nase, soll ich Euch ausrichten», stammelte das Mädchen.
Der Doktor nickte. «Sag dem Knecht, er soll das Pferd satteln», bat er seine Frau. «Ich werde inzwischen die Tasche mit den Medikamenten holen. Und dich nehme ich zu mir aufs Pferd», sagte er zu Hanna. «Unterwegs kannst du mir dann nochmals genau erzählen, was passiert ist.»
Die nächsten Tage wurden für Hanna zu einem einzigen Albtraum. Sämi lag in einer verdunkelten Kammer in Madame Staehelins Wohnung. Der Doktor hatte einen Schädelbruch diagnostiziert und verschiedene Anordnungen getroffen. Er hatte Madame ein Fläschchen mit einer Opiumtinktur gegeben und sie angewiesen, Samuel alle paar Stunden davon fünf Tropfen einzuträufeln. Es gehe darum, ihn stillzulegen, er dürfe sich so wenig wie möglich bewegen. Nur sie dürfe zu ihm. Vielleicht noch ab und zu die Mutter, sonst aber niemand. Samuel brauche Ruhe, absolute Ruhe, ausserdem höchstens Dämmerlicht. Er dürfe auch keine feste Nahrung bekommen. Fleisch- und Gemüsebrühe, das schon, und vor allem Schafgarbentee, den man auch Blutstilltee nenne oder, wie das seine Mutter getan habe, «Heil der Welt». Man müsse ihn mit Honig süssen, denn er schmecke bitter. Aber die zarten, weissen Blüten, die man auf jeder Wiese finde, würden das Blut reinigen und den Kreislauf anregen, hatte er erklärt. Im Übrigen müsse man der Natur ihren Lauf lassen. Wie sich die Sache entwickle, liege in Gottes Hand. Samuel könne sterben oder genesen. Aber auch dann müsse man abwarten, ob keine Schädigung des Hirns zurückbleibe. «Aber davon sagt Ihr den Eltern besser nichts», hatte er Madame Staehelin geraten. «Falls das Schlimmste eintrifft, werden sie es noch früh genug erfahren.» Er selber werde regelmässig vorbeikommen, um nach dem Kleinen zu sehen.
Die Eltern kam es hart an, ihren Jüngsten in der Obhut und Pflege von Madame Staehelin zu belassen, aber sie wagten nicht, gegen die Anweisungen des Doktors aufzubegehren. Beim Abendbrot schöpfte die Mutter schweigend den Haferbrei aus der Schüssel. Alle erhielten ihre Portion. Nur Samuels Teller, den Barbara aufgetischt hatte, blieb leer. Sie mochte sich einreden, solange man auch für den Jüngsten den Tisch decke, bleibe er am Leben. Für Hanna allerdings war dieser leere Teller ein stummer Vorwurf. Niemand sprach mit ihr. Niemand beachtete sie, als Tränen auf ihren Brei tropften. Sie würgte ihr Essen hinunter. In der Nacht weinte sie sich in den Schlaf. Sie biss ins Kissen, um Martha, die mit ihr die Kammer teilte, nicht aufzuwecken. «Hättest du nicht besser aufpassen können?», hatte die grosse Schwester gefragt.
«Hättest du nicht besser aufpassen können?», wollten am nächsten Morgen die beiden Brüder, Peter und Paul, wissen.
Der Vater sagte nichts. Er schaute sie nur an. Vorwurfsvoll? Hanna war überzeugt, dass er ihr die Schuld an Sämis Unfall gab. Sie täuschte sich. Mathis Jacob, dessen heimlicher Liebling sie war, ahnte, wie es in seiner Tochter aussah. Er hätte es aber weder ausdrücken können, noch hatte er je gelernt, dass man anderen mit einem guten Wort wenigstens einen Teil der Last, die jetzt seine eigene Tochter zu erdrücken drohte, von der Seele nehmen konnte.
Auch die Mutter sprach nicht mit ihr. Sie behandelte sie wie Luft. «Sag ihr», wies sie Martha an, «sie soll hinaufgehen und ihre Arbeit machen.»
Hanna schlich mit hängendem Kopf davon. Am Fuss der Treppe waren noch Blutflecken. Sie holte draussen am Brunnen einen Kessel Wasser und schrubbte den Boden, bis nichts mehr zu sehen war.
Madame Staehelin stand oben und schaute ihr zu. Dann befahl sie ihr, die Nachttöpfe zu leeren und die Wohnung zu putzen. «Später gehst du mit Salome nach draussen und pflückst mit ihr einen Strauss Schafgarben. Ich brauche die Blüten für Samuel.» Ihre Stimme klang wie immer, gleichgültig, so, wie man eben mit einer Magd sprach.
«Wie geht es ihm?», wagte Hanna zu fragen.
«Er hat die Nacht überstanden. Geh jetzt an deine Arbeit.» Die Frau verschwand in der Kammer, in der Sämi lag.
Hanna quälte sich mit Vorwürfen. Hätte sie den Kleinen doch nicht am Arm festgehalten, dann hätte er sich nicht losreissen müssen und wäre nicht die Treppe hinuntergestürzt. Wenn sie nach Waldenburg hinuntergeschickt wurde, um bei Pfarrer Grynäus die von Madame Staehelin gelesenen Bücher zurückzugeben und neue mitzunehmen, so drückte sie sich mit gesenktem Kopf den Häusern entlang durch die Strassen. Sie war überzeugt, gezeichnet zu sein, so wie Kain, der seinen Bruder Abel erschlagen hatte, von Gott gezeichnet worden war. Sie glaubte, jedermann könne erkennen, dass sie schuldig war.
Nachts schreckten sie Träume aus dem Schlaf, der sie nur für kurze Zeit erlöste. Immer wieder überschlug sich Sämi vor ihren Augen auf der Treppe und blieb regungslos liegen. Manchmal schrie sie auf. «Sei still!», fauchte dann Martha, die schlafen wollte. Hanna mochte kaum mehr essen. Niemand kümmerte sich darum.
Einmal, als er auf Krankenvisite kam, bemerkte der Doktor das Mädchen, das im Hof stand und ihn mit grossen Augen verzweifelt ansah. «Was ist denn mit dir, Hanna?», fragte er, erschreckt über ihr blasses Aussehen. «Du wirst doch nicht etwa auch krank sein?»
Es war seit Tagen das erste Mal, dass jemand ein Wort an sie richtete, in dem eine gewisse Wärme lag. Sie schlug die Hände vors Gesicht und begann zu weinen.
«Na, na», brummte der Arzt. Er legte den Arm um ihre schmalen Schultern, führte sie zur Bank vor dem Haus und liess sie neben sich ausweinen. «Willst du mir nicht sagen», fragte er endlich, «was dir so grossen Kummer macht?»
«Ich bin schuld, wenn Sämi stirbt!», brach es aus ihr heraus, und schniefend erklärte sie dem Doktor, dass sie doch nicht gewollt habe, dass der Bruder die Treppe hinunterfalle. Sie habe doch versucht, ihn zurückzuhalten.
Der Arzt, der ein einfühlsamer Mensch war und wusste, wie sehr sich eine Kinderseele quälen konnte, zog Hanna näher an sich und strich ihr über den Kopf. «Du bist nicht schuld.» Er betonte jedes einzelne Wort. «Du bist nicht schuld.»
Er blieb noch eine Weile neben ihr sitzen. «Ich muss jetzt zu deinem kleinen Bruder», sagte er schliesslich. «Er wird den Schädelbruch überleben, aber ich weiss noch nicht, ob er sich völlig erholt.» Dann fasste er Hanna unter dem Kinn und zwang sie, ihn anzuschauen. «Aber denk immer daran: Du bist nicht schuld.» Er strich ihr nochmals über den Kopf und stand dann auf.
Eine halbe Stunde später beobachtete Hanna, wie der Doktor unter der Haustüre mit den Eltern und Madame Staehelin sprach. Sie sahen immer wieder zu ihr hinüber. Als er ging, winkte er ihr zu.
Von da an redete die Mutter wieder mit ihr. Sie tat, als sei nichts geschehen. Auch der Vater strich ihr jetzt wieder ab und zu über die Wangen, so verlegen wie vor dem Unglück, denn er hatte seine Gefühle nie zeigen können. Hanna lächelte verstohlen. Zum ersten Mal seit langem.
Und dann, vier Wochen nach dem schrecklichen Unfall, kam jener Tag, an dem Madame Staehelin die Tür zu Samuels Kammer öffnete und Hanna zu sich rief. «Der kleine Mann scheint jetzt wieder hergestellt zu sein. Jedenfalls hat er mich erkannt und dann nach dir verlangt. ‹Wo ist Hanna›, hat er als Erstes gefragt. Er will dich sehen, nicht die Mutter, nicht den Vater, nur dich.»
5
Zu Silvester 1790 lag das Land am Oberen Hauenstein unter einer dicken Schneedecke. Auf den Waldweiden waren Spuren von Wildtieren zu erkennen, die sich nachts, getrieben von der Hoffnung auf etwas Essbares, in die Nähe des Hofs wagten. Die bizarren Felsformationen auf der Gerstelfluh trugen weisse Kappen. Auch auf den Ästen der Bäume lag Schnee.
Tags zuvor war überraschend Dorothea Staehelin mit Salome eingetroffen. Die Kutsche ihres Bruders hatte in Waldenburg umkehren müssen. Die Passstrasse war vereist und nicht befahrbar. So waren sie, in Begleitung des Knechts von Pfarrer Grynäus, der ihr Gepäck trug, zu Fuss nach Sankt Wendelin hinaufgestiegen. Sie wolle das alte Jahr auf ihrem Hof ausklingen lassen und hier auch die ersten Tage des neuen verbringen, hatte sie gesagt.
Mathis befahl Hanna, den Kachelofen in der oberen Wohnung einzuheizen. Einstweilen wärmten sich Mutter und Tochter in der Stube der Jacobs auf. Während Barbara Glühwein und Gebäck auftischte, kramte Madame Staehelin die üblichen Geschenke aus ihrer grossen Reisetasche: Tabak, Likör und Süssigkeiten. Für Samuel aber hatte sie etwas Besonderes mitgebracht: eine für seine Grösse passende Uniform der Basler Landmiliz mit dunkelblauen Hosen und einem dunkelblauen Frack mit scharlachroten Auf- und Überschlägen. Dazu einen schwarzen Dreispitz, Gamaschen, ein weisses Bandelier sowie Flinte und Säbel aus Holz. Sie half Samuel, die Sachen anzuziehen. «Ist er nicht ein süsser Soldat, mein kleiner Goldschatz?», wandte sie sich an die Eltern. «Er wird gewiss einmal ein schmucker Offizier.»
Mein kleiner Goldschatz. Mein! Barbara Jacob hob die Brauen. Dorothea bemerkte es nicht. Sie liess den kleinen Burschen in der Stube auf und ab marschieren. «Links – links – links!», kommandierte sie lachend. Salome klatschte in die Hände.
«Das sollte jetzt reichen. Er wird das Exerzieren noch früh genug verfluchen», sagte schliesslich Mathis. «Und Offizier wird er auch nicht, höchstens Sergeant.» Er wusste, wovon er sprach. Es gehörte zu den Pflichten der leibeigenen Baselbieter, im Krieg ihre Haut für die Obrigkeit zu Markte zu tragen. Jeder Mann zwischen dem sechzehnten und sechzigsten Altersjahr hatte in einem der beiden Regimenter der Landmiliz Dienst zu leisten. An bestimmten Sonntagen wurden sie nach der Predigt auf dem Gemeindeanger gedrillt. Die Offizierslaufbahn war ausschliesslich Stadtbürgern vorbehalten.
Mit Ausnahme von Salome und Samuel, die man in der Obhut von Hanna zurückliess, nahmen die Leute von Sankt Wendelin in der Silvesternacht den weiten Weg zur Kirche unter die Füsse.
Pfarrer Grynäus legte seiner Predigt Vers acht aus dem siebten Kapitel des Matthäusevangeliums zugrunde: Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Er zitierte aus dem Bittbrief, den die Liestaler Bürgerschaft im Juli des vergangenen Jahres an die Basler Obrigkeit gesandt hatte, in dem sie den vor Monaten eingereichten und immer noch nicht behandelten Antrag des Ratsherrn Abel Merian unterstützten und unsere Gnädigen Herren demüthigst gebeten hatten, Hochdieselben möchten dero Unterthanen die Leibes Freÿheit und mit Verbundenes in Gnaden schenken.
«Denn wer da bittet, der empfängt», wiederholte Theophil Grynäus den Predigttext, um dann mit bewegter Stimme zu erklären, der Rat der Stadt Basel habe vor vier Tagen, am 27. Dezember 1790, beschlossen, dass die Leibeigenschaft, mit welcher die Landleute der Stadt zugethan sind, aufgehoben und zernichtet sey und sie nebst ihren Nachkommen auf immer leibsfreye Unterthanen erklärt seyn.
Grynäus hielt inne und liess den Blick über seine Gemeinde schweifen. Erwartete er Beifallskundgebungen? Auch der Landvogt musterte neugierig die Gesichter der Leute, in denen weder Freude noch Ablehnung erkennbar waren.
Dorothea Staehelin war berührt. Ihr schien, die Obrigkeit habe mit der Abschaffung der Leibeigenschaft die Zeichen der Zeit erkannt und das wichtigste Postulat der Menschenrechte erfüllt. Sie suchte unter den Gläubigen, drüben auf der Männerseite, ihren Pächter, dem sie die neue Freiheit von Herzen gönnte. Aber Mathis Jacob hatte die Arme vor der Brust verschränkt und starrte finster zum Pfarrer hinauf. Und als dieser zögernd hinzufügte, dass alle bisherigen Verpflichtungen der Landleute gegenüber der Stadt auch in Zukunft zu erfüllen seien, lächelte er spöttisch.
Als Mathis am Neujahrsmorgen 1791 mit zwei grossen Kesseln Milch aus dem Stall trat, wo er mithilfe von Peter und Paul seine drei Dutzend Kühe gemolken hatte, sah er, wie Sämi in seiner neuen Uniform mit geschultertem Holzgewehr hinter Salome über den Hof marschierte. Mathis schüttelte den Kopf und wandte sich dem Abgang zum Käsekeller zu, aber Dorothea Staehelin vertrat ihm den Weg.
«Vielleicht wird er jetzt, wo die Baselbieter die Freiheit erlangt haben, doch einmal Offizier, was meint Ihr?»
«Freiheit?!» Er lachte unfroh. Dann stellte er die beiden Kessel auf den Boden. Man wisse schon seit zwei Tagen vom Erlass des städtischen Rats. Ein Wort habe man gestrichen, ein einziges Wort, mehr nicht. Alles andere sei geblieben. Er zählte auf: «Die Bodenzinsen, den Zehnten, die Taxen für jeden Wisch, den der Landvogt schreibt, die Ehesteuer, die Waldgebühren, selbst das Fasnachtshuhn. Auch den Frondienst gibt es noch. Wenn es Strassen und Brücken zu reparieren gilt oder wenn etwas im Schloss in Ordnung gebracht werden muss, dann interessiert es die Obrigkeit einen Dreck, ob wir mitten in der Ernte sind oder nicht. Wir bleiben Untertanen. Wir haben zu schweigen und zu gehorchen. Auch die politischen Rechte will man uns nicht gewähren.»
«Politische Rechte?» Dorothea war schockiert. Es war für sie unvorstellbar, dass ungebildete Bauern im Rat mitreden und mitbestimmen wollten.
«Das Gesetz ist der Ausdruck des allgemeinen Willens», zitierte Mathis Artikel sechs der Menschenrechte. «Alle Bürger haben das Recht, persönlich oder durch ihre Vertreter an seiner Gestaltung mitzuwirken. Glaubt Ihr, man habe das in Basel begriffen?», fragte er.
Erneut stellte Dorothea fest, dass man die Menschenrechte auf der Landschaft wohl besser kannte, als manchem Ratsherrn lieb sein mochte. «Man kann nicht alles auf einmal haben», sagte sie. Und als ob sie spürte, dass das ein ungeschicktes Argument war, fügte sie hinzu: «Immerhin kann der Landvogt Eure Söhne, wenn sie sich einmal verehelichen wollen, nicht mehr so schikanieren, wie Euch Franz Brodbeck vor Eurer Heirat schikaniert hat.»
Mathis’ Gesicht verfinsterte sich. Die Erinnerung an jenen demütigenden Vorfall im Schloss war eine offene Wunde, die nicht verheilen wollte. Er bückte sich und nahm seine beiden Milchkessel wieder in die Hände. «Freiheit», sagte er. Es klang, als ob er ein Lachen unterdrücke. Dann stieg er die Treppe zum Käsekeller hinunter.
Sie sah ihm nach. Nicht zum ersten Mal zog sie den Vergleich zwischen diesem stattlichen, ernsthaften Mann, der sich über so vieles Gedanken machte, und ihrem ehemaligen Gatten, der als vermögender Schürzenjäger ein Lotterleben führte. Sie seufzte. Hatte Barbara Jacob, diese Landpomeranze, das bessere Los gezogen als sie, die reiche Fabrikantentochter?
Am frühen Morgen des sechsten Januars wurde Dorothea von hellen Kinderstimmen geweckt, die ein Lied sangen:
Die Heiligen Drei Könige mit ihrigem Stern,
sie sueched den Heiland und hätten ihn gern.
Sie ritten zusammen das Rainele us,
sie kamen vor König Herodesse Hus.
Sie stieg aus dem Bett und trat im Hemd ans Fenster ihrer Kammer. Mit ihren warmen Händen taute sie die Eisblumen auf, die sich in der Nacht am Glas gebildet hatten. Am Himmel leuchtete hell und klar der Morgenstern.
Vier Kinder standen vor dem Haus. Ein etwa fünf oder sechs Jahre altes Mädchen hielt einen Stecken, an dem ein Stern aus Karton befestigt war. Hinter ihm standen ein etwas älterer Knabe und zwei halbwüchsige Mädchen, von denen eines eine Fackel trug. Die drei Grösseren hatten farbige Tücher um ihre Schultern gelegt und trugen gelb bemalte Kronen auf dem Kopf. Das Gesicht des Jungen war geschwärzt.
«Warum singen die Kinder?» Auch Salome war erwacht und drängte sich jetzt an die Mutter.
«Das sind die Heiligen Drei Könige», erklärte Dorothea. «Sie bitten um eine milde Gabe für arme Kinder oder für sich und ihre Familien. Aber sei jetzt still, hör lieber zu.»
Herodes schaute zum Fenster hinaus:
Ihr Herren Gesellen wo wöllet ihr hin?
Nach Bethlehem führt uns unser Stern,
wir wollen Maria und s Chindeli sehn.
Drüben im Wohnzimmer rumorte Hanna, die den Ofen einheizte.
«Komm herüber, Mädchen», rief Madame Staehelin. Als Hanna unter der Türe stand, fragte sie: «Wer sind die kleinen Sternsinger da unten?»
«Das sind dem Schuh-Heini seine. Sie kommen jedes Jahr hierher.»
Dorothea wusste, dass mit dem Schuh-Heini Heinrich Bidert, der Schuhmacher in Bärenwil, einem Weiler südlich von Langenbruck, gemeint war. Sein Einkommen war schmal, und er musste sich, um seine vier Kinder durchzufüttern, als Tagelöhner ein Zubrot verdienen. Das Dreikönigssingen war für die Familie wohl ein hochwillkommener Brauch.
Jetzt trat der kleine Samuel Jacob aus der Türe. Er schleppte einen grossen Korb mit sich, dessen Inhalt mit einem weissen Tuch zugedeckt war. Er stellte ihn vor die Sternenträgerin.
«Was mag da drin sein?» Dorothea verfolgte die Szene, die sich vor ihren Augen abspielte, aufmerksam.
«Eine halbe Speckseite, Würste, ein Käse, Butter, Birnen- und Apfelschnitze hat die Mutter gestern Abend hineingetan», zählte Hanna auf. «Und der Vater hat für den Schuh-Heini Tabak und eine Flasche Likör dazugelegt. Er solle auch einmal eine Freude haben, hat er gesagt.»
«So, so, Tabak und Likör», murmelte Madame Staehelin. Dann gab sie sich einen Ruck. Sie ging zur Truhe und holte einen Louis d’or heraus. Die Bidert-Kinder wandten sich mit ihrem Korb bereits zum Gehen. Dorothea drückte Hanna die Goldmünze in die Hand. «Lauf, Mädchen, und gib das dem Buben! Seine Eltern werden es brauchen können.»
Sie beobachtete, wie Hanna dem Mohren das Geldstück, das gegen vierzehn Pfund wert war, übergab.
Der Junge rief seine drei Schwestern zurück und zeigte ihnen, was er erhalten hatte. Und während das Goldstück von Hand zu Hand wanderte, sprachen alle aufgeregt auf Hanna ein, die mit der Hand zum Fenster wies, hinter dem Dorothea Staehelin und Salome standen. Sie winkten der vornehmen Dame und ihrer Tochter und zogen mit ihren Schätzen weiter.
Da Dorothea an diesem Dreikönigstag in die Stadt zurückfahren wollte, bat sie ihren Pächter, sie und Salome nach dem Frühstück nach Waldenburg zu bringen. Der Kutscher ihres Bruders sei noch immer nicht in der Lage, mit seiner Chaise den Weg über die vereiste Hauensteinstrasse zu bewältigen. Sie habe ihm deshalb ausrichten lassen, um elf beim Pfarrhaus auf sie zu warten.
Mathis spannte eines seiner beiden kräftigen Pferde vor den Schlitten, auf dem er zuvor das Gepäck von Mutter und Tochter verstaut hatte. Gegen zehn Uhr war er so weit. Madame Staehelin und Salome verabschiedeten sich von Barbara und den Kindern. Dorothea hob Samuel, der sich seit Silvester nicht mehr von seiner Uniform hatte trennen wollen, hoch: «Auf Wiedersehen, bis im Sommer, mein kleiner Soldat.» Sie küsste ihn auf beide Wangen.
Es war kalt. Seit dem frühen Morgen waren Wolken aufgezogen, und nun fielen die ersten Schneeflocken. Eine Decke über den Knien, in warme Mäntel gehüllt, Fäustlinge an den Händen und Pelzmützen auf dem Kopf, sassen Mutter und Tochter eng aneinandergedrängt hinter Mathis Jacob im Schlitten. Man schwieg. Dorothea betrachtete die breiten Schultern des Bauern. Ihr wurde bewusst, dass sie seit der Scheidung nie mehr etwas mit einem Mann gehabt hatte. Errötend schob sie den Gedanken beiseite. «Ich möchte wissen», sagte sie schliesslich, «was in Eurem Kopf vorgeht?»
Er nahm sich Zeit mit der Antwort. «Ich frage mich, was Heinrich Bidert wohl sagen mag, wenn ihm seine Kinder einen Louis d’or vom Sternensingen nach Hause bringen.»
«Er wird sich freuen, hoffe ich.»
«Seid Ihr sicher?»
Dorothea glaubte, einen leisen Tadel zu hören. «Ist es etwa nicht recht, wenn man die Bedürftigen unterstützt?»
«Am Dreikönigstag gibt man Esswaren: Brot, Fleisch, Käse …»
«… oder Likör und Tabak», fügte sie spitz hinzu.
Mathis stutzte. Dann drehte er sich um. Unter seinem Bart schien er zu lächeln. «Oder Likör und Tabak.» Dann wieder ernst: «Aber Geld gibt man nicht. Schon gar nicht so viel. Ein Louis d’or entspricht dem, was Heinrich in einem Monat verdient. Mit einem solchen Almosen nimmt man einem Mann, der tagein, tagaus arbeitet, seine Würde. Glaubt mir, er wird sich wie ein Bettler vorkommen. Es sollte mich nicht wundern, wenn er das Geld in die Armenkasse spendet.»
Dorothea schwieg verstimmt. Man hörte die Schellen am Zaumzeug des Pferds. Landschäftler, dachte sie erbittert. Nichts konnte man ihnen recht machen, weder im Kleinen noch im Grossen: Geschenke gaben sie weiter, und selbst die Abschaffung der Leibeigenschaft genügte ihnen nicht. Nein, sie wollten auch von den Abgaben und Zinsen befreit werden und forderten sogar die politische Mitbestimmung. Sie reckte das Kinn in die Höhe: «Ihr glaubt also, Euer Schuh-Heini habe eine Würde, die er verlieren könnte?»
«Sicher glaube ich das.»
Sie sah, wie sich der Rücken ihres Pächters straffte. «Wenn Ihr Euch da nur nicht täuscht.» Und dann verriet sie ihm, dass ihr Pfarrer Grynäus erzählt hatte, Heinrich Bidert berichte ihm regelmässig über das, was in den Hauskreisen, an denen auch er teilnehme, gesprochen werde.
Mathis entspannte sich. Er wandte sich um und lächelte wie vorhin in seinen Bart. «Kann ich Euch vertrauen?»
«Du weisst, dass ich dich nie verraten würde.» Sie hatte, ohne sich dessen bewusst zu sein, zum vertraulichen Du gewechselt, so wie damals in der Jugendzeit, als sie ihre Geheimnisse miteinander geteilt hatten.
«Wir sprechen vorher miteinander ab, was Heinrich Bidert dem geistlichen Herrn erzählen soll. Schliesslich schreibt der Pfarrer regelmässig Berichte über uns an seine Vorgesetzten in der Stadt.»
«Heisst das, dass ihr in euren Konventikeln …» Dorothea Staehelin stockte. War es möglich, dass Mathis Jacob und seine Freunde bei ihren Versammlungen nicht die Bibel, sondern ganz andere Schriften, vielleicht gar rebellische aus Frankreich lasen und darüber diskutierten?
«Vielleicht heisst es das», sagte Mathis, der ihre Gedanken erriet. «Aber fragt nicht weiter.»
«Maman, was ist ein Konventikel?», wollte Salome wissen, die der Unterhaltung der beiden Erwachsenen staunend gefolgt war, ohne zu verstehen, worüber sie gesprochen hatten.
«Ein Konventikel, Kind, ist ein Kreis, in dem sich fromme Menschen im Namen des Herrn Jesu zusammenfinden.» Sie kämpfte gegen einen Lachreiz. «Meistens wenigstens.» Ihr Blick blieb erneut an Mathis’ Schultern haften.
Sie hatten inzwischen Waldenburg erreicht, und der Wächter am oberen Tor winkte sie durch. Der Bauer lenkte den Schlitten durchs Städtchen zum Pfarrhaus, wo tatsächlich der Preiswerksche Kutscher auf Dorothea und Salome wartete.
Theophil Grynäus trat auf den Hof hinaus, um seine Base zu begrüssen und gleichzeitig von ihr Abschied zu nehmen. Er konnte ihr seltsames Lächeln nicht deuten. Ihm schien, sie amüsiere sich auf seine Kosten, aber er mochte sich täuschen.
Dorothea wandte sich an ihren Pächter: «Ihr wisst, Mathis, dass nichts von dem, was Ihr mir anvertraut, weitergeht.» Sie schaute ihm in die Augen und reichte ihm die Hand. Dem Pfarrer schien, sie halte sie unschicklich lang.