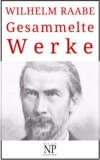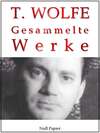Kitabı oku: «Wilhelm Raabe – Gesammelte Werke», sayfa 144
So geht es weiter, immer weiter. Durch schmutzige, verwahrloste Dörfer und Landstädte, durch wüste, menschenleere, verrufene Gegenden, wo jedes einsame Haus einer Räuberherberge gleicht. Aber auch durch große, volkreiche Städte voll bunten Lebens und Getümmels geht die Fahrt. Selten halten die Reisenden an, um die Pferde zu füttern und ruhen zu lassen, noch seltener, um sich selbst zu erquicken, um zu schlafen. Immer fort, immer fort! Es steigen Berge in der grauen Ferne aus der Ebene auf und versinken wieder, – dann steigen sie von neuem empor, näher und höher, aber verhüllt von Nebel und Regen. Nun führt der Weg durch große Wälder, bei deren Durchziehen eine berittene Schutzwache, welche die glimmenden Lunten auf die Fauströhre geschroben hat und die Schwerter in den Scheiden gelockert hält, den Wagen umgibt. Heimatloses, verbrecherisches Gesindel lauert hinter Busch und Baum, bedenkliche Schatten gleiten zwischen den Stämmen den Weg entlang, ein Armbrustbolzen schwirrt einmal aus dem Gebüsch und heftet sich in das Holzwerk des Wagens. Aber glücklich gelangen die Reisenden aus dem wilden, »gnadenlosen« Walde wieder in das Freie, und in der Ferne ragen abermals die Türme einer großen Stadt – einer mächtigen Reichsstadt. Bald rasselt der Wagen durch das dunkle Tor.
»Jesus, Maria und Joseph, schützet uns! Was ist da im Werke?« ruft der Fuhrmann ängstlich.
Aus der Ferne, vom Stadtmarkt her, kracht und knattert ununterbrochen Gewehrfeuer. Schwarze Rauchwolken, von brennenden Gebäuden aufsteigend, wälzen sich über den trüben Himmel. Von den Türmen klingen die Sturmglocken, bewaffnete Haufen durchziehen die Gassen, dringen verwüstend, zertrümmernd mit Hämmern, Äxten, Brecheisen und sonstigem Handwerksgerät in stattliche Häuser. Man trägt Tote und Verwundete vorüber, Banner der Innungen schweben über dem Getümmel: auf Tod und Leben kämpft das Bürgertum, das Plebejertum gegen den Rat, gegen die Patrizier.
Aber nichts vermag die drei Reisenden aufzuhalten; sie bemerken kaum, was um sie her vorgeht, die eben abgespielte Tragödie des deutschen Städtelebens hat nicht den geringsten Sinn für sie. Auf Nebenwegen gelangen sie wieder aus der aufruhrvollen Stadt heraus, und abermals liegt für lange, ermüdende Tage der Weg vor ihnen.
Aber endlich dämmert ein Abend, und das Ziel der Reise ist erreicht!
Im Westen liegt ein blutroter Streif auf dem Horizont und deutet an, wo die Sonne unterging. Abermals windet sich die Straße über eine kahle Ebene, vorüber an trostlosen Wasserlachen und grünlich-fettig schimmernden Sümpfen. Verkrüppeltes, struppichtes Dornengebüsch ist über die ganze Fläche zerstreut; ein schwarzes Fichtengehölz umgibt einen Haufen unregelmäßiger Gebäude, die wiederum von einer hohen, altersgrauen Mauer umzogen sind. Über die Gipfel der Bäume und die langen, an den Giebelenden mit Kreuzen geschmückten Dächer ragt ein hoher, spitzer, mit Schiefer gedeckter Kirchturm.
An einem verschlossenen Tore, über welchem in einer Mauernische ein Heiligenbild verwittert, hält der Wagen.
»Gottlob, dass das vorbei ist!« murmelt der Fuhrmann.
Der Jüngere der Reisenden steigt zuerst aus dem Fuhrwerk, zieht einen Glockenstrang, und gellend ertönt es in der Ferne. Nach geraumer Zeit öffnet sich dann eine Klappe in der Tür, und der Kopf einer alten Frau, einer Nonne, erscheint vorsichtig in der Öffnung.
»Gelobt sei Jesus Christ!« erschallt der Gruß des jungen Fremden.
»In Ewigkeit, Amen!« antwortet die Schwester Pförtnerin. »Was beliebt euch, ihr Herren?«
Auch der Greis ist nun aus dem Wagen gestiegen und führt seine Begleiterin, über deren Körper fortwährende Fieberschauer zu laufen scheinen, mit sich gegen die Tür. Er verlangt die Äbtissin zu sprechen; die Nonne verschwindet, die Klappe schließt sich wieder und öffnet sich erst nach langem Harren abermals, um die Nachricht herauszulassen: man erwarte die Wanderer und bitte den Meister Benedictus Meyenberger mit seiner Begleiterin einzutreten.
Die Tür erschließt sich nun, und der Alte verschwindet mit dem zitternden jungen Weibe hinter ihr. Der jüngere Mann, fröstelnd in seinen Mantel sich hüllend, bleibt neben dem Wagen und dem Fuhrmann zurück. Tausend wechselnde Empfindungen bewegen seine Brust, während er der Zurückkunft des Alten wartet. Und lange, lange Zeit muss er harren, und immer finsterer wird sein Blick, und immer schmerzhafter werden die Seufzer, welche sich seiner Brust entringen. Der Abend wird dunkler und stürmischer, eisigkalte Tropfen schlagen – wieder vereinzelt hernieder – – endlich, endlich öffnet sich die Tür und dreht sich kreischend und knirschend in ihren verrosteten Angeln.
Wankenden Schrittes, mit Tränen in den Augen, erscheint der alte Mann auf der Schwelle.
Er ist allein!
Nur die Schwester Pförtnerin geleitet ihn, diesmal mit einer Laterne versehen.
In die Arme Simone Spadas fällt der Meister Meyenberger – er weint laut auf, und der junge Mann weint ebenfalls – Fausta La Tedesca ist hinter den dunkeln, hohen Klostermauern zurückgeblieben – lebendig begraben, dass sie Buße tue und gerettet werde für die Ewigkeit! …
Auf dem spitzen Turme der Klosterkirche ruft die Glocke die geistlichen Jungfrauen soeben feierlich zum Gebet; die Fenster der Kirche, soweit man sie über die Mauer weg zu sehen vermag, haben sich erhellt, der Gesang der Nonnen tönt an das Ohr der beiden trauernden Männer, welche einen Augenblick noch stumm, mit gesenkten Häuptern lauschen und dann wieder in den Wagen steigen.
Dem Fuhrmann wird ein Wink gegeben; er wendet den Wagen und treibt die Pferde an. Das Fuhrwerk rollt in die Nacht davon.
Der Wind wird zum Sturm, die Regentropfen verwandeln sich in scharfe Eisteilchen – wie es heult und klagt und pfeift und grollt und lispelt und zischt um das einsame Kloster! Wie die Fenster erklirren unter den Stößen des Windes! Wie der Sturm sich fängt in den langen Kreuzgängen; wie er dem lauschenden Ohr jetzt eine Strophe des traurig ernsten Gesanges der Nonnen entführt, jetzt eine andere Strophe auf seinen Flügeln desto kräftiger und klangvoller herträgt!
Und in einer engen, öden, kalten Zelle sitzt Fausta – Fausta, der Nachtstern von Venedig – Fausta, die Schöne, die Stolze, welche den Tizian unter ihre Bewunderer zählte – Fausta, la falsa Maga – Fausta, die grenzenlos Elende!
Nicht mehr bereiten ihr alle Künste des Orients und des Okzidents das wollüstige Lager – nicht mehr harren Diener und Dienerinnen, nicht mehr vornehme Kavaliere, berühmte Dichter und Künstler ihres Winkes; machtlos, gefesselt ist die kleine, feine, weiße Hand, welche Vecelli am liebsten seinen Göttinnen und Heiligen gab auf der Leinwand! Neben dem ärmlichen Lager der eingeschlossenen Fausta steht ein Wasserkrug, liegt ein hartes schwarzes Brot; eine blutgerötete Geißel hängt von der Wand, die Geißel, womit die Vorbewohnerin dieser Zelle sich zerfleischte; auf dem rohgezimmerten Gebetpult liegt ein Totenkopf neben dem Rosenkranz und Breviarium und starrt aus seinen hohlen Augenhöhlen die große Sünderin – magna peccatrix – Fausta La Tedesca an! ……
Und – »Frei, frei, frei!« ruft Fausta La Tedesca und hebt die Arme und holt Atem aus voller Brust, und draußen wogt und wallt der silberne Mondnebel magisch über den Bergen und Wäldern, Wiesen und Halden von Pyrmont, und in ihrer schönsten Blüte duftet und leuchtet die deutsche Sommernacht.
Gleich einer Tigerin schreitet das Mädchen hin und her auf der glänzenden Bahn, welche der Mond durch das Turmgemach zieht. Mit einer wilden Bewegung wirft sie die schwarzen Haarflechten über den Nacken zurück. Sie ballt die rechte Hand:
»Frei, frei, frei! Wer will mich halten in Ketten und Banden? Ohnmächtiger Simone!«
Sie lacht; aber schauerlich klingt das Lachen in der stillen Nacht. Sie scheint selbst unheimlich dadurch berührt zu werden, hält in ihrem Gange inne, setzt sich nieder auf das Lager und stützt das feine Kinn sinnend mit der Hand.
Lange sitzt sie so; der Mond ist hinter die Berge gesunken, der Nebel hat sich dichter zusammengezogen; das Frösteln, welches beim Anbruch des Tages den, welcher die Nacht schlaflos hinbrachte, überkommt, überfällt auch die schöne Fausta.
Noch einmal springt sie empor:
»Niemand, niemand soll mich fesseln und halten! Unglück und Verderben denen, welche es versuchen! Es ist wahr, unter einem bösen Stern bin ich geboren; aber es ist mein Stern, und er soll mich leiten. Und leitet er mich nicht gut? Und verwirrt und vernichtet er nicht die, welche mich aufhalten und mich irren wollen auf meinen Wegen? Verderben dir, Simone von Bologna! Verderben dir –«
Sie fährt zusammen und spricht den zweiten Namen, dem sie flucht, nicht aus. Abermals tritt sie an das Fenster.
Draußen ist alles grau und öde; aller Schein und alles Licht ist erloschen, der Horizont hat sich verengt, die Berge sind verhüllt, die verglimmenden Feuer des schlafenden Volkes um den heiligen Born gleichen festgebannten Irrlichtern auf einem großen Kirchhofe oder einem eben begrabenen Schlachtfelde.
»O, du Herr dieses Schlosses, o du Herr dieses Landes, hüte dich! – Der arme Tor, der sich selbst nicht hüten konnte, hat dich gewarnt; aber es soll ihm und dir nichts helfen, Signor Conde. Mein sollst du werden, mein Sklave sollst du werden, Signor Conde; und den Fuß will ich dir auf den Nacken setzen, wie allen anderen. Da kommt der Morgen! Gestern noch glaubte ich, sterben zu müssen, und heute – heute – ah, ich lebe noch, ich atme noch – wer fesselt und hält die Fausta, die Glückliche? – Siegen will ich und die Sonne sehen, ich, Fausta, Fausta die Glückliche, und mein Stern möge über mir leuchten!« – – –
Im Osten leuchtete es rot über den Bergen, und als die sengende Sonne des Jahres fünfzehnhundertsechsundfünfzig ihre ersten Strahlen über das Tal von Pyrmont sandte und das Lager des Volkes am heiligen Born zu neuem Leben erwachte, als alle Träume des Schlosses Pyrmont zu einem Ende gekommen waren, als Turmwärtel und Kellermeister sich den Schlaf aus den Augen gerieben hatten, als Frau Hedwig von Brandenburg, geborene Prinzessin von Polackien, Gott gedankt hatte, dass ihr allergnädigster Traum nur Traum gewesen sei, als Fräulein Ursula mit beiden Füßen aus dem Bett und in ihr saueres Tagewerk hineingesprungen war, als Fräulein Walburg, rot wie ein Röslein, erwacht war mit einem kleinen Schrei über einen hübschen Schluss ihres Traumes, als Philipp von Spiegelberg seufzend sich wiedergefunden hatte im Licht des neuen Tages: schlummerte Fausta La Tedesca tief und fest und träumte nun selbst einen wirklichen Traum.
In die Zukunft führte sie dieser Traum, und ein Lächeln spielte um die Lippen der Schläferin. Sie träumte, dass sie frei sei, trotzdem dass sie eine Gefangene war auf dem Schloss Pyrmont.
Achtes Kapitel
handelt von Zauberern, Zauberinnen und Verzauberten.
Es war ein gläubiges, ungläubiges, abergläubiges Jahrhundert, dieses sechzehnte nach Christi Geburt! Selbst in den aufgeklärtesten, hellsten Köpfen schlangen sich Licht und Finsternis zu so seltsamem Knäuel zusammen, dass man nie wissen konnte, welche tollen, fantastischen, verrückten oder – erhabenen Gedanken, Meinungen, Taten im nächsten Augenblick daraus emporschlagen würden.
Das siedete, kochte, brodelte, warf Blasen, sprühte Funken und flammte hier in leuchtenden, fantasmagorischen Farbenspielen auf, um dort in tiefster Finsternis zu versinken! Das Banner der religiösen Freiheit wird aufgeworfen, die Gewalt und Autorität des Papstes und seine Macht, »zu binden und zu lösen im Himmel und auf Erden«, wird siegreich angegriffen, die Rechtfertigung soll nicht mehr an das Individuum von außen kommen; aus dem Staub und Schutt der Jahrtausende wühlt und gräbt man die Pracht der versunkenen antiken Welt ans Licht zurück und – errichtet Scheiterhaufen und verbrennt Hexen. Ewig schöne Bilder und Gedichte werden geschaffen und – Volksleben und Gesellschaft sind dabei fast in Tierheit durch roheste Genusssucht verfallen! – Es war die Zeit der großen Gärung, die Zeit des Zersetzungsprozesses, der später seine Krisis im Dreißigjährigen Kriege fand, in welchem der morsche Bau des Mittelalters krachend zusammenbrach, damit aus der Blut- und Schmutzpfütze, aus dem gebirghohen Trümmerhaufen eine andere Welt mit anderen Anschauungen sich erheben könne. – –
Das Treiben und Wesen um den heiligen Born zu Pyrmont war im kleinen ein treues Bild jener Zeit, alle Elemente der geistigen und körperlichen Lebensbedingungen des Jahrhunderts wirbelten in dem abgelegenen Waldtal durcheinander und flossen zusammen in einem Hexensabbat sondergleichen.
Hinein in das bunte Gewirr und Gewimmel!
Müde und abgespannt erwachte Graf Philipp von Pyrmont aus seinem kurzen Schlummer und seinen bösen Träumen. Schnell kleidete er sich an und stieg, nachdem er seine Lieblingsbüchse von der Wand genommen und sie über die Schulter geworfen hatte, hinab in den Hof, um vor Sonnenaufgang die Kühle zu genießen. Alles schlief noch innerhalb der Ringmauer bis auf Klaus Eckenbrecher, welchem die beiden spanischen Kronen des italienischen Arztes das Blut noch viel zu unruhig in den Adern herumtrieben, als dass er es hätte aushalten können auf seinem Lager, Missmutig war er vor einer halben Stunde aufgesprungen und hatte abermals, der Erfrischung wegen, den schwindelnden, wirren Kopf unter das sprudelnde Löwenmaul des Schlossbrunnens gesteckt. Das hatte etwas geholfen, aber nicht ganz. Jetzt war der Reiter beschäftigt, seinen Schecken zu striegeln und zu putzen, während die Kameraden, die Wände entlang, ruhig fortschnarchten.
Wir haben schon angedeutet, dass mit unserm Freund Klaus, seit ihn der Graf zu Pyrmont unter seine Reisigen aufgenommen hatte, eine günstige Veränderung vorgegangen war. Die hohen Hacken der Reitstiefeln erhöhten seinen Wuchs wenigstens um zwei Zoll; der eiserne Halskragen, das Schwert, der spitze Hut, das Spiegelbergsche Wappen auf dem Bruststück des Kollers erhöhten sein Selbstgefühl mindestens um das Doppelte, und dass Klaus Eckenbrecher ein nicht geringes Selbstgefühl auch vor seiner Standesveränderung hatte, wissen wir aus jenem Gespräch mit dem Pastor Fichtner im Pfarrgarten zu Holzminden. Sein größter Kummer nach dem Trennungsleid von seinem Schatz war, dass er es bis zu einem »türkischen Knebelbart« noch nicht hatte bringen können. Übrigens musste man es dem Burschen lassen: er war ein tüchtiger, schmucker Reiter, und die Damen des Schlosses waren vollständig in ihrem Rechte, wenn sie ihn wohl leiden mochten. Aber zu seiner Ehre können wir hiermit verkündigen, dass der Gedanke an die Monika ihn freilich von keiner Tollheit, wohl aber von jeder Schlechtigkeit fernhielt, und das wollte viel sagen in jener Zeit. Auch die Gunst des jungen Grafen, seines Herrn, hatte sich Klaus bald errungen als ein wohlbefahrener Schütz und Jäger. Bald hatte er sich heimisch gemacht in den Wäldern von Pyrmont wie früher im Solling; bald genug wusste er wohl Bescheid zu Lügde, Holzhausen, Östorf, Löwenhausen und Tal; bald genug kannte er Weg und Steg weit und breit umher, jeden Winkel und Eck im Wald und Feld. Dass er aber Weg und Steg in der Grafschaft und darüber hinaus so gut kannte, das hatte er nicht ganz allein den oft sehr kuriosen Aufträgen Herrn Philipps von Spiegelberg und der Jagd zu verdanken, sondern auch zum großen Teil einem unabweisbaren Bedürfnis nach Einsamkeit. Eine Art von Heimweh und Trübsinn überfiel ihn dann und wann; manchmal aus heiterm Himmel, manchmal begründeter wie jetzt, wo sie ihn nach dieser lustigen Nacht, in welcher er die Goldkronen Simons von Bologna auf so höchst vortreffliche und nützliche Weise losgeworden war, überkommen hatte.
Zwischen den Zähnen brummend, sich selbst und die Welt mit den absonderlichsten Beiwörtern belegend, war er eben beschäftigt, seinem Gaul die Hufen zu putzen, als sich die Türöffnung des Stalles durch den Eintritt des Grafen verdunkelte und der Schatten desselben über den niedergebeugten Reiter fiel.
Ärgerlich blickte dieser auf, doch sänftigten sich seine Gefühle, als er seinen Herrn erkannte.
Auf ziemlich formlose Weise begrüßten sich Herr und Diener; dann sagte der erstere:
»Lass den Gaul, Klaus, nimm deine Büchse und löse den Waldmann und den Dachshund von der Kette; wir wollen in den Wald, uns ein Maul voll frischer Luft zu holen, ehe die Sonne kommt; ’s wird wieder eine schöne Hitze werden auf den Tag.«
»Zu Befehl, Herr Graf!« sagte Eckenbrecher, den Hut aufstülpend. Im nächsten Augenblick war er samt dem höchst erfreuten Waldmann und Dachshund bereit.
Der Graf schritt voran; aus seiner Höhle hervor fuhr der schlaftrunkene Torwärter, das Burgtor zu öffnen. Herr Philipp trat mit seinem Knappen hinaus auf den heiligen Anger.
»O du heiliger Gott«, rief der Graf, beim Beginne seiner Wanderung sogleich stehenbleibend. »Ist’s mir nicht jedes Mal, wenn ich die Nase aus dem Loch stecke, als liefe mir eine Spinne darüber oder ein altes Weib oder ein Mönch mir über den Weg? Halb zu Tode ärgere ich mich jedes Mal, wenn ich den Fuß über die Zugbrücke setze. Da schau nur, Bursch, wie das Volk unsern Grund und Boden zurichtet! Der böse Feind hat uns die Plage über den Hals gesandt, und wenn ich für gewiss wüsste, dass ich sie loswürde, wenn ich mich ihm verschriebe, so tät ich’s, bei Gott, ich tät’s!«
Klaus Eckenbrecher zuckte die Achseln:
»Ja, ’s ist wahr, Herr Graf zu Pyrmont, sie tun viel Schaden und zertrampeln alles wie das Vieh; aber – aber, ’s ist doch eigentlich eine gute Gabe und eine große Berühmtheit.«
»Ich pfeife auf die Berühmtheit! Prosit!« schrie der Graf in Wut. »Von Land und Leuten muss ich, wenn das also fortgeht. Kahl fressen sie mich wie die Ratten, und die hier draußen sind noch lange nicht die Allerschlimmsten.«
Klaus Eckenbrecher lächelte schlau und zuckte abermals die Achseln:
»Weiß, wen Ihr meinet, gräfliche Gnaden; aber ich sag’s nicht!«
»Ich auch nicht – ’s hilft auch zu nichts«, brummte Herr Philipp von Spiegelberg und schob das Barett ein wenig zur Seite, um sich bequemer am Hinterkopf kratzen zu können. Dabei blickte er böse über die Schulter nach dem Schlosse zurück und seufzte:
»Das weiß der liebe Gott!«
Um seinen Ärger nicht noch zu steigern und den schönen Morgen sich nicht noch mehr verderben zu lassen, vermied er mit seinem Begleiter das Lager um den heiligen Born und gelangte, indem er einen Bogen um die Zelte, die Hütten und das schlafende Volk machte, unter die ersten, zerstreuten Bäume des Waldes am Bomberg. Hier atmete er freier auf, tat einen Sprung über wenigstens drei Büsche und drang mit den lustig bellenden Hunden und dem Eckenbrecher tiefer in das Gehölz ein. Allmählich schwand nun das Gefühl von Beklemmung, welches seit dem gestrigen Abend auf ihm lastete, der letzte Nachhall des Spukes, den die vergangene Nacht mit ihm getrieben hatte, aus seiner Seele. Laut jauchzte er auf in der Waldesfrische und wunderte sich im geheimen, wie ihn die Erscheinung jener fremden Maid so seltsam hatte erschrecken und erregen können. Fest nahm er sich vor, nach seiner Rückkehr ins Schloss sogleich kurzen Prozess zu machen und das Mädchen noch an diesem selben Morgen dem fremden Arzte, welcher doch wohl recht haben konnte, über die Grenze nachzusenden. Hallo! Hussa! Eifrig folgte der Graf der Spur eines Wildes, welches die Hunde aufgescheucht hatten; aber das Getier, längst verschüchtert durch den ungewohnten Lärm der letzten Zeit, ließ sich nicht mehr so leichtlich überraschen wie früherhin; abgehetzt und schweißtriefend musste Herr Philipp die Jagd aufgeben.
»Weshalb das gute Wasser nur nicht bei den singenden, betenden, glockenläutenden Paderbornschen Pfaffen aufgesprungen ist?« rief er ärgerlich. »Denen wär’s ein gesundes Fressen gewesen! Die hätten es wahrlich besser brauchen können als der Graf zu Pyrmont! Die würden auf ihre Weise schon gesorgt haben, dass sie keinen Schaden dabei litten. Hoho, was haben die Hunde nun wieder? Ich tue keinen Schritt mehr ihnen nach. Ruf sie zurück; Klaus!«
»Sie werden einen Fuchs wittern«; sagte Eckenbrecher und folgte dem Grafen, welcher ungeachtet seines letztausgesprochenen Vorsatzes bereits dem Gebell nachsprang.
Nach fünf Minuten gelangten die beiden jungen Männer auf eine kleine Waldlichtung, wo sich ihren Augen ein unerwartetes Schauspiel darbot. Wütend umkreisten die Hunde ein kleines Zelt, welches hier aufgeschlagen war, und sprangen schnappend gegen einen ältlichen Mann an, welcher sich ihrer mit dem Kolben seiner Büchse kaum erwehren konnte. Ein anderer, jüngerer Mann, mit langem, schwarzem Bart und geschlossenen Augen, gekleidet in ein langes, schwarzes Gewand, welches um die Hüften durch einen feuerroten Gürtel zusammengehalten wurde, saß ruhig unter dem Zelt und schien sich nicht im mindesten um den Kampf seines Gefährten zu kümmern. Zwei Reitpferde und ein Lastpferd waren in der Nähe des Zeltes angebunden und benagten die herabhängenden Baumzweige.
Auf den Ruf ihres Herrn ließen die Hunde von ihren Angriffen ab und zogen sich knurrend hinter den Klaus zurück.
»Wer seid Ihr, und was treibt Ihr hier?« fragte der Graf ziemlich barsch, erbost über diese neue Beunruhigung seines Jagdgrundes. »Wer gab Euch die Erlaubnis, hier Euer Lager aufzuschlagen?«
»Und wer seid Ihr, dass Ihr solche Fragen auf so schnöde Art stellet?« fragte der Mann unter dem Zelte.
»Einer, der Euch hängen kann, wenn es ihm beliebt; Philipp von Spiegelberg, der Graf zu Pyrmont.«
Der Mann, welcher mit den Hunden gekämpft hatte, zog betroffen den Hut ab und trat zurück. Der andere Mann, welcher unstreitig der Herr war, erhob sich.
»Verzeihet, gnädiger Herr«, sprach er, indem er sich mit großer Würde verneigte, »mein Diener hat einen armen, blinden Mann zu schützen. Verzeihet meine Barschheit.«
»Richtig, er ist blind! Wieder jemand, welchem der heilige Born helfen soll!« murmelte Klaus Eckenbrecher.
»Wie nennet Ihr Euch?« fragte der gutmütige Herr Philipp, dessen Zorn sich bereits gelegt hatte.
»Simon, gnädiger Herr.«
»Simon? Wieder ein Simon? Gott schütze uns! … Und was treibet Ihr? Wer seid Ihr?«
»Sie nennen mich Simon den Magier. Ich bin ein Arzt!«
»Alle guten Geister – Klaus Eckenbrecher, ich gehe nicht mehr hervor aus dem Schloss, ohne den Kaplan auf den Fersen zu haben. – Und was wollt Ihr hier, Meister Simon?«
»Die Kranken heilen, die Besessenen befreien, die Bezauberten erlösen! Der Herr hat mir große Macht gegeben.«
»Der Teufel mag Euch große Macht gegeben haben!« brummte Klaus Eckenbrecher, der Skeptiker, leise; aber des Blinden scharfes Ohr hatte die Zweifel an seiner göttlichen Sendung doch vernommen.
»Ich weiß nicht, wer Ihr seid, der da eben sprach: aber – ob vornehm oder gering, hütet Eure Zunge! Der Herr liebt es nicht, dass man seiner Begnadeten spotte.«
Klaus Eckenbrecher, welcher sich vor dem bösen Feinde nicht ganz so sehr fürchtete wie ein Professor der Theologie oder ein Oberkonsistorialrat des neunzehnten Jahrhunderts, tat einen Pfiff und wollte eben antworten, als ihm der Graf zu schweigen befahl.
»Und Ihr wollt auch, weiser Meister Simon, Euere geheime Kunst zeigen am heiligen Born zu Pyrmont?«
»Nicht meine Kunst will ich der sündhaften Welt zeigen, sondern die Gnädigkeit des allerhöchsten Gottes.«
»So will ich Euch nicht hindern. Aber ich selbst warne Euch nun, dass Ihr zuschauet, dass Euch gelehrte und fromme Männer nicht des Teufelsdienstes überweisen. Hütet Euch, ein Holzstoß ist baldigst aufgebaut.«
»Ich werde mich hüten!« sprach der Blinde, und ein unmerkliches Lächeln umspielte seine Mundwinkel.
»Steiget also nieder ins Tal! Ihr sollt mir willkommen sein«, sagte der Graf. »Steigt hernieder, wir sind begierig, Eurer Kräfte und Künste zu genießen.«
Simon der Magier verbeugte sich tief, und der Graf zog sich mit seinem Begleiter zurück. Hätte den beiden die aufgehende Sonne nicht so wohltuend und beruhigend auf die Köpfe geschienen, wer weiß, ob der Herr Graf zu Pyrmont trotz seiner Ritterlichkeit und Meister Klaus Eckenbrecher trotz seiner Wagehalsigkeit nicht ein leises Frösteln über den Körper und ein Kribbeln der Haare unter dem Barett gespürt haben würden. So aber eilten sie festen Schrittes durch den Wald, den Berg hinunter auf dem gradesten Wege dem Schlosse zu. Bald gelangten sie, aus dem Walde hervortretend, zu den Lagerstätten des Volkes, welche der Graf dieses Mal nicht vermied, obgleich nun das lebendigste Leben überall herrschte. Demütig drängte sich das Volk mit abgezogenen Hüten und Mützen an den Weg des Grundherrn und schielte nach einem gnädigen Blick oder einem Almosen. Es erhielt jedoch nichts von beiden, sondern der Graf schleuderte statt dessen mit einigen ärgerlichen Fußtritten verschiedenes Hausgerät, Körbe mit Lebensmitteln, Plunder und schreiende Kinder aus seinem Pfade fort und stieß seinen Büchsenkolben jedem ihm begegnenden arglosen Hunde so nachdrücklich in die Rippen, dass die Bestie jedes Mal heulend davonflog.
Auf diese Weise bahnte er sich seinen Weg und war fast in die Mitte des heiligen Angers gelangt, als ihn ein neues Abenteuer aufhielt. Zwischen dem gewöhnlichen Lärm und Tumult der Menge erklang auf einmal ein durchdringender Schrei, so ungewöhnlich, so schrill und herzzerreißend, dass im nächsten Augenblick sich die tiefste Stille über die drängenden Haufen legte, dass jedes Ohr in Schrecken horchte, ob dieser Schrei sich nicht wiederholen werde.
Wirklich erklang er von neuem, und dann vernahm man einen wunderlichen, wildfremden Gesang, der in kurzen Absätzen von einem gellen, unnatürlichen Gelächter zerrissen wurde. Dann teilte sich dicht vor dem Grafen scheu das Volk, ein kreischendes, singendes, lachendes Weib sprang hervor und begann einen wilden, wahnsinnigen Tanz. Ihre Augen rollten, ihre gelösten Haare flogen, der Schaum stand ihr vor dem Mund. Das Volk sah im höchsten Entsetzen dem schrecklichen Schauspiel zu; der Graf und sein Reiter wussten nichts Besseres zu tun.
Jetzt traten zwei Franziskanermönche, ihre Kreuze in den Händen erhebend, vor die Tänzerin hin, um den bösen Geist, von welchem sie dieselbe besessen glaubten, als tapfere geistliche Ritter zu bannen. Die Kruzifixe hielten sie ihr vor, Beschwörungsworte schrien sie ihr zu.
»Helfet ihr! Helfet ihr!« rief das entsetzte Volk. »Sehet, sehet, es packt sie wieder! O helfet ihr, helfet ihr!«
»Bei der heiligen Dreifaltigkeit, bei den Geheimnissen der Menschwerdung, bei der allerseligsten Jungfrau«, brüllte der eifrigste der Barfüßer, »Satan, maledico te in maledicta tua arte! – ich verfluche dich, Satan, in deiner verfluchten Kunst! Fahre aus, du höllischer Gast, welcher du dieses Weib marterst!«
Wie vom Blitz getroffen stürzte plötzlich das Weib nieder und wand sich in Krämpfen auf dem Boden. Der andere Mönch kniete neben ihr nieder und legte sein am Rosenkranz befestigtes Kreuz auf das Haupt der sich im Staube Windenden:
»Fahre aus, aus, aus, o irreverendissime et irreligiosissime! Hebe dich von diesem Weibe, so du quälest!«
»Komm, Klaus, ich habe genug davon!« rief Herr Philipp von Spiegelberg. »Komm fort, sie laden mir sonst auch noch dieses unglückliche Geschöpf auf. Beim Teufel, das ist ein Segen, der auf mein armes Land gefallen ist! Aus dem Wege, wenn’s Euch beliebt, aus dem Wege sag ich!«