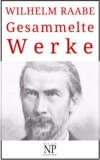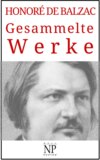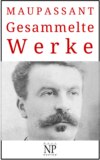Kitabı oku: «Wilhelm Raabe – Gesammelte Werke», sayfa 145
Fort stürzte der Graf, und wiederum erklang hinter ihm der Schrei der Besessenen; atemlos, seufzend und mit den Zähnen knirschend kam der Spiegelberger in den Hallen seiner Ahnen wieder an.
»Elsabe! Jadwiga! Kathinka! Fedora!« klang hier eine leider nur zu wohlbekannte Stimme ihm ins Ohr. Durch die Korridore des Schlosses stürzten die Dienerinnen; Fräulein Ursel von Spiegelberg, ebenso außer Atem wie ihr Bruder, eilte die Treppe empor: ihre kurfürstlichen Gnaden waren von ihrem alten Übel, dem Magenkrampf, befallen worden und schrien aus vollem Halse und höchst gesunden Lungen nach Kraftwassern und heiß gemachten Topfdeckeln.
»Bei meiner ritterlichen Ehre, wenn ich mir nicht vorkomme wie ein Hund voller Flöh und Fliegen, so will ich mich hängen lassen, wie ein –« rief der Graf, die Büchse an die Wand hängend. »O du heiliger Blasius, wie das Frauenzimmer schreit! … Wo ist die Walburg, du Affe?«
Diese letztere Frage galt einem Adelbursen, der ihm in den Weg kam.
»Im Schlossgarten pflückt sie Rosen«, lautete die Antwort, und seufzend sagte Graf Philipp:
»Das Kind ist die einzige, welche noch ein leichtes Herz hat im Schloss Pyrmont; Gott möge es ihr gesegnen! Arme Ursula!«
Trotz seinem Missmut entwickelte der Spiegelberger beim einsamen Morgenimbiss im großen Saale einen tüchtigen Appetit, bis er zufällig in die Tasche griff und das zerknitterte Schreiben des Arztes Simone Spada hervorzog. In demselben Augenblick waren Hunger und Durst vergangen, der letzte Bissen blieb dem Grafen im Munde stecken.
»O, o, o!« sagte er und versank in tiefes Sinnen und Grübeln, aus welchem er mit der Frage erwachte: ob man die Dirne im Turmgemach auch mit allem Nötigen versehen habe?
Der Zauber, den er für alle Ewigkeit abgeschüttelt zu haben glaubte, hatte ihn mit dreimal stärkerer Gewalt gefasst, und vergeblich waren alle Anstrengungen, sich seiner Macht zu entziehen. Auch die übrigen Vorkommnisse des Tages, als da waren; lange, lange, ziffernbedeckte Rechnungen des Haushofmeisters Plückebüdel, lange, lange, schöne Reden des Hauskaplans, kurze, spitzige Bemerkungen der Frau Hedwig von Brandenburg über Vernachlässigung, ferner die Botschaft des Stallmeisters über die Erkrankung eines Lieblingsrosses, ferner die Nachricht des Falkenierers von dem Unwohlsein des Lieblingsfalken – vermochten nicht mehr als des Grafen eigene Anstrengungen.
Das Bild Faustas war wieder emporgestiegen und schwebte siegreich dem Grafen auf Schritt und Tritt voran.
Gegen Abend war Philipp von Spiegelberg ganz in der Stimmung, an den blinden Simon und seine Kunst zu glauben.
Und grade um die sechste Stunde des Nachmittags brach ein so gewaltiges Geschrei los am heiligen Born, dass die Bewohner des Schlosses Pyrmont, welche doch gewiss durch die letzten Wochen an grässlichen Lärm und Getöse gewöhnt waren, erschreckt auffuhren und an die Fenster oder aus dem Tore stürzten, die Bedeutung dieses Geschreis zu erkunden. Das Getöse legte sich nur, um im nächsten Momente desto kräftiger anzuschwellen. Alle die Tausende, die um den Gesundbrunnen lagerten, waren in Bewegung, gestikulierten mit den Armen und Händen in der Luft und sperrten die Mäuler so weit als möglich auf:
»Wunder! Wunder! Wunder! Simon Magus! Wunder! Simon Magus! Wunder! Wunder!«
Simon der Blinde war am heiligen Born erschienen und hatte seine erste große Tat vollbracht. Simon der Blinde hatte den ersten Teufel ausgetrieben, und niemand war auf dem heiligen Anger, der daran zweifelte.
»Wunder! Wunder! Wunder!«
Und in dem Augenblick, wo dieses Wunder-Geschrei das Waldtal von Pyrmont erfüllte, hatte Herr Philipp von Spiegelberg den Schlüssel jenes Turmgemaches, welches man der schönen Fausta angewiesen hatte, gedreht und stand auf der Schwelle und hielt sich an den Pfosten der Tür. Besiegt hatte ihn der Zauber, die enge Wendeltreppe hatte er ihn heraufgezogen. Ein blauer Nebel, in welchem alle Gegenstände tanzten, welchen tausend Funken und Lichter durchsprühten, lag vor den Augen des jungen Grafen, als sich die Tür öffnete; ihm schwindelte, er befand sich in einem durchaus unzurechnungsfähigen Zustande, und Fausta La Tedesca – wusste, dass er kommen würde!
Sie lag, wie es schien, im tiefsten, ruhigsten Schlummer auf ihrem Lager. In üppiger Pracht rollten ihre schwarzen Locken ihr über die Schultern. Halb auf die Seite gewendet lag sie da, und nur das regelmäßige Senken und Heben der Brust verkündete, dass Leben in dem herrlichen Bilde sei. Die linke Hand der Schläferin hing an der Seite des Lagers ein wenig herab – diese Hand, welche der große Meister Tiziano Vecelli da Cadore einst so bewundert hatte.
Mit blödem Herzen und bestürztem Mute stand der Graf zu Pyrmont, der sich heute Morgen vorgenommen hatte, »kurzen Prozess zu machen mit der Fremden«, in der Tür, und würde noch lange Zeit so gestanden haben, wenn nicht sein ihm nachfolgender großer Wolfshund es für angemessen gehalten hätte, ebenfalls sich nach dem, was es in diesem Turmzimmer gab, umzuschauen. Gravitätisch schob er sich neben seinem Herrn durch, und ehe dieser es verhindern konnte, hatte der Hund seine kluge, feuchte Schnauze ausgestreckt und beschnüffelte vorsichtig, ohne sich etwas Arges dabei zu denken, die wundervolle Hand, welche Tizian Vecelli in mehr als einem herrlichen Bilde der Nachwelt aufbewahrt hat.
Mit einem in romantischen Erzählungen selten so richtig und wohl begründeten Schrei fuhr die schöne Schlafende empor, strich mit der rechten Hand die wirren Locken aus der Stirn und zog mit der linken die herabgesunkenen Gewänder züchtig und schamhaft über dem Busen zusammen.
Wie die unschuldigste Unschuld, aus dem Schlaf aufgeschreckt, den Störenden anschauen kann, so blickte Fausta La Tedesca zu dem Grafen empor, und dieser – gab seinem Hunde einen Fußtritt und sagte zu seiner Gefangenen: »Verzeihung!«, was sehr viel war für einen Grafen des Heiligen Römischen Reiches einer Landstreicherin gegenüber.
»Und guten Tag!« setzte er hinzu, wodurch er klärlich bewies, dass die Männer in außergewöhnlichen Fällen und Vorkommnissen damals schon ebenso geistreich sein konnten wie heutzutage.
Die Weiber wissen sich seit Evas Apfelbiss bei derartigen Gelegenheiten viel besser zu benehmen. Schon hatte sich die schöne Fausta dem Herrn Philipp zu Füßen gestürzt. Sie schluchzte, rang die Hände, stieß unverständliche Worte und Sätze hervor und drohte in Ohnmacht zu fallen, welches letztere sie jedoch aus uns unbekannten Gründen nicht tat. So verblüfft und ratlos wie möglich machte sie den guten, ehrlichen, blondlockigen deutschen Tölpel.
Die große Vagabondin hatte ihre Rolle gut durchdacht und spielte sie noch besser.
Fausta La Tedesca, welche in Bologna, in Venedig, in Padua, in Rom, in Neapel alle Männer durch Schönheit und Geist bezwungen hatte, Fausta La Tedesca zwang den deutschen Grafen durch Schönheit und gut dargestellte Verzweiflung und Verrücktheit.
Großartig, herrlich war sie in ihrem Wahnsinn! Herrn Philipp von Spiegelberg standen die Haare zu Berge – er rief nach Hilfe, nach seinem Hauskaplan, nach seinen Schwestern, er rief nach Simon dem Blinden, nach Simon dem Magier!
Ja, nach Simon dem Teufelsbanner rief der Graf, und – »Wunder! Wunder! Wunder!« schrie das Volk am heiligen Born über denselben Teufelsbanner, welcher eben das unglückliche Weib, das heute Morgen auf dem heiligen Anger angekommen war, aus den Krallen des Bösen befreit hatte. Was durch dieses Ereignis noch nicht aus dem Schlosse herausgelockt war, das stürzte dem Hilferuf des Grafen nach die Wendeltreppe hinauf in das Turmgemach.
»Zu Simon dem Magier! Zu Simon dem Zauberer!«
Neuntes Kapitel
Wie der Arzt Simone Spada die Weser hinabfuhr und gen Osnabrück ritt.
Durch die Mondscheinnacht, welche das Schloss Pyrmont auf so sonderliche Weise durchträumte, jagte im wildesten Galopp der italienische Arzt Simone Spada mit seinem jungen Diener. Gegen die Weser ritt er ohne Furcht vor den lauernden Strauchdieben und dem zum heiligen Born ziehenden böswilligen Gesindel, vor welchem ihn Klaus Eckenbrecher beim Abschied so eindringlich gewarnt hatte. Verdächtige Haufen begegneten den beiden Reitern auch oft genug, doch kamen sie unaufgehalten zwischen ihnen durch.
Konnte Simone Spada einen anderen Gedanken als den an das eben vorgegangene Wiederfinden fassen?
»Fausta, Fausta La Tedesca wieder unter den Lebendigen! O Verhängnis! O Verhängnis!« rief er und schlug sich die Stirn mit der Faust und stieß immer von neuem seinem schäumenden und schnaufenden Rappen die blutigen Sporen in die Weichen.
So jagte er vorwärts durch Schatten und Licht, durch Wald und Feld und mäßigte den Lauf seines Pferdes nicht eher, als bis die Hufschläge desselben dumpf auf der Brücke, welche über die Weser in die alte Stadt und Festung Hameln führt, widerhallten.
Da die Tore bereits seit geraumer Zeit geschlossen waren, so musste der Arzt wohl eine Stunde harren, ehe die Wacht ihm das Brückentor öffnete und ihn einließ gegen ein gutes Trinkgeld. Für ein gutes Trinkgeld geleitete ihn darauf ein Hellebardierer nach dem Schützenhause nahe der Weserpforte, wo Herr und Diener von den Rossen stiegen und ihr Nachtquartier nahmen. Der todmüde Knabe Paul schlief nach kurzem Mahl sogleich ein; Simone Spada aber schritt bis zum Morgengrauen im Zimmer auf und ab und verwünschte die allzu langsam schleichende Zeit, während er selbst von einem unter seinem Gemache hausenden Viehhändler aus dem Land Wursten zu allen Teufeln gewünscht wurde.
Wie Fausta La Tedesca auf dem Schloss Pyrmont, so hatte in dieser bösen Nacht Simone Spada im Schützenhause zu Hameln seine wachen Träume, welche ihm den Schlaf vertrieben. Auch sein Gemach hüllte der Mond mit bleichem Schimmer, woraus dem Arzt die Bilder und Gestalten emporstiegen.
Da tauchte vor ihm die große, berühmte Stadt Bologna auf mit ihren Laubengängen, ihren schweren, massenhaften Palästen, ihren hängenden Türmen und dem Studentengewimmel ihrer Gassen. Im Schatten von San Domenico erblickte er sein Geburtshaus, wo er unter den Augen seines gelehrten Vaters Antonio Spada und seiner Mutter Marcella seine Kindheit und sein frühes Jünglingsalter in stillen Studien verlebte. Die Hallen der Universität, die Säle der Bibliothek mit ihren hunderttausend Bänden, ihren Weltkugeln, Bildern und Bildsäulen dehnen sich vor seinem Auge. Der Knabe ist ein Jüngling geworden, ein Student der Medizin, welchen der Vater einführt in die Tiefen der Wissenschaft. Eine verhängnisvolle Gestalt, finster und drohend, hebt sich im bleichen Mondlicht – das ist der deutsche Arzt Benedictus Meyenberger, der Freund Antonio Spadas – ein unglücklicher Mann!
Ein schweres Geschick hat ihn aus seinem nordischen Vaterland nach Italien, wo er einige Jahre im Hause von Simones Großvater verlebte, zurückgetrieben. Sein ihm geraubtes Kind sucht er und den Verderber seines Weibes. Und was er sucht, findet und verliert er wieder zu Bologna, und grenzenloses Leid fällt darüber auf Simone Spada.
Es hebt sich Venedig aus dem bunten Traum. Tot sind die Eltern Simone Spadas; mit dem Gastfreund des Vaters sucht von neuem Simone nach dem verlorenen Kinde, nach der Fausta La Tedesca.
Es ist eine schöne Nacht, leise wogt das Meer um eine öde Insel der Lagunen; auf dem feuchten Sande steht der deutsche Meister dem Räuber seines Glückes gegenüber; der volle Mond und die Fackel, welche Simone Spada hält, leuchten dem Kampfe der beiden Todfeinde. Der Leichnam Alexander Pazzis wird in die Fluten geworfen, ein Kahn tritt seine Rückfahrt zur Stadt an – – – was bricht urplötzlich die fröhliche Tanzmusik im Palast Barbarigo mit solchem Misslaut ab? Ein Schatten ist über den Glanz des Festes gefallen, aus dem Arm Cesare Campolanis reißt der alte deutsche Arzt sein verlorenes Kind – Fausta La Tedesca!
Wehe dir, Simone Spada!
Vor ihrem Vater flieht Fausta. Gleich einem Irrlicht verschwindet sie hin, um in der Ferne wieder aufzutauchen. Wer hält und fesselt die Magierin Fausta La Tedesca? In hundert Formen und Farben, unter hundert Namen führt sie die ihr Folgenden in die Irre durch ganz Italien. In Padua sinkt der junge Doktor Simone in sein Blut durch das Schwert Cesare Campolanis. Sie ist hier, sie ist da – verschwunden! Mächtige Freunde und Beschützer stehen ihr zur Seite! Kardinäle, Prinzen, große Künstler. In Florenz wird sie gesehen am Hofe der Medicis; dann taucht sie in Rom auf, darauf in Neapel, und hier gibt sie endlich das Schicksal in die Hände ihrer Verfolger. Im Hafen flaggt das hanseatische Schiff »die Jungfrau von Wineta«, welches von Syrakus kommt und auf der Heimfahrt begriffen ist. Auf diesem Schiffe führen Benedictus und Simone die große Sünderin fort, dass sie im fremden Lande, unter einem fremden Himmel Buße tue in Einsamkeit und Dunkelheit.
Wehe dir, Simone Spada, schrecklich sind deine Träume!
Und nun, was nun? Was nun, da sie wieder unter den Lebenden wandelt und die Herzen vergiftet und die Leiber tötet?
Was nun? Ja, was nun? Wie war der Arzt Simone, warum war er jetzt nach Hameln geritten? Er wusste selbst keine Rechenschaft davon zu geben! Fieberglut und Frost fühlte er wechselnd in seinen Adern und Knochen! Westwärts lag ja eigentlich jetzt sein Weg, nordwestwärts gen Osnabrück, wo der alte Benedictus nach seinen langen, schmerzenvollen Wanderungen seine letzte Ruhestelle gefunden zu haben glaubte. Musste er nicht den Alten aufreißen aus seinem dunkeln Winkel durch die Nachricht, dass die schöne, schreckliche Tochter ihrer Bande ledig sei und zu neuem, verderblichen Flug die Schwingen rühre?
O diese Nacht, diese Nacht! Wollte sie denn niemals ein Ende nehmen?
Wie es in dem Gehirn des Nachtwandlers sauste und summte, wie sein Atem flog – wie sich das Fieber immer tiefer ihm ins Gehirn wühlte!
»Gen Osnabrück, gen Osnabrück! Gott sei gelobt, da kommt der Morgen! Nun werden die Stadttore wohl wieder geöffnet sein! – Paul, Paul, zu Pferde, zu Pferde!«
Wohl kam der Morgen wie alle Dinge in dieser Welt, wenn man nur warten kann und will; und der Knabe Paul führte die Pferde hervor, aber – der Arzt Simone Spada konnte das seinige nicht besteigen; halb ohnmächtig sank er aus dem Sattel seinem Diener in die Arme.
»Zu Schiff, zu Schiff, die Weser hinab nach Minden – vorwärts im Namen aller Heiligen, vorwärts!«
Der Wirt vom Schützenhause rief: sogleich fahre ein Kahn stromab, und die Fremden könnten mit demselben fahren, wenn sie wollten.
»Zu Schiff, zu Schiff!« murmelte Simone; die Knechte des Gasthauses führten die Pferde durch die Weserpforte an den Fluss; auf den Arm seines Dieners gestützt folgte wankend der Arzt. Noch lag der Morgennebel auf den Wassern, als die Schiffer mit großem Geschrei vom Ufer abstießen. Auf ein schlechtes Lager, bereitet von Strohbündeln und Säcken, sank Simone und verhüllte das Haupt mit seinem Mantel; in den Nebel hinein glitt der Kahn, und als die Sonne die Dünste, welche über dem Strome lagerten, aufgesogen hatte, war das Schiff mit den seltsamen Fremdlingen längst den Augen des am Ufer lungernden Wirtes vom Schützenhause und seiner Knechte verschwunden.
Das war eine böse Fahrt!
Wie die fürchterliche Sonne des Jahres 1556 auf das Gehirn des kranken Simones ihre Strahlenpfeile herabschoss! Wie die Gegend langsam, langsam vorüberschlich: Dörfer, Flecken, Städte, Berge, Wälder, Felder, Wiesen! O Qual, Qual!
Oft genug hielt das Schiff an, ehe es durch die Porta Westfalica glitt und in Minden landete, wo der Arzt trotz dem Fieber, das ihn verzehrte, sein Ross wieder bestieg, um halb bewusstlos durch das Wiehengebirge und quer durch das offene Land gen Osnabrück zu jagen. Zerschlagen an Leib und Seele ritt er hier endlich ins Tor ein und hielt an in einer dunkeln, engen, schmutzigen Gasse vor einem mit künstlichem Schnitzwerk verzierten, buntbemalten Giebelhause. Ein jedes Kind in der Stadt kannte die Behausung des großen Doktors Benedictus Meyenberger, und auch Simone Spada aus Bologna kannte sie. Es war übrigens auch ein merkwürdiges Haus – merkwürdig war der Türklopfer, merkwürdig waren die grässlichen Fratzengesichter, in welche die Dachrinnen ausliefen, merkwürdig war die Wetterfahne auf der Giebelspitze, welche einen Sankt Georg vorstellte, wie er ohne Gnade und Barmherzigkeit mit seinen heiligen Füßen auf dem Drachen herumtrampelte.
Mehr als einmal musste der arme, ermüdete Paul den merkwürdigen, höhnischen Türklopfer in Bewegung setzen, ehe im Innern des alten Gebäudes sich jemand regte.
Endlich erschien ein altes Weib und schlug beim Anblick des kranken Italieners die Hände über dem Kopfe zusammen.
»Ihr wieder, Meister? O Jesus, Maria und Joseph, wie sehet Ihr aus! O was gibt es, was gibt es? Möget Ihr doch bessere Botschaft bringen, als Euer Gesicht verkündet. Tretet ein!«
Ohne auf die schwatzende Alte weiter zu achten, stürmte der Arzt, dem das erreichte Ziel alle früheren Kräfte wiedergab, an ihr vorüber und eilte mit schnellen Schritten eine dunkle Treppe hinauf, klopfte an eine altersschwarze, ebenfalls mit Schnitzereien verzierte, hohe Tür und trat in ein weitläufiges Gemach, in welches die Abendsonne eben ihre letzten Strahlen sandte.
Ein Greis erhob sich schnell aus einem Armsessel mit hoher, steifer Lehne, hielt die Hand über die zweifelnden Augen und rief erschreckt:
»Simone Spada, du? Du?«
Mit zitternden Händen stieß er den Sessel zurück und trat auf den jungen Arzt zu.
»Ja, ich, ich! Ich bin’s!« rief dieser. »O rüstet Euch, wappnet Euch gegen den Schrecken, den ich Euch bringe, Messer Benedetto!«
Der Alte griff hinter sich, als suche er nach einer Stütze; er hielt sich am Rande des Tisches: »Fausta?!«
Simone Spada nickte, sank in einen Sessel und schlug die Hände vor dem bleichen, hagern Gesicht zusammen. Mühsam fasste sich der Meister Meyenberger zu der Frage:
»Ich bin gewappnet. Sprecht, was ist’s mit ihr? Was ist geschehen?«
»Entflohen ist sie! Sie ist frei!«
»So schütze uns Gott!« murmelte dumpf der Alte. Die Bilder längst vermoderter Patrizier und Patrizierinnen aus dem Hause der Meyenberger lächelten grimmig herab von den Wänden auf den letzten des Geschlechtes, der nicht wie sie alle des »Nachbars Kind« gefreiet hatte und nun dafür büßte. Das Skelett hinter dem Sessel des greisen Arztes schien die schönste Minute seines Daseins zu genießen.
»Erzähle!« sagte der Doktor Meyenberger nach einer langen Pause. »Ich bin bereit und kann nun alles hören. Hast du sie gesehen, Simone? Wo hast du sie getroffen? Erzähle und verschweige mir nichts; es ist Gottes Wille, dass ich den Kelch der Schmerzen bis auf die Hefen leeren soll.«
Und der junge Arzt erzählte: wie ihn auf seiner Heimreise nach Italien das Gerücht von den Wundern, die sich am heiligen Born zu Pyrmont begeben sollten, bewogen habe, dorthin von seinem Wege abzuschweifen – was da vorgefallen sei und wie und wo er die Fausta La Tedesca verlassen habe.
Der Greis gab Zeichen der immer mehr sich steigernden Unruhe, Angst, Ratlosigkeit von sich; er schlug die Hände zusammen, er griff einmal sogar nach einem Seziermesser auf dem Tische wie nach einer Schutzwaffe, bis gegen Ende der Erzählung Simones eine vollständige Veränderung über sein ganzes Wesen kam. Ruhig lauschend saß er da, das Haupt war ihm zur Brust hinabgesunken, nur die tiefen Atemzüge verkündeten noch die Spannung, mit welcher er dem Berichte seines jungen Freundes folgte.
Als dieser zu Ende gekommen war, saßen die beiden Männer abermals lange Zeit im brütenden Schweigen einander gegenüber.
»Und was soll nun geschehen? Was sollen wir jetzt gegen sie tun?« fragte endlich Simone Spada.
Der Alte erhob das Haupt und schaute mit einem unbeschreiblichen Ausdruck in den Augen auf.
»Nichts!« sagte er. »Es ist alles geschehen, was wir tun konnten, was in menschlicher Macht lag; oder – oder – sollte ich ihr den Dolch in das Herz stoßen?!«
Simone Spada machte eine abwehrende Bewegung des Schreckens.
»Das wäre das letzte!« fuhr der Alte fort. »Nein, nein, es ist nichts mehr zu tun. Wie dich das Grauen übermannt hat, mein armer Sohn! Nun sollst du dich ruhen und dann – dann dein Ross wieder besteigen und heimziehen in dein Vaterland. Du bist mein lieber, guter Sohn, Simone, und meinen Segen, den ich schon neulich dir gegeben habe, will ich von neuem auf dein Haupt legen. Das Schicksal hat dich wie mich schwer und hart geprüft; fasse dich, mein armes Kind! In deinem Vaterlande lebe still, tue Gutes, lindere die Not der Armen und heile die Wunden der Kranken! Sieh, ich bin alt, und mein Leben wird wohl nur noch von kurzer Dauer sein; ich bin alt und müde, und meine Augen werden dunkel. O ich fühl’s, ich fühl’s, töricht haben wir in Gottes Willen eingreifen wollen – wir arme schwache Menschlein. – Jenen Herrn zu Pyrmont hast du gewarnt vor – vor ihr; was willst du ferner noch tun? Ach Simone Spada, wir wollen das andere dem großen Gott überlassen! … Dir möge er Ruhe und Glück und eine stille Heimat für deinen künftigen Lebensweg geben; mir aber möge er bald einen stillen und sanften Tod senden. Ruhe dich aus, und dann wollen wir wieder scheiden. – Armes Kind, wie deine Pulse klopfen!«
»O Meister, Meister!« schluchzte der junge Arzt.
»Jaja, Simone, mein liebes Kind, gehe heim und denke daran, dass ›droben waltet der große Zeus, der alles sieht und lenkt‹. Wir können nichts mehr tun, Simone Spada, – nichts, nichts!«
Und gewaltig brach nun doch der Schmerz und die Verzweiflung bei dem alten Manne hervor, er hob die Hände zum Himmel empor und rang sie fast wund:
»Wehe mir, wehe! Wie Dante Alighieri habe ich die Hölle durchwandert, die tote Franzeska und den Verführer habe ich schweben sehen durch die purpurne Finsternis; alle Schrecknisse und Qualen habe ich ausgekostet, und noch immer ist es nicht genug. – Wehe mir, wehe! Vergebens alles, alles vergebens!«
»O so lasset mich bei Euch bleiben, als Euer treuer Sohn!« rief Simone, die Hände des alten Freundes und Lehrers fassend, »Das Unglück hat mich zu Euerm Sohn gemacht, o lasset mich bleiben bei Euch, dass wir zusammen sitzen mögen und klagen über die Herrliche – die Schreckliche – die Verlorene!«
Mühsam hatte sich der Greis ein wenig gefasst.
»Nein, nein, nein«, sprach er; »du bist jung, Simone, und zu lange, allzu lange habe ich dich in meine unglückseligen Bahnen hineingezogen. Gehe heim, mein Kind, gehe heim in dein schönes Vaterland; arbeite, vergiss und werde wieder glücklich!«
»Der Himmel ist so dunkel über mir wie über Euch, Meister«, murmelte Simone Spada. »Nie wird es mir wieder tagen. O lasset mich bei Euch bleiben!«
Der Alte fasste die Hand des Jüngern Mannes und führte ihn sanft an das Fenster und zeigte ihm eine Spinne, welche daselbst eben ihr Netz spann.
»Schau, Simone, vor einer Viertelstunde habe ich ihr das kleine Haus unversehens zerstört, schau, wie unermüdlich sie alle die abgerissenen Fäden, an denen ihr Dasein hängt, wieder anknüpft; folge der Spinne, mein Kind, und knüpfe die zerbrochenen Fäden deines Daseins auch wieder an, suche dir warme, treue Freundesherzen in der Heimat, an denen du sie befestigen kannst. Die Liebe hast du verloren, nun greife mit deiner jungen Hand nach einer anderen Krone, greife nach dem Ruhm! Törichtes Kind, was willst du hier bei uns? Als Zauberer und Schwarzkünstler dich zum Scheiterhaufen schleppen lassen? Gehe heim, gehe heim, Simone Spada! Gehe nach Bologna; arbeite und gewinne dir Ruhm und Ehre und lerne zu vergessen!«
»Aber Ihr bleibt allein, so schrecklich allein mit dem Gedanken an – sie.«
»Nicht allein, Knabe. Es wird freilich selten ein menschlicher Fuß dieses Gemach betreten, aber darum werde ich nicht allein sein. Für den Kampf gegen die bösen Gedanken habe ich meine Wissenschaft, meine Bücher, dort jene alten Schädel und Gebeine; meine treue Feder habe ich. Und den Kampf gegen das Geschick, – den, o Simone, gebe ich nicht auf, weil ich Angst habe, sondern weil ich müde, müde bis zum Tode bin.«
Der junge Arzt erhob sich von seinem Sessel, er schien gehen zu wollen; aber jetzt verließen ihn die Kräfte, er wankte auf den Füßen und wäre zu Boden gestürzt, wenn ihn der Meister Meyenberger nicht unter die Arme gegriffen hätte. Der alte Arzt rief nach seiner Dienerin, und mit ihrer Hilfe gelang es ihm, den Bewusstlosen auf ein Lager zu bringen. Tiefgebeugt saß er dann nieder vor dem Bette und erwartete das Wiedererwachen des Kranken. Dieses trat aber erst gegen Mitternacht ein, und verwunderte Blicke warf Simone Spada umher, als er auffuhr aus seinem unruhigen Schlummer.
»Ich bin’s, Simone«, sagte der Alte. »Beruhige dich, mein Kind, du sollst noch nicht gehen. Du bist schwach und hast dich zu sehr angestrengt auf deiner schnellen Jagd hierher. Die Dora und ich, wir wollen dich recht pflegen, wie einst vor langen Jahren deine Großeltern mich gepflegt haben in deiner Vaterstadt Bologna.«
Schwach drückte mit fieberhafter Hast der junge Mann dem Greise die Hand, und dieser schüttelte traurig, bedenklich das Haupt über die Fortschritte, welche die Krankheit machte. Der nächste Morgen fand den Simone Spada in den wildesten Fieberfantasien. Von Blut und Feuer rief er verworrene Worte, von schönen Jungfrauen, welche auf schwarzen, funkensprühenden Geisterrossen durch donnernde Gewitterwolken sprengten; von Sturm und Schiffbruch träumte er, vom Zusammenschlagen eiskalter Wogen über seinem Haupte; auf flammendem Scheiterhaufen wand er sich, und immer und immer wieder rief er aus der Todesqual mit schauerlich-verzweifelnder Stimme den Namen der falschen Magierin Fausta La Tedesca. Selbst jetzt, dicht vor den Toren der Vernichtung, ließ die Verderberin ihr Opfer noch nicht los; sie umschlang es im Gegenteil mit immer innigern Banden, wie die Schlange ihre Beute umschlingt.
Benedictus Meyenberger glaubte, der Kranke werde ihm unter den Händen sterben; neben dem Lager seines jungen Freundes, den er Sohn nannte, saß der vielgeprüfte Mann und gedachte jener Nacht in Padua, von welcher Fausta La Tedesca in dem Turmgemach zu Pyrmont geträumt hatte.
In jener Nacht und den darauf folgenden rang Simone Spada auch zwischen Leben und Tod, damals rief er im Fieberwahnsinn ebenfalls den Namen, der jetzt wieder gell das alte Haus zu Osnabrück durchklang. Auch damals saß Benedikt Meyenberger neben dem Lager des Verwundeten und errettete ihn.
Der deutsche Meister sollte auch dieses Mal den Tod durch seine Kunst und seine Liebe zu dem Kranken besiegen, aber erst nach langen, langen, schweren, schmerzvollen Wochen!