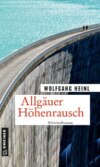Kitabı oku: «Allgäuer Höhenrausch», sayfa 3
Franz Britzler parkte den blauen Mercedes-Kastenwagen hinter der Gehrenkopfhütte, wo der Eingang zur Küche war. Er stieg in seiner leicht gebeugten Haltung aus dem Fahrerhaus des Transporters. Ihm waren mit seinen nur knapp 1,70 Metern, dem hageren Gesicht mit den kleinen listigen blauen Augen und der etwas zu weit oben sitzenden ausgeleierten Jeans die Jahre harter handwerklicher Arbeit anzusehen.
Auf der Terrasse waren nur drei Tische belegt; durch eines der mit alpenländisch typischen rotkarierten Vorhängen verzierten Kreuzsprossenfenster sah er, dass der Gastraum innen fast leer war. Erst jetzt bemerkte Franz Britzler, dass der Grund für den Menschenauflauf auf der Wiese in Richtung des Wanderwegs zum Wannenkopf zu suchen war. Mitten auf dem Weg standen sich in einigen Metern Entfernung zwei Traktoren gegenüber, zwischen deren hochgereckten Silogabeln ein großes, von Hand beschriebenes Transparent in roten Großbuchstaben ›KEIN STAUSEE AM STEIGHORN‹ verkündete. Auf einem Plakat aus Karton war ›Keine dunklen Geschäfte mit Hellwatt – im Steighorntal gehen die Lichter aus‹ zu lesen.
Es war eine Demonstration gegen den geplanten Bau eines Wasserkraftwerks, von dem erst kürzlich die Zeitungen erstmals berichtet hatten. Franz Britzler sah aus der Entfernung, wie einige Hundert Menschen aufgebracht diskutierten und Bauern mit gestreckten Fäusten in Sprechchören »Hellwatt raus« skandierten.
»Die sind ordentlich in Rage, die will ich lieber net als Gäst’ in der Hütte habbe«, sagte neben ihm eine männliche Stimme mit hessischem Dialekt. Joschi war aus dem Hintereingang zur Küche herausgekommen und stand jetzt in Lederhose und blau-weiß kariertem Hemd neben Britzler. Joschi war ein smarter Endvierziger mit dünnem, nach hinten gekämmtem Haar, der vor einigen Jahren nach einem Nervenzusammenbruch und nach bewältigter Identitätskrise seiner Karriere als Investmentbanker in Frankfurt am Main den Rücken gekehrt hatte und sich jetzt in seinem neuen Leben im Allgäu als Hüttenwirt betätigte.
Franz Britzler öffnete mit einem triumphierenden Lächeln die Schiebetür seines Transporters, beugte sich in den Laderaum und holte eine rechteckige, etwa einen Quadratmeter große dunkelblau schimmernde Platte heraus, die von einem Rahmen aus Aluminium eingefasst war. »Solche Kraftwerke wird es bald überhaupt nicht mehr brauchen. Strom machen wir hier in Zukunft damit«, präsentierte der Elektromeister stolz das Fotovoltaikmodul. Joschi betrachtete das glitzernde Rechteck mit den silbrigen Metallfäden unter der Glasabdeckung. »Ziemlich schweres Ding«, sagte er, »und wie viel brauch ich davon, dass ich damit auch bei Hochbetrieb meine Gäst’ was zu esse’ koche’ kann?«
Während Franz Britzler dem Hüttenwirt wort- und gestenreich die Ausführung der Fotovoltaikanlage vorrechnete, trat einer der Demonstrationsteilnehmer auf den gekiesten Weg in Richtung des Hütteneingangs, blieb an dem verwitterten Holzzaun stehen, beobachtete kurz mit fragendem Blick die Unterhaltung der beiden sowie das blauschimmernde Rechteck und suchte sich dann einen Platz an einem leeren Tisch auf der Terrasse. Sein rundliches Gesicht mit dunkelbraunem Oberlippenbart war von der Sonne gerötet. Er trug trotz des warmen Juliwetters eine verwaschene hellbraune Cordjacke über einem dunkelgrünen T-Shirt, bei dessen Knopfleiste drei Knöpfe offen standen und wo die Sonne auf der Haut zwischen Hals und Brust ein leuchtend rotes Dreieck gebrannt hatte.
Er hatte während der Demonstration offenbar sehr viel geredet und bestellte bei der Bedienung mit fast heiserer Stimme ein dunkles Hefeweizenbier und eine Portion Bratwurst mit Kartoffelsalat. Gottfried Monschkopf war im Moment ziemlich erschöpft, aber zufrieden mit dem Verlauf der Demonstration. Er war derjenige, der die Demo organisiert und die Leute und Bauern aus dem Steighorntal gegen dieses irrsinnige Stausee-Projekt mobilisiert hatte. Diese Irren von diesem Stromkonzern hatten tatsächlich vor, einen Teil des Tals vor dem Steighorn in einem Stausee zu versenken und noch dazu in einer ökologisch höchst sensiblen Umgebung ein Kraftwerk zu bauen. Höfe, Bergweiden, Bachläufe und seltene Pflanzen sollten hinter einer riesigen Beton-Staumauer verschwinden, um den immer größer werdenden Stromhunger zu stillen.
Als überzeugter Umweltaktivist und Mitglied der vor wenigen Jahren gegründeten Partei »Die Grünen« hatte er sich zum Handeln berufen gefühlt. Und zum guten Schluss war bei der Demo sogar noch ein Fernsehteam des österreichischen Rundfunks vor Ort, und er hatte die Chance genutzt, ein Interview zu geben und so vor laufender Kamera seine Überzeugungen gegen den Bau eines Wasserkraftwerks in dieser landschaftlich schützenswerten Bergregion zu vertreten. Während er sich schelmisch über das Fernsehinterview freute, servierte ihm die Bedienung sein Hefeweizenbier, das er sogleich in einem Zug zur Hälfte leerte.
Als er das Glas absetzte, hing der Bierschaum in seinem dunklen Oberlippenbart. Sein naiv wirkender Blick ließ erahnen, dass er sich bedingungslos für eine Sache einsetzen würde, aber auch, dass er einem intellektuell überlegenen Gegner nicht die Stirn würde bieten können. Genau diese fehlende souveräne Ausstrahlung war für Gottfried Monschkopf bisher das Hindernis, warum er es bei den »Grünen« noch nicht über eine Kreistagskandidatur hinaus geschafft hatte.
Er nahm noch einmal einen kräftigen Schluck Bier und blickte dabei in Richtung eines felsigen, steil aufragenden Berggipfels, dessen Gipfelkreuz in der Julisonne schimmerte. Das Fernsehinterview, war er jetzt überzeugt, würde ihn innerhalb der Partei nach oben katapultieren.
Joschi und Franz Britzler traten auf die Terrasse mit den Biertischen und -bänken, betrachteten eingehend die vordere Dachhälfte der Gehrenkopfhütte und waren ins Gespräch vertieft. »Ich will da schon was investiere’, mit Finanzierung kenn ich mich ja aus. Aber vielleicht sollt man erst mal genau gucke, ob das Dach auch hebe tut?«
»Die Dächer auf den Berghäusern sind für zwei Meter Schneelast gebaut, also die halten das Gewicht von der Fotovoltaikanlage ohne Probleme aus«, versuchte Franz Britzler ihn zu bestärken; er sah schließlich bereits einen lukrativen Auftrag vor Augen und wollte Joschis Bedenken möglichst schnell zerstreuen. Mit den Worten »Sag, was die Fotodingsda koste’ soll und dann schaue mer mal« verabschiedete sich Joschi wieder in die Küche, nachdem sich innerhalb von wenigen Minuten zwei Tische mit Wanderern gefüllt hatten, die sich lautstark gegenseitig mit ihren Gipfelerlebnissen zu überbieten versuchten.
Franz Britzler setzte sich an das freie Ende des Tisches, an dem Gottfried Monschkopf gerade ein Stück Bratwurst dick mit Senf bestrich und den Bissen etwas hastig in den Mund schob. Nachdem er noch eine Gabel voll Kartoffelsalat hinterhergeschoben und mit vollem Mund bei der Bedienung ein weiteres Hefeweizenbier bestellt hatte, wandte er sich Britzler zu. Monschkopf wischte sich mit dem Handrücken den Senf aus dem Oberlippenbart und zeigte mit der Gabel in Richtung des Hüttendaches. »Wollen Sie da so was mit Solar machen?«, fragte er Franz Britzler, der gerade an seinem Radler nippte.
»Fotovoltaik«, sagte Britzler kurz beim Absetzen des Glases, um gleich darauf weiter auszuholen. »Mit dem Sonnenlicht Strom produzieren und unabhängig von solchen Stromkonzernen werden, das ist die Zukunft.«
»Sie interessieren sich dafür?«, fragte der Elektromeister nach einer kurzen Pause, während seine kleinen blauen Augen listig aufblitzten.
»Wir bei den ›Grünen‹ wollen uns für die alternative Energieerzeugung einsetzen, von daher interessiert mich diese Technologie, einmal vom Umweltaspekt her, und ein bisschen auch aus meinem beruflichen Hintergrund als Bautechniker.« Gottfried Monschkopf versuchte sich als einflussreicher Lokalpolitiker darzustellen und schaffte es, damit bei Britzler auf Anhieb Eindruck zu schinden, obwohl sein Äußeres diesen überhaupt nicht vermitteln konnte.
»Sie meinen, dass die Politik etwas tun könnte, damit sich diese Solarstrom-Technik etablieren kann?« Franz Britzler, der soeben noch in geduckter Haltung mit aufgestützten Ellenbogen am Tisch gesessen hatte, saß jetzt aufrecht auf der Bierbank, als säße ihm ein Politiker vom Rang eines Wirtschaftsministers gegenüber.
»Ich will das Thema verstärkt in den Parteiausschuss einbringen«, hob Monschkopf bedeutungsvoll an. »Wenn ich zu diesem Thema mehr Hintergrundinformationen hätte, denke ich, dass ich damit was bewegen kann«, schloss der ambitionierte Grüne, in der Hoffnung, dass er von dem Elektriker mit dem listigen Blick mehr über die Solarstromtechnik würde erfahren können.
*
Franz Britzler reichte es an diesem Montagvormittag bereits, nachdem sich am Morgen ein Monteur krankgemeldet hatte, ein Montagetrupp auf einer Baustelle wegen im Keller kniehoch stehenden Regenwassers keine Arbeiten verrichten konnte und ein Kunde reklamierte, dass beim Einschalten der Außenbeleuchtung stattdessen das Licht in der Küche ausging.
Während er noch überlegte, auf welche Baustelle er den Montagetrupp umdirigieren sollte, reichte ihm seine Frau Elfriede Britzler den Telefonhörer aus dem Bürofenster. »Franz, der Leibacher is’ dran. Ist dringend.« Er nahm ihr den orangefarbenen Hörer aus der Hand und musste dabei das Spiralkabel über die Fensterbank zerren, um beim Telefonieren nicht an der Hauswand kleben zu müssen. Alois Leibacher hatte ihm jetzt gerade noch gefehlt.
»Alois. Britzler, pass mal auf, ich hab da was für dich. Das Neubaugebiet Steighornblick mach ich als Generalunternehmer. Den Vertrag über die Erschließungsarbeiten hab ich am Freitag unterschrieben. Acht Einfamilienhäuser, zwei Reihenhauszeilen. Die Heizungen werden alle mit Nachtspeicheröfen und Elektroboilern fürs Warmwasser gemacht, dann kann ich da dem Hellwatt einen ganzen Schwung neue Stromkunden servieren, du weißt ja, das ist wichtig im Zusammenhang mit der Stauseegeschichte.«
Alois Leibacher ließ Franz Britzler erst gar nicht zu Wort kommen und hatte es offenbar eilig, diese Informationen loszuwerden. Britzler streckte sich über die Fensterbank durch das geöffnete Bürofenster, fischte mit ausgestrecktem Arm das nächstbeste Stück Papier und einen Kugelschreiber vom Schreibtisch und machte sich auf der eingestaubten Fensterbank Notizen auf der Rückseite eines Prospektes für Lichtschalter.
»Also, Vorgehensweise wie beim letzten Projekt«, sprach Leibacher weiter. »Ich schick dir die Ausschreibungen und die Angebote von deinen Konkurrenten, das läuft ja ohnehin alles bei mir zusammen. Du unterbietest und hast den Auftrag über die Elektroheizungen und die Warmwasserboiler bei dir.«
»Eigentlich …«, wollte Britzler ansetzen und damit sagen, dass er für diese Größenordnung überhaupt nicht die nötigen Kapazitäten besäße.
»Ich weiß, dass du da äußerst knapp kalkulieren musst, aber da fällt mir schon noch was ein, wie wir das für dich ausgleichen können. Schick mir so schnell wie möglich die Kalkulationen rein.« Es klickte in der Leitung. Leibacher hatte aufgelegt und Britzler starrte ungläubig und überrumpelt auf den Telefonhörer in seiner Hand. Leibacher war einer von der Sorte Gutmenschen, die sich gerne großzügig gaben, aber dafür jeden, der mit ihm zu tun hatte, mit fast unerfüllbaren Bedingungen knebelte.
Im Kopf von Franz Britzler hallte das Wort »Stauseegeschichte« nach. Er war am vergangenen Samstag auf der Gehrenkopfhütte gegenüber diesem »Grünen« etwas zu redselig geworden, nachdem er mit Gottfried Monschkopf zwei Stunden begeistert über die Zukunft mit der Stromerzeugung aus Sonnenlicht geredet und darüber sogar seine geplante Bergtour vergessen hatte. Beim dritten Hefeweizenbier waren er und Gottfried per Du gewesen, und er hatte ihm leichtsinnigerweise zugesteckt, dass hinter dem geplanten Bau des Wasserkraftwerks der Tief- und Straßenbauunternehmer Leibacher steckte. Für Gottfried Monschkopf schien das ein gefundenes Fressen zu bedeuten; Britzler befürchtete, dass dieser auf die Idee kommen könnte, diese Information den Medien zuzuspielen, und er damit seinen Geschäftspartner ans Messer geliefert hätte, wenn die Zeitungen Leibachers lukrative Verbindungen mit dem Stromkonzern publik machen würden.
»Haben wir einen neuen Großauftrag?«, fragte Elfriede Britzler freudig aus dem Bürofenster heraus, stemmte die linke Hand in die Hüfte und zupfte mit der Rechten ihre graublonde toupierte Frisur zurecht. »Franz?« Franz Britzler sinnierte noch reumütig über sein Gespräch mit Gottfried Monschkopf und stammelte dann: »Acht Häuser. Und noch zwei mal sechs Reihenhäuser. Baubeginn im September.« Er hob die Achseln. »Der Leibacher will mir die ganzen Aufträge zuschieben, wenn ich mit dem Preis voll reingehe. Er will mir das irgendwie ausgleichen, wahrscheinlich wieder mit Bescheißen bei den Regiestunden bei seinen öffentlichen Bauprojekten. Elli, ich muss da aussteigen bei dem Leibacher, der mit seinen illegalen Methoden.« Elfriede Britzler überlegte kurz, lehnte sich dann mit verschränkten Armen auf den Fensterrahmen, wobei die Perlen ihrer Halskette auf dem Blech der Fensterbank ein kurzes prasselndes Geräusch erzeugten, und warf ihrem Mann über den Rand ihrer Lesebrille einen strengen Blick zu: »Mein lieber Franzi, ich sag dir mal was. Du hast anscheinend lang nicht mehr in unsere betrieblichen Zahlen geschaut. Hier stapeln sich die Lieferantenrechnungen, nächste Woche sind Löhne fällig, und wir leben hauptsächlich von Aufträgen für Reparaturen. In dieser Firma steckt das Erbe meiner Großeltern, und wir haben hier nichts als Arbeit und seit Jahren keinen Urlaub mehr gemacht. Illegale Methoden und Preisabsprachen hin oder her, Geld ist in dieser Branche nur im Neubau verdient. Und so ein Neubaugebiet ist eine gute Referenz für die Kundenwerbung und nicht Reparaturen mit ein paar Metern Kabeln und ein paar Kleinteilen.« Mit diesen Worten schloss sie das Bürofenster und zog den Vorhang zu.
*
++ August 1986 ++
Alois Leibacher nahm gerade seine Baustellen-Gummistiefel aus dem Kofferraum, als der Bauleiter mit hektischen Schritten auf ihn zustürmte. »Wenn Sie am Montag die Bodenplatte betonieren wollen, müssen Ihre Leute aber zusehen, dass sie bis dahin das Wasser aus der Baugrube rauskriegen?« Der junge, unerfahrene Bautechniker sprach das, was eigentlich eine Anordnung sein sollte, als Frage aus.
Es war Freitag 12.30 Uhr und seine Leute würden in einer halben Stunde hier die Baucontainer schließen und sich ins Wochenende aufmachen. Mit den Worten: »Ich schau gleich mal danach« ließ Alois Leibacher den Bauleiter stehen und marschierte über den vom Regen der letzten Tage aufgeweichten Boden zur Baugrube der Tiefgarage für den Erweiterungsbau des Kurhotels »Alpenrose«.
Er hatte seit einiger Zeit das Gefühl, keinen festen Boden unter den Füßen mehr zu haben. Der aufgeweichte Boden auf dem Baustellengelände, das Fundament, das vielleicht nicht betoniert werden konnte – es passte alles genau zu seiner Gesamtsituation, vor allem seit dem Desaster im Rathaus-Sitzungssaal vor etwa drei Wochen, als ihn Oberbürgermeister Hermann Hüttinger vorführte und noch dazu dieser Leiter des Ausschusses für Technik und Umwelt seine Pläne für absurd erklärte.
Dieses Stausee-Projekt schien gerade genauso abzusaufen wie die Baustelle, vor der gerade der Inhaber des Kurhotels mit verschränkten Armen stand und sichtlich verärgert über den verzögerten Baufortschritt war. Leibacher wies seine Mitarbeiter an, aus dem Lager alle verfügbaren Abwasserpumpen einzusetzen und verdonnerte einen von ihnen dazu, über das Wochenende zweimal täglich die Pumpen zu kontrollieren.
Nachdem er den Hotelier und den Bauleiter wieder so weit beruhigt und ihnen versichert hatte, dass am Montag planmäßig betoniert würde, fuhr er mit dem Firmenwagen einen kleinen Umweg und hielt auf der Serpentinenstraße auf dem Höhenzug gegenüber dem Steighorn vor dem Gasthaus »Zur Aussicht«, wo er sich ein Mittagessen bestellen wollte. Er parkte auf dem geräumigen Parkplatz vor dem Gasthaus nahe am Straßenrand und ging in den von einer halbhohen Hecke umrahmten Biergarten, in dessen Mitte ein großer alter Kastanienbaum stand. Von hier hatte er den frontalen Blick auf das Steighorn. Der Himmel ballte graue Regenwolken zusammen und verdunkelte die Mittagssonne. Durch den Biergarten begann ein kühler Luftzug zu wehen, als wollte der Allgäusommer schon Mitte August allmählich dem Herbst Einzug gewähren.
Vor seinem geistigen Auge teerte sich am Steighorn eine Zufahrtsstraße, die sich wie ein geschwungenes dunkelgraues Band bis zu dem Punkt verlegte, an dem er sein Sporthotel bauen wollte und wo in diesem Moment aus einer Wolkenlücke die Sonne draufschien. Er ließ den Baustellen-Alltagswahnsinn hinter sich und konzentrierte sich mit seiner Leidenschaft für Asphalt und Beton ganz auf seine Vision seines Sporthotels am Steighorn. Für den überwiegenden Teil der Straße würde es genügen, den vorhandenen Fahrweg zur Bergstation der Steighorn-Seilbahn auszubauen. An einigen Passagen aber war der Weg zu schmal; schließlich müssten auch Busse problemlos um die Kurven fahren können. An schmalen Stellen wie im Bereich der Serpentine auf Höhe der Unteren Steigalpe würde man eben auf einige Hundert Meter etwas Fels abbrechen müssen – das betonähnliche Nagelfluh-Gestein müsste sich gut sprengen lassen und er schätzte dafür etwa 100 Lkw-Ladungen – und zum Schutz vor Steinschlag und Erdrutsch könnte über den Abschnitt eine Galerie gebaut werden.
Durch das imaginäre Bild fuhr in diesem Moment ein roter Alfa Spider, der aus einer vom Talort herführenden Nebenstraße heraufkam und dessen Fahrer den Roadster direkt vor dem Eingang zum Biergarten parkte.
»Nach Ihren Plänen müssen Sie hier bald im Taucheranzug sitzen.« Die Stimme sprach ihn von hinten an und gehörte dem Spider-Fahrer, der über einem Hawaii-Hemd eine braune Lederjacke trug und sich schwungvoll auf den Biergartenstuhl auf der gegenüberliegenden Seite seines Tisches setzte. Volkmar Brambach schob seine Sonnenbrille in das Haar über seiner Stirn, lehnte den linken Arm lässig über die Lehne des freien Stuhls neben sich und blickte Alois Leibacher mit einer Miene an, die wohl cool wirken sollte, als wäre er Tom Selleck aus der TV-Serie »Magnum«.
Alois Leibacher verfluchte insgeheim diese Begegnung und fragte sich, warum er hier ausgerechnet mit dem Leiter des Ausschusses für Technik und Umwelt zusammentreffen musste. Er wollte sich gerade mit der Ausrede eines dringenden Baustellentermins aus dieser ungemütlichen Situation befreien, als die Kellnerin mit zackigen Schritten und gezücktem Notizblock an den Tisch trat, um die Bestellung der beiden Herren aufzunehmen. »Was derf’s sein?« Beide zögerten kurz, und die Kellnerin blickte mit ihren großen braunen Augen abwechselnd beide an, während sie ihre Strickweste über den Ausschnitt ihres Dirndls zog. Leibacher bestellte schließlich ein Mittagsgericht von der Tageskarte, Brambach orderte einen Espresso. Die Kellnerin nickte und wandte sich mit den Worten »Kommt sofort« in Richtung des Gasthauses.
Volkmar Brambach hatte seinen Blick wieder von den schlanken Beinen der Kellnerin gelöst, blieb in seiner betont lässigen Sitzhaltung und wandte sich wieder Alois Leibacher zu. »Der Rat hat beschlossen, in der Sache ›Steighorn-Wasserkraftwerk‹ kein Planfeststellungsverfahren zuzulassen«, sagte Brambach betont langsam und bedächtig, als wollte er mit diesen Worten möglichst tief in der Wunde bohren. Er kostete die Situation aus, dass ihm einmal nicht sein Oberbürgermeister dazwischenfunkte.
Leibacher wusste dies auch ohne Brambach längst und hatte bereits beschlossen, sich aus der ganzen Angelegenheit zurückzuziehen. Zwischen den beiden lag eine eisige Stille, und in diesem Moment schlug eine noch unreife Kastanie zwischen ihnen auf dem Tisch auf, die der Wind von dem großen Baum im Biergarten heruntergeweht hatte. Brambach nahm die Kastanie in die Hand, betrachtete die stachelige Hülle der Frucht und warf sie mit einer betont lässigen Bewegung in die Hecke. »Ach ja, und ich wollte Ihnen noch bei dieser Gelegenheit mitteilen, dass die Tiefbauarbeiten für das neue Kultur- und Kongresszentrum bedauerlicherweise an Ihren Mitwettbewerber aus dem Ostallgäu vergeben wurden«, setzte Brambach hinterher.
Er bezahlte seinen Espresso, wünschte Leibacher mit ironischem Unterton ein schönes Wochenende und lief zu seinem Alfa Spider. Dabei stolperte er über den Fuß des Werbeaufstellers, auf dem mit Kreide die Mittagstisch-Gerichte geschrieben waren, riss diesen dabei um und kam auf der Motorhaube seines Roadsters zu Fall.
Alois Leibacher konnte sich ein hämisches Grinsen nicht verkneifen und machte sich trotzdem mit Genuss über das Schweineschnitzel mit Spätzle her, das ihm die Kellnerin gerade serviert hatte. Dieser Möchtegern-Magnum würde es wohl kaum bewerkstelligt bekommen, ihm aus den verpatzten Stausee-Plänen einen Strick zu drehen. Und was die Vergabe an das Ostallgäuer Tiefbauunternehmen betraf, schien dieser nicht zu wissen, dass die »Leibacher GmbH & Co. KG« daran mehrheitlich beteiligt war.
Völlig ohne erkennbaren Zusammenhang mahnte ihn seine innere Stimme, dass er dringend etwas vorsorglich in Sicherheit bringen musste. Er hatte Kapital in Form von Edelmetall zurückgelegt, auch um damit einen Teil der Baukosten für das Sporthotel abzusichern. Auch wenn er es vielleicht erst in 20 oder 30 Jahren würde verwirklichen können. Er stutzte und wunderte sich über diesen Gedankengang, der ihn aus heiterem Himmel durchfuhr und ihm wie eine machtvolle Eingebung erschien.
Während er auf dem Teller die etwas zu trockenen Spätzle in die Bratensoße rührte, versuchte er, die Eingebung in klare strategische Gedanken zu fassen. Ein Teil des Edelmetalls stammte aus dem Vermögen seines Vaters Alois Leibacher senior, der nach zwei Weltkriegen, der großen Wirtschaftskrise vor und der Währungsreform nach dem Zweiten Weltkrieg sein Barvermögen nur noch in Form von Goldbarren und -münzen sicher aufgehoben wusste. »Gold, mein Sohn, war schon in der Antike und zu allen Zeiten immer ein anerkanntes Tauschmittel, wenn eine Währung nichts mehr wert war. Wenn du Gold besitzt, ist das Vermögen vor jeder Rezession und vor jeder Wirtschaftskrise sicher – und danach kommt in Sachen Werthaltigkeit gleich alles, was aus Beton gebaut ist«, hatte ihm sein Vater eingeschärft, als er 13 Jahre alt war und zum ersten Mal einen Kilo-Goldbarren in der Hand halten durfte. Dieser Moment hatte ihn geprägt wie ein Münzstempel, der mit einem tonnenschweren Schlag aus einer kleinen runden Metallscheibe ein Zahlungsmittel machte. Von da an gab es für ihn kein schöneres Gefühl, als auf einen Stapel von Goldbarren immer noch einen weiteren dieser schweren, glänzenden Metallquader draufzulegen, als wollte er eine Mauer aus purem Gold bauen – eine Staumauer, die vor finanziellen Verlusten bewahren sollte? Alois Leibacher staunte kurz über diese tiefenpsychologische Erkenntnis, wenn sie so zutreffen sollte.
Nein, dachte er, es galt, das Edelmetall-Vermögen vor den Begehrlichkeiten anderer zu bewahren. Vor seiner Ex-Frau, die er viel zu früh in seine Sporthotel-Vision einbezogen hatte, die sich daraufhin bereits als baldige Hotel-Geschäftsführerin wähnte und ihn permanent löcherte, wann sie denn Personal einstellen könne, als noch nicht einmal konkrete Planungen existierten. Vor seiner unreifen Tochter Carola, die gerade in Wien Architektur studierte und ihm damit auf der Tasche lag – und dies vermutlich noch weiterhin tun würde, weil dem Fräulein Tochter ein eigenes Architekturbüro vorschwebte, gleichzeitig aber den anspruchsvollen Lebensstil ihrer Mutter nicht nur übernommen hatte, sondern auch noch übertraf. Vor den Banken, auf deren Kredite er für die Verwirklichung des Hotelbaus angewiesen sein würde, die aber entsprechende Sicherheiten verlangten, und dafür musste er sicherstellen, dass sich diese rein auf das Firmenvermögen beschränkten.
Am besten wäre es, das Edelmetall außerhalb des Landes zu bunkern, riet ihm eine weitere Eingebung, als sich sein Blick wieder auf das Steighorn fixierte und ihm sein Unterbewusstsein signalisierte, den Blick darauf zu richten, was hinter diesem Berg lag.
Ferienhaus. Einmauern. Die beiden Worte durchfuhren blitzartig seinen Geist. Das Ferienhaus im Montafon, das er vor über zehn Jahren für Familienwochenenden gekauft hatte und das auf 1.250 Metern Höhe lag – und zu dem schon längst eine befestigte Zufahrtsstraße führen würde, wenn ihm der Ausbau dieser restlichen Strecke – es war ein knapper Kilometer – ab dem Ende der asphaltierten Straße endlich genehmigt würde –, das Ferienhaus erschien ihm als das geeignete Versteck für die bisher im Tresor gelagerten Goldbarren, die zusammen einen Wert von knapp zwei Millionen D-Mark besaßen.
*
Die Gondel der Seilbahn hatte an diesem Freitagnachmittag nur wenige Fahrgäste, nachdem sich gegen Mittag dunkle Haufenwolken gebildet hatten. Die Sonne zeigte sich nur noch durch einzelne Wolkenlücken, und die vom See aufziehende Bewölkung kündigte ein regnerisches Wochenende an. Die Wetterlage spendierte dafür aber einen eindrucksvollen Ausblick von der auf 1.000 Metern Höhe gelegenen Bergstation auf das östliche Ende des Bodensees und auf einige Gipfel der Schweizer Alpen.
Sie hatten als Treffpunkt die ORF-Sendeanlage vereinbart, die auf dem Gipfel des Pfänders über der Bodenseestadt an der deutsch-österreichischen Grenze stand. Die für regionale Themen zuständige Redakteurin war aus Innsbruck angereist und hoffte, dass ihr Informant auch tatsächlich zum Termin erscheinen würde. Er hatte sich noch einmal beim Sender gemeldet, nachdem er knapp drei Wochen zuvor von ihren Kollegen bei der Demonstration gegen das Steighorntal-Wasserkraftwerk interviewt worden war. Es gäbe eine wichtige Hintergrundinformation, die er kurz nach dem Interview erfahren hätte, und er wirkte bei dem Anruf sehr aufgeregt.
In der Nachrichtensendung vom vorletzten Sonntagabend hatte der Bericht über die Demonstration gerade einmal 30 Sekunden Platz gehabt, und die drei Minuten Interview waren auf zwei Sätze zusammengeschnitten worden. Der Mann machte auf sie einen etwas naiven Eindruck und schien sich jetzt wohl für jemanden zu halten, dem mit einem kurzen Fernsehauftritt der Durchbruch zur Berühmtheit gelingen sollte.
»Wenn im Zusammenhang mit dem Stausee-Projekt nahe der österreichischen Grenze eine zwielichtige Verfilzung verschiedener Unternehmen und Interessenvertreter ans Licht kommt, kann man das Thema durchaus noch mal aufgreifen«, hatte der Chefredakteur bei der letzten Themenkonferenz gemeint. Mit dem Material ließe sich bei nächster Gelegenheit eine Lücke füllen, falls wieder einmal ein anderer Nachrichtenbeitrag nicht rechtzeitig fertig sein sollte. Also wartete Barbara Weißenhöffer gespannt auf ihren anscheinend so bedeutenden Interviewpartner und betrachtete währenddessen den rot-weißen Sendeturm, der für den Empfang des österreichischen Rundfunks in Vorarlberg und im süddeutschen Raum sorgte.
»Sind Sie Frau Weizenhofer?«, fragte ein Mann mit rundlichem Gesicht und Oberlippenbart, der gerade den steilen Fußweg zur Sendeanlage heraufgelaufen kam und nach seiner schweren Atmung zu urteilen über keine sonderlich gute Kondition verfügte, obwohl er kaum älter sein dürfte als sie selbst. Sie hatte sich ihren Interviewpartner etwas eloquenter vorgestellt; angeblich sollte er Lokalpolitiker oder zumindest politisch engagiert und zudem derjenige sein, der diese Demonstration aufgezogen hatte. Aber so wie Gottfried Monschkopf vor ihr stand, entsprach dies nicht dem Bild, das sie sich von diesem Menschen ausgemalt hatte. Sie selbst war eine sportliche Natur Anfang 30, hatte in ihrer Jugendzeit regelmäßig Amateurskirennen gewonnen und musste zu ihrem Leidwesen immer wieder erleben, dass ihr stets nur unsportliche Männer begegneten.
»Weißenhöffer«, stellte sie sich kühl ihm gegenüber vor und betonte dabei die Buchstaben, die er falsch ausgesprochen hatte. Monschkopf reichte ihr die Hand und lüftete ungelenk seine Mütze, unter der verschwitzte und zerzauste Strähnen zum Vorschein kamen. Er sah sich nervös um, als wollte er sicherstellen, dass niemand etwas mitbekommen konnte. Sie hatte den Schlüssel zum Gebäude der Sendeanlage, wo sie in einem kleinen, für das technische Betriebspersonal vorgesehenen Aufenthaltsraum das Gespräch würde führen können, entschied sich aber dafür, die Unterredung draußen abzuwickeln und so rasch wie möglich hinter sich zu bringen.
»Gut, also gleich zum Thema: Sie erwähnten, dass es da neben diesem Stromkonzern ›Hellwatt‹ gewisse Verbindungen gibt, die das Ganze danach aussehen lassen können, dass da gewisse Seilschaften am Werk sind, die, sagen wir mal, versuchen, diesen Stausee am öffentlichen Recht vorbei durchzubringen?«, fragte die Redakteurin und bekam schon bei der Fragestellung den Eindruck, dass ihr Gegenüber damit intellektuell überfordert war. Monschkopf schnappte nach Luft, um sogleich hastig und wild gestikulierend seine Antwort zu liefern.
»Von Seilschaften zu reden, ist noch viel zu harmlos, das, was da passiert, ist ein reiner Größenwahn in Verbindung mit einem skandalösen Plan, eine intakte und schützenswerte Umwelt zu vernichten, nur damit dieser Tiefbauunternehmer, der enge Verbindungen zu ›Hellwatt‹ hat, an dem Stausee ein Hotel bauen kann, dem ist dafür jedes Mittel recht …« – Er fuchtelte dabei herum, worauf sie einen Schritt zurückwich.
Sie musste seinen Redefluss unterbrechen und signalisierte ihm dies mit einer Handbewegung, die »Stopp« bedeutete. Dieser vermeintliche Skandal hatte ihr noch zu wenig Nachrichtenwert; das war zu viel Umweltthema und zu wenig wirtschaftspolitische Brisanz. »Wissen Sie, was in Deutschland mit der Umwelt passiert, ist für die österreichischen Nachrichten nicht so gravierend von Bedeutung, wohl aber die Tatsache, dass fast direkt an der österreichischen Grenze ein Wasserkraftwerk entstehen soll, und das interessiert vor allem die österreichische Stromwirtschaft, weil für die das deutsche Stromnetz einer der wichtigsten Abnehmer ist, Sie verstehen? – Was ist mit diesem Tiefbauunternehmer, können Sie mir da einen Namen nennen?«