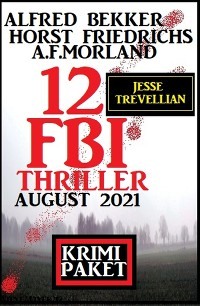Kitabı oku: «12 Jesse Trevellian FBI Thriller August 2021: Krimi Paket», sayfa 22
 |  |

30

Irgendwann dachte Wayne Pytka: Wo bleibt Dudley denn so lange? Die fünf Minuten sind doch schon lange um.
Er stemmte sich aus dem Liegestuhl hoch.
Ein Badetuch diente ihm jetzt als Lendenschurz. Er verließ den Ruheraum und ging am Kaltwasserbecken vorbei. Er trug seine eigenen Holzpantoffel, um keinen Fußpilz zu kriegen.
Im Bassin war Dudley nicht.
Unter der Dusche auch nicht.
Die Tür der Saunakammer stand offen. Normal war das nicht. Wenn Dudley noch drinnen gewesen wäre, wäre die Tür zu gewesen.
Dudley hätte sie aber auch nach dem Verlassen der Kammer geschlossen, damit die Hitze drinnen blieb. Irgendetwas war hier nicht in Ordnung.
»Dudley!«, rief Wayne. War der Freund bereits im Umkleideraum? »Hey, Dud...« Der Name blieb ihm in der Kehle stecken, als er ihn sah.
Dudley Holden lag auf dem Boden. Mit dem Gesicht nach unten.
War ihm die Hitze zu viel geworden? Hatte er einen Kreislaufkollaps erlitten?
»Dudley!«, stieß Wayne heiser hervor. Er beugte sich zu ihm hinunter, schob die Hände unter seine Arme, zerrte ihn irgendwie aus der Kabine.
Er spürte den Schweiß des Freundes an seinen Fingern. Und etwas Klebriges. Alarmiert riss er die Hände zurück. Fassungslos starrte er auf seine Finger. Sie waren rot. Blut klebte an ihnen. Dudleys Blut!
Wayne drehte Dudley auf den Rücken, und dann stockte ihm für einen Moment der Atem.
Entsetzt wich er zurück, als er begriff, dass Dudley Holden erschossen worden war. Fast in seiner Gegenwart. Er war nur ein paar Meter entfernt gewesen, als es passiert war...
 |  |

31

Gore Gandolfini stieg in seinen Wagen und fuhr los. Er beschloss, seinem Auftraggeber zu erklären, dass er kein Dummkopf war. Niemand durfte Gore Gandolfini unterschätzen. Auch dann nicht, wenn man ihn recht großzügig bezahlte.
Deshalb holte er sein Mobiltelefon heraus und wählte die Nummer des Mannes, der ihn nun schon für zwei Hits engagiert und ihm einen dritten in Aussicht gestellt hatte.
Sein Auftraggeber meldete sich.
»Raten Sie mal, wer dran ist«, sagte der Killer.
»Was soll das?«, sagte der andere unfreundlich. »Wer...«
»Gandolfini ist der Name. Gore Gandolfini. Klingelt’s bei Ihnen?«
Es war zu hören, dass der andere kurz perplex war. »Verdammt, wie...«
»Wie ich hinter Ihr Geheimnis gekommen bin?« Gandolfini lachte. »Oh, das war nicht allzu schwierig. Ich bin Ihnen letztens bis nach Hause gefolgt. Sollten wir einander also irgendwann Wiedersehen, können Sie sich die kindische Maskerade sparen.«
»Sonst noch was?«, fragte der andere spröde.
»Ja«, gab der Berufs-Killer zur Antwort. »Andrew Holden hat nach seiner Sekretärin und seiner Frau nun auch seinen Sohn verloren.«
»Aha.«
»Wollen Sie hören, auf welche Weise?«
»Nicht am Telefon. Außerdem werde ich es ohnedies morgen in der Zeitung lesen.«
»Und wie verbleiben wir nun?«, erkundigte sich Gandolfini.
»Ich muss Sie bitten, mich nicht mehr anzurufen«, sagte der andere eindringlich.
»Sie sagten, ich könne eventuell mit einem weiteren Auftrag rechnen.«
»Das ist richtig.«
»Wann?«
»Ich melde mich bei Ihnen.«
»Ich hab nicht immer nur für Sie Zeit«, sagte Gandolfini. »Ich bin ein gefragter Mann.«
»Sie hören von mir«, sagte der andere kühl. »Schon bald.«
Grinsend legte der Killer auf. Er fühlte sich gut.
 |  |

32

Verstörung allerseits. Das war verständlich. Vor Kurzem hatte Dudley Holden mit Zoe Manson, Rachel Jedee und Wayne Pytka noch Tennis gespielt, und vor kurzem hatte Dudley Holden mit Wayne Pytka noch in der Sauna geschwitzt - und nun war er tot. Jemand hatte ihn erschossen. Wie seine Mutter.
Zoe Manson und Rachel Jedee weinten. Wayne Pytka war leichenblass. Wir sprachen mit ihnen in der Kantine, während die Kollegen von der City Police in der Sauna ihren Job taten.
Zoe, Dudleys Freundin, kam darüber nicht hinweg, dass sie mit ihm kurz vor seinem gewaltsamen Ende noch Differenzen gehabt hatte. Er hatte sich über sie geärgert, weil sie so schlecht gespielt hatte und so zur Mutter einer saftigen Niederlage geworden war, erzählte sie uns.
»Er nahm das Spiel so tierisch ernst«, sagte sie traurig. Sie putzte sich zum wiederholten Mal die Nase. »Wir ändern wollten bloß ein bisschen Spaß haben.«
Rachel Jedee und Wayne Pytka nickten.
»Ich habe gesagt: ›lch spiele nie wieder mit diesem Verrückten.‹«, berichtete Zoe Manson. »Das tut mir jetzt furchtbar Leid. Ich hätte es mir verkneifen sollen. Ich wusste doch, wie er war. Jetzt kann ich ihm nicht mehr sagen, dass ich bedauere, was ich gesagt habe.«
Sie weinte haltlos in ihr völlig durchnässtes Taschentuch.
Niemand hatte den Mörder gesehen. Er schien eine Tarnkappe getragen zu haben. Das Ganze sah nach der grauenvoll-hochklassigen Arbeit eines abgebrühten Profis aus. Der Mann hatte hier total kaltschnäuzig seinen Auftrag erledigt, und ich fragte mich, von wem er ihn bekommen hatte.
In Andrew Holdens engstem Umfeld hatte das große Sterben begonnen, und ich befürchtete, dass die blutige Serie noch nicht zu Ende war.
Der Kerl, der mir vier platte Reifen beschert hatte, wollte, dass ich die Hände in den Schoß legte. War er der Killer? Wenn er, wie er behauptete, über jeden meiner Schritte Bescheid wusste, musste er auch jetzt in meiner Nähe sein. Ich blickte mich so unauffällig wie möglich um. Aber mir fiel niemand auf, der dieser Mann hätte sein können.
Er hat geblufft, sagte ich mir. Er weiß mit Sicherheit nicht über all meine Schritte Bescheid, aber doch über einige, deshalb kann ich nie sicher sein, dass er nicht in meiner Nähe ist.
Wir sahen uns in der Sauna um, sprachen mit den Cops und mit dem Kantinenpächter. Auch mit einigen Tennisspielern redeten wir. Einen brauchbaren Hinweis auf den Täter konnte uns keiner geben...
Tags darauf erfuhren wir, dass Dudley Holden mit derselben Waffe erschossen worden war wie seine Mutter. Dieselbe Waffe musste nicht automatisch heißen, derselbe Killer. Ich ging aber trotzdem davon aus, und es hätte mich schon sehr gewundert, wenn ich damit falsch gelegen hätte.
 |  |

33

Die Zeitungen berichteten nicht nur über den Mord an Dudley Holden. Sie brachten auch das Phantombild, das Peiker, unser »Zeichner«, nach den bisweilen recht konträren Angaben von Mr. und Mrs. McFadden angefertigt hatte. In der Bildlegende stand, dass so der Mann aussehen könnte, der in der U-Bahn-Station hinter Yvonne Bercone gestanden hatte.
Im Laufe des Vormittags klopfte jemand an unsere Bürotür. Milo war nicht anwesend. Er hatte eine Besprechung mit unseren Kolleginnen June Archibald und Annie Lamontino.
Ich rief: »Ja!«
Die Tür öffnete sich, und ein mittelgroßer Mann, der eine entfernte Ähnlichkeit mit Hugh Grant hatte, trat ein. »Sind Sie Special Agent Trevellian?«, erkundigte er sich.
Ich nickte. »Was kann ich für Sie tun?«
»Mein Name ist Zalman Simaszko«, stellte er sich vor. »Ich bin Wallstreet Broker. Geboren in Warschau. Seit zehn Jahren amerikanischer Staatsbürger.«
»Was haben Sie auf dem Herzen, Mr. Simaszko?«, wollte ich wissen.
»Sie suchen mich«, sagte der gebürtige Pole.
Ich sah ihn überrascht an. »Ich suche Sie?«
Er nickte. »Das FBI.«
»Nicht, dass ich wüsste.«
Er legte eine Zeitung auf meinen Schreibtisch und zeigte auf Peikers Phantombild, das ihm nicht im Entferntesten ähnlich sah. »Das bin ich«, behauptete er.
Mein Blick pendelte zwischen ihm und dem Phantombild hin und her. »Sind Sie sicher?«
»Sie suchen den Mann, der hinter Yvonne Bercone stand«, sagte Zalman Simaszko. »Das bin ich.«
Ich nickte. »Jetzt verstehe ich.« Ich bot ihm Platz an.
Er setzte sich, und legte das linke Bein über das rechte. »Was möchten Sie wissen?«
»Was haben Sie gesehen?«
Simaszko zuckte mit den Achseln. »Eigentlich nichts. Ich wartete mit all den anderen Leuten auf den Zug. Yvonne Bercone stand vor mir. Der Zug fuhr in die Station ein, und plötzlich stand das Mädchen nicht mehr vor mir.«
»Kann jemand sie gestoßen haben?«
Zalman Simaszko hob beide Hände. »Also ich habe sie bestimmt nicht...«
»Und jemand anders?«, fiel ich ihm ins Wort.
Simaszko schüttelte den Kopf. »Mir ist niemand aufgefallen. Ich hätte das merken müssen. Sie stand ja unmittelbar vor mir. Aber ich war natürlich durch die Ankunft des Zuges abgelenkt.«
»Haben Sie Yvonne Bercone auf die Gleise fallen gesehen?«, wollte ich wissen.
»Nein...«, sagte Simaszko zuerst. Doch dann: »Das heißt...« Erlegte den Zeigefinger auf seine Lippen. »Vielleicht ja... Irgendwie... Aus den Augenwinkeln... Auf jeden Fall nicht richtig bewusst... Erst als der Zug sie erfasste...« Er holte tief Luft. »Es war grauenvoll... Mir wurde schlecht... Mein Verstand hakte aus... Mir fehlen einige Minuten in meiner Erinnerung... Das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich mich nicht mehr in der U-Bahn-Station befand, sondern auf der Straße. Ich muss die Treppe hinaufgerannt sein, ohne es mitbekommen zu haben.«
»Dass Yvonne gestoßen wurde, schließen Sie also aus«, sagte ich. '
»Weitgehend«, schränkte Zalman Simaszko ein.
»Nun«, sagte ich, »dann ist sie entweder gefallen oder - gesprungen.«
Simaszko riss die Augen auf. »Grundgütiger! Wenn sie gesprungen ist...«
»...war es Selbstmord«, sagte ich ernst. »Dann hat sie sich mit voller Absicht das Leben genommen!«
Milo und ich sprachen zwei Stunden später mit Yvonne Bercones Vater. Für ihn war es undenkbar, dass seine Tochter freiwillig aus dem Leben geschieden war.
Hatte sie ein plötzlicher Schwächeanfall das Leben gekostet?
Wir redeten mit dem Mediziner, der sie obduziert hatte. Er sagte, er habe keine Anzeichen dafür gefunden.
Yvonne Bercones Tod war und blieb für uns ein Rätsel, und ich fragte mich: Werden wir es jemals lösen können?
Als wir in unser Office zurückkamen, lag ein Brief auf meinem Schreibtisch. Ich schlitzte den Umschlag mit dem Finger auf.
Keine Anrede, keine Unterschrift. Auf dem Blatt, das ich entfaltet hatte, stand lediglich in krakeliger Schrift, vermutlich von einem Rechtshänder mit der linken Hand geschrieben:
Wer nicht hören will, muss fühlen!
Ich ließ das Blatt von einem unserer Experten untersuchen. Es befanden sich nur meine Fingerabdrücke darauf. Auf dem Kuvert waren noch einige andere Prints, aber mit Sicherheit nicht die des Absenders.
Der Bursche war vorsichtig, und er schien an alles zu denken. Aber irgendwann würde er einen Fehler machen. Den machen so gut wie alle. Und dann hatten wir ihn.
Mein Telefon läutete. Ich griff nach dem Hörer und nahm ihn vom Apparat. »Trevellian.«
»Oh...! Äh...!« Nervöses Lachen. »Ich habe nicht damit gerechnet, Sie so schnell ans Rohr zu kriegen, Jefe.«
Es gab nur einen, der mich Jefe nannte. Und es gab nur einen, der das »r« so rollte: Manuel C. Das C stand für Cerres, aber das wussten nur wenige.
»Mucho?«, sagte ich, denn das war sein Spitzname. Weil bei ihm alles »mucho« war.
»Si«, sagte er. Er hatte lange nichts mehr von sich hören lassen. »Ja, Jefe. Ich bin es - Mucho.« Er war ein abgefeimter FBI-Informant. Ein geschäftstüchtiger Spitzel, der aus jeder noch so »weichen« Information das Maximum für sich herauszuholen versuchte.
»Wie geht’s denn so?«, fragte ich.
»Oh, mir geht es mucho gut, Jefe«, antwortete Manuel C. Es hörte sich aber nicht so an. Ich hatte eher das Gefühl, dass er unter großem Stress stand.
»Wieso haben wir so lange nichts von dir gehört?«, wollte ich wissen.
»Ich war im Ausland, Jefe.«
»Urlaub auf Staatskosten?«
»Ein Versehen des Richters«, behauptete Mucho. »Eigentlich wollte er mich freisprechen.«
»Und jetzt bist du also wieder draußen.«
»So ist es, Jefe.«
»Prima, dass du dich zurückmeldest.«
»Und gleich mit mucho Neuigkeiten.«
»Hört sich gut an.«
»Ich habe heute ganz zuf ällig ein Gespräch belauscht, Jefe.«
»Wer redete mit wem?«, fragte ich. »Und worüber?«
»Ein Profi-Killer mit seinem Auftraggeber«, gab Mucho zur Antwort. »Über Mord.«
Ich horchte auf. »Über Mord an wem?«
Mucho lachte blechern. »Sorry, Jefe. Ich kann Ihnen am Telefon nicht alles verraten. Sonst bleibt mir nichts mehr, das ich verkaufen kann. Das verstehen Sie doch, oder?«
»Mach mir den Mund mit ein paar Namen wässrig, Mucho!«
»Yvonne Bercone. Laura Holden. Dudley Holden... Reicht das, Jefe?«
»Was hast du gehört?«
»Das erzähle ich Ihnen mit mucho Vergnügen für 200 Dollares.«
»Wann und wo?«
Er nannte eine aufgelassene Zementfabrik in Richmond. Da wollte er auf mich warten. Aber er würde nur reden, wenn ich bereit wäre, mich von 200 Bucks zu trennen. Und ich dürfe nur meinen Partner mitbringen. Sonst niemanden.
»Seit wann stellst du solche Bedingungen, Mucho?«, fragte ich befremdet.
»Ich muss mucho vorsichtig sein, Jefe.«
»Hat man dir dazu im ›Ausland‹ geraten?«
»Si, Jefe«, sagte Manuel C.
»Okay. Agent Tucker und ich fahren sofort los.«
»Ich freue mich mucho, Sie beide wiederzusehen«, sagte der Spitzel und legte auf.
Ich ließ den Hörer auf meinen Apparat klappern und erhob mich. Gleichzeitig informierte ich Milo. Das Meiste hatte er bereits mitbekommen.
Ich brauchte nur im Telegrammstil einige wenige Lücken zu füllen...
Während der Fahrt rätselten wir herum, was Mucho zu Ohren gekommen sein mochte.
Nicht alle Informationen waren in der Vergangenheit das Geld wert gewesen, das er im Voraus verlangt hatte. Er hatte uns schon so manche Niete angedreht.
Mucho war eben nicht Hank Hogan. Niemand war wie Hank Hogan. Deshalb war der blonde Hüne ja auch unser bester und zuverlässigster V-Mann. Und unser Freund.
Was von dem kam, hatte immer Hand und Fuß, war hervorragend recherchiert und wurde nicht bloß als vage Vermutung in den Raum gestellt.
Dennoch hatte uns auch Mucho schon des Öfteren mit guten Informationen versorgt. Hoffentlich würde das auch diesmal der Fall sein.
Ich verlangsamte die Fahrt, als die Zementfabrik in Sicht kam. Ein graues Monstrum. Kantig. Klotzig. Extrem hässlich. Ein Zweckbau, den die Zeit überholt hatte.
Es war wohl völlig unrentabel geworden, in diesem veralteten Werk zu produzieren, und da eine Umrüstung zumeist mehr kostete als die Errichtung eines neuen Betriebes, hatte die Firmenleitung offensichtlich das Handtuch geworfen und sich für einen neuen Standort entschieden.
Ich steuerte meinen roten Jaguar XKR auf das große Areal und ließ ihn ausrollen. Wir stiegen aus und ließen unseren Blick schweifen.
Hallen mit staubigen Fassaden. Silos, die durch rostiges Gestänge, Röhren oder Schächte miteinander verbunden waren. Still stehende Förderbänder. Leere Abfüllanlagen. Morsche Paletten. Auf gerissene Zementsäcke. Der einstige Produktionslärm war einer geradezu gespenstischen Stille gewichen.
Milo sah mich an. »Und wo ist Mucho?«
»Das wüsste ich auch gern«, gab ich zurück. Der Wind blies mehligen Staub über unsere Schuhe.
Milo kniff die Augen zusammen. »Ob er uns beobachtet?«
»Möglich. Vielleicht ist er aber auch noch nicht hier.«
»Vielleicht kommt er überhaupt nicht.«
»Warum sollte er uns hierher bestellen und dann nicht erscheinen?«
Milo hob die Schultern. »Angenommen, der Killer hat mitgekriegt, dass Mucho etwas gehört hat, was nicht für seine Ohren bestimmt war. Dann warten wir hier bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auf ihn.«
Ich empfahl meinem Freund und Kollegen, nicht so schwarz zu sehen, und forderte von ihm eine etwas positivere Einstellung ein.
Er rümpfte die Nase und fischte seine SIG Sauer heraus.
»Irgendetwas ist hier faul, Jesse«, murmelte er.
Und fast im selben Moment fiel ein Schuss!
Ich duckte mich und griff zur Waffe. Milo hatte sich fallen lassen. So sah es jedenfalls zuerst für mich aus.
Aber dann bemerkte ich sein schmerzverzerrtes Gesicht, sah, dass er blutete, und meine Nackenhärchen sträubten sich.
Der Schuss hatte meinen Freund und Kollegen von den Beinen geholt. Die Kugel hatte seinen Oberschenkel getroffen.
»Milo!«, stieß ich entsetzt hervor.
»Kümmere dich nicht um mich«, ächzte mein Partner. »Hol dir den Kerl!« '
Ein zweiter Schuss fiel. Das Projektil sauste haarscharf an meinem Kopf vorbei.
Ich kreiselte herum.
Der Schütze war nicht zu sehen.
Mucho war das mit Sicherheit nicht. Manuel C. schoss nicht auf Menschen, und schon gar nicht auf G-men. Aber er hatte mit seinem Anruf dafür gesorgt, dass wir hier waren. Manuel Cerres hatte uns in die Falle gelockt, und das nahm ich ihm übel.
Während Milo hinter meinem Jaguar Schutz suchte, stürmte ich mit schussbereiter SIG vorwärts.
Im Schatten eines hohen runden Silos erreichte ich den offenen Eingang einer großen Halle. In unregelmäßigen Abständen fielen weitere Schüsse.
Die Kugeln schlugen vor, hinter und neben mir ein.
Ich schoss auf gut Glück zurück. Keuchend gelangte ich in die Halle.
Ich lief an großen, rostigen Öfen vorbei, in denen nie wieder ein Feuer brennen würde.
Über mir befand sich die löchrige Kugelmühle, in der einst, während sie sich unaufhörlich drehte, Stahlkugeln das Rohmaterial, mit dem sie befüllt worden war, zerkleinert hatten.
Hoch oben, unter dem Dach, tauchte die schemenhafte Gestalt eines Mannes auf. Er hielt ein Gewehr in seinen Händen, legte auf mich an und feuerte.
Ich suchte unter einem breiten Förderband Schutz.
Der Mann lief über einen Metallsteg. Ich nahm ihn ins Visier, zielte mit beiden Händen und drückte mehrmals kurz hintereinander ab.
Die Entfernung war groß.
Ein sicherer Treffer war da nicht zu erwarten. Aber ich verschaffte mir bei meinem Gegner mit meinen Schüssen immerhin Respekt.
Er verschwand aus meinem Blickfeld. Ich hörte ihn eine Leiter herunterklettern. Er war schnell und wendig wie eine Raubkatze.
Ich wechselte meine Position.
Als der Kerl wieder zum Vorschein kam, deckte ich ihn augenblicklich mit Kugeln ein. Von einer Stelle aus, an der er mich nicht vermutete.
Das brachte ihn sichtlich aus der Fassung. Er zuckte zurück, und ich hörte ihn fluchen.
Während er, in Deckung, an meiner für ihn so unerfreulichen Überraschung nagte, versuchte ich, näher an ihn heranzukommen. Ich enterte einen Ofen. Schläuche hingen daneben wie Lianen herab.
Sie dienten mir als Kletterhilfe.
Wieder schoss ich - jetzt schon ziemlich punktgenau - dorthin, wo sich der Killer befand. .
Wer nicht hören will, muss fühlen...
Das hatte mir der Unbekannte mitgeteilt.
Wenn ich die Zügel wunschgemäß schleifen lassen hätte, wären Milo und ich nicht hier gewesen.
Dann hätte mein unbekannter Feind keinen Grund gehabt, die Gangart zu verschärfen. Er versuchte sein Gewehr wieder ins Spiel zu bringen, doch ich ließ es nicht zu.
Jedes Mal, wenn er aus der Deckung hervorzucken wollte, drückte ich ab und trieb ihn wieder zurück.
Das machte ihn wütend. Er war gezwungen zu bleiben, wo er war. Und ich bemühte mich um eine weitere Verringerung der Distanz zwischen ihm und mir.
Verständlich, dass es ihm nicht gefiel, von mir immer mehr in die Defensive gedrängt zu werden.
Er öffnete ein Fenster mit dreckverkrusteten Scheiben.
Tageslicht flutete in die Halle.
Ich feuerte, obwohl der Killer von Stangen, Platten und Rohren geschützt war. Ich hoffte, dass ein Querschläger die Entscheidung brachte, doch der Mann blieb unverletzt.
Er setzte sich ab, ohne dass ich es verhindern konnte.
Ich folgte ihm nicht auf demselben Weg, sondern kletterte hastig nach unten und rannte kurz danach aus der Halle.
Der Schütze war nicht mehr zu sehen.
Ich hetzte um die Halle herum, hörte in der Ferne einen Motor aufheulen und wusste, was das bedeutete.
Doch ich gab noch nicht auf. Ich lief, so schnell ich konnte, bog zweimal scharf um die Ecke und erreichte mit hämmerndem Herzen die Stelle, wo der Killerwagen noch vor wenigen Augenblicken gestanden hatte.
Jetzt war er weg. Die Antriebsräder hatten, als sie sich durchdrehten, dicke schwarze Striche auf den Asphalt geschmiert. Eine Abgaswolke hing noch in der Luft, aber das Fahrzeug war nicht mehr zu sehen.