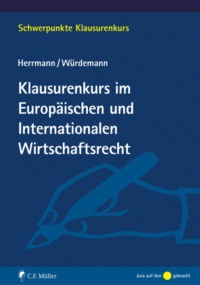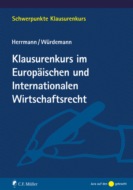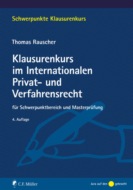Kitabı oku: «Klausurenkurs im Europäischen und Internationalen Wirtschaftsrecht», sayfa 8
Bir şeyler ters gitti, lütfen daha sonra tekrar deneyin
Türler ve etiketler
Yaş sınırı:
0+Hacim:
670 s. 1 illüstrasyonISBN:
9783811484481Yayıncı:
Telif hakkı:
BookwireSeriye dahil "Schwerpunkte Klausurenkurs"