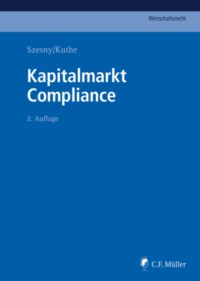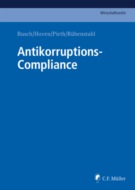Kitabı oku: «Kapitalmarkt Compliance», sayfa 52
2. Handeln für Rechnung der AG
25
Gem. § 71a Abs. 2 AktG ist der Erwerb durch einen Dritten (im Wege der mittelbaren Stellvertretung) auf Rechnung der AG im gleichen Maße wie der offene derivative Erwerb eigener Aktien grundsätzlich verboten und nur in Übereinstimmung mit den Voraussetzungen des § 71 Abs. 1 und 2 AktG gestattet. Der Verbotstatbestand erfasst insbesondere Auftrag, Geschäftsbesorgung oder Kommission, die darauf gerichtet sind, dass der Geschäftspartner Aktien der AG für deren Rechnung, mithin als ihr mittelbarer Stellvertreter erwerben darf oder soll.
26
Diesem steht der Erwerb für Rechnung von der AG abhängiger oder in ihrem Mehrheitsbesitz stehender Unternehmen gleich.
27
Soweit ein Beauftragter als unmittelbarer Stellvertreter der AG tätig geworden ist, gelten §§ 71, 71d S. 2 HS 1 AktG.
III. Erwerb eigener Aktien durch Dritte, § 71d AktG
28
Während § 71a Abs. 2 AktG das grundlegende Rechtsgeschäft (i.d.R. das Auftragsverhältnis) zwischen der AG und ihrem mittelbaren Stellvertreter erfasst, betrifft § 71d AktG Fälle, in denen die AG über einen mittelbaren Stellvertreter eigene Aktien erwirbt und besitzt.
29
Tatbestandlich erfasst die Norm den Fall, dass ein Dritter in eigenem Namen, aber für Rechnung der AG Aktien erwirbt und hält. Es soll vermieden werden, dass die AG eigene Aktien nicht selbst, sondern lediglich über Dritte besitzt und im Rahmen des Erwerbs die strengen Voraussetzungen eines zulässigen Erwerbs eigener Aktien umgeht.[52] Ein solcher Erwerb ist nur zulässig, wenn ein Erwerbsanlass im Sinne des § 71 Abs. 1 AktG vorliegt.
30
§ 71d S. 2 AktG erweitert den Anwendungsbereich auf von der AG abhängige (§ 17 AktG) oder in ihrem Mehrheitsbesitz (§ 16 AktG) stehende Unternehmen, die Aktien der Muttergesellschaft erwerben, und unterwirft diese den gleichen Regeln, die für die herrschende AG gelten. Ebenso eingeschränkt zulässig ist die mittelbare Stellvertretung für abhängige oder im Mehrheitsbesitz der AG stehende Unternehmen.
31
Somit verbietet § 71d AktG den Erwerb eigener Aktien durch Zwischenschaltung eines mittelbaren Stellvertreters, den Erwerb der eigenen Aktien durch ein Tochterunternehmen sowie den Erwerb eigener Aktien durch einen für ein Tochterunternehmen handelnden mittelbaren Stellvertreter außerhalb der Grenzen des § 71 Abs. 1 und 2 AktG.
32
Zulässig bleiben solche Erwerbe bei Vorliegen der jeweiligen Tatbestände der in § 71 Abs. 1 AktG normierten Erwerbsanlässe. Diese sind insoweit bei einem Erwerb durch einen Dritten grundsätzlich, aber nicht in allen Fällen auf die Gesellschaft selbst zu beziehen. Im Einzelnen gilt Folgendes zu den Erwerbsanlässen des § 71 Abs. 1 AktG:[53]
33
| – | Nr. 1: Der Erwerb ist notwendig, um von der AG einen Schaden abzuwenden. |
| – | Nr. 2: Die Aktien sollen Arbeitnehmern der AG zum Erwerb angeboten werden. Den Vorstand der AG trifft auch die in § 71 Abs. 3 S. 2 AktG normierte Pflicht zur Abgabe der Belegschaftsaktien binnen Jahresfrist (§ 71d S. 2 i.V.m. § 71 Abs. 3 S. 2 AktG).[54] |
| – | Nr. 3: Aktionäre der AG sollen abgefunden werden. |
| – | Nr. 4: Der mittelbare Vertreter erbringt keine Gegenleistung oder führt als Kreditinstitut eine Einkaufskommission über Aktien der AG aus. |
| – | Nr. 5: Der mittelbare Vertreter ist Gesamtrechtsnachfolger. |
| – | Nr. 6: Die Möglichkeit des Erwerbs eigener Aktien zur Einziehung über einen mittelbaren Vertreter besteht nicht.[55] |
| – | Nr. 7: Soweit ein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut und Finanzunternehmen eigene Aktien als Handelsbestand halten darf, darf dies auch der mittelbare Stellvertreter.[56] |
34
Für die Einhaltung der Erwerbsgrenze von 10 % (§ 71 Abs. 2 AktG) ist gem. § 71d S. 3 AktG auch auf das Vermögen der AG abzustellen.[57] Es kommt also darauf an, ob die von dem mittelbaren Vertreter bereits erworbenen Aktien und die von der AG bereits gehaltenen Aktien zusammengerechnet die Grenze von 10 % nicht überschreiten.[58] Die Rücklage gem. § 71 Abs. 2 S. 2 AktG, § 272 Abs. 4 HGB muss – auch im Fall eines Erwerbs durch ein abhängiges oder im Mehrheitsbesitz der AG stehendes Unternehmen – von der AG gebildet werden können.
35
Wechselseitige Beteiligungen im Sinne des § 19 AktG können allenfalls vorübergehend bestehen, da Aktien der herrschenden Gesellschaft gem. § 71d S. 2 AktG durch ein Tochterunternehmen nur erworben werden dürfen, wenn die Voraussetzungen des § 71 Abs. 1 und 2 AktG vorliegen, und darüber hinaus der Veräußerungspflicht aus §§ 71a, 71d S. 4 AktG unterliegen.
IV. Inpfandnahme eigener Aktien, § 71e AktG
36
§ 71e AktG stellt die Inpfandnahme eigener Aktien dem Erwerb eigener Aktien gleich und begründet so ein grundsätzliches Verbot, eigene Aktien als Pfand zu nehmen. Die Inpfandnahme ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen des § 71 Abs. 1 und 2 AktG erfüllt sind.
1. Begriff der Inpfandnahme
37
Inpfandnahme ist die rechtsgeschäftliche Begründung von Pfandrechten (§§ 1205, 1206 i.V.m. §§ 1292, 1293 BGB oder § 1274 i.V.m. § 398 BGB). Regelmäßig sind dies Fälle eines Ersterwerbs eines Pfandrechts durch Bestellung nach § 1206 BGB an einer Namensaktie oder Inhaberaktie oder die Verpfändung der Aktien nach § 1274 BGB.[59] Ferner ist auch die Inpfandnahme eigener Aktien als Kaution von leitenden Angestellten oder Vorstandsmitgliedern sowie die Inpfandnahme aufgrund allgemeiner Geschäftsbedingungen erfasst.[60] Entscheidend ist, dass dem Inhaber des Rechts eine Verwertungsbefugnis erteilt wird.[61]
38
Der Pfandrechtserwerb kraft Gesetzes unterfällt dagegen grundsätzlich nicht dem Verbot des § 71e AktG.[62] Dies gilt allerdings nicht uneingeschränkt. Für die Fälle des § 401 BGB, in denen ein Pfandrecht gem. der gesetzlichen Vorschrift mit übergeht, wenn die zugrunde liegende Forderung rechtsgeschäftlich abgetreten wird, liegt der Schwerpunkt der Betrachtung in dem rechtsgeschäftlichen Erwerbstatbestand. Daher muss in diesem Fall trotz gesetzlicher Anordnung des Übergangs des Pfandrechts das Verbot des § 71e AktG eingreifen.[63]
39
Ferner unterfällt das Pfändungspfandrecht gem. § 804 ZPO als gesetzliches Pfandrecht nicht dem Verbot des § 71e AktG.[64]
40
Mit einem Verweis auf § 71a AktG schließt die Regelung in § 71e AktG auch Umgehungsgeschäfte aus. Finanzierungsgeschäfte der AG, die es einem Dritten ermöglichen sollen, Gesellschaftsansprüche und deren Besicherung durch Pfandrechte zu erwerben, sind unzulässig und nichtig.[65] Erfasst werden auch Auftrags- und Geschäftsbesorgungsverhältnisse nach § 71a Abs. 2 AktG, nach denen ein Dritter als mittelbarer Stellvertreter der AG oder eines Tochterunternehmens tätig werden soll, wenn die AG selbst die Aktie nach §§ 71 Abs. 1 oder Abs. 2 AktG nicht als Pfand annehmen darf. Auch in diesen Fällen gilt wiederum die Ausnahme für laufende Geschäfte von Kreditinstituten oder Finanzdienstleistungsinstituten.
2. Rechtfertigender Anlass der Inpfandnahme
41
Eigene Aktien dürfen somit nur in Pfand genommen werden, wenn ein Erwerbsanlass im Sinne des § 71 Abs. 1 AktG vorliegt und die zusätzlichen Voraussetzungen des § 71 Abs. 2 AktG erfüllt sind. Praktisch relevant ist der Fall, wenn die Aktien zur Schadensabwehr gem. § 71 Abs. 1 Nr. 1 AktG in Pfand genommen werden.[66] Ein solcher Fall tritt regelmäßig ein, wenn die AG zur Sicherung einer früher begründeten Forderung, für die andere Sicherungsmittel nicht verfügbar sind, eigene Aktien in Pfand nimmt.[67]
42
In Betracht kommt weiter eine Anwendung von § 71 Abs. 1 Nr. 4 AktG, etwa wenn eine bestehende Forderung ohne wirtschaftlichen Gegenwert nachträglich besichert werden soll und die AG hierfür eigene Aktien unentgeltlich in Pfand nimmt.[68] Unentgeltlichkeit kann allerdings in Fällen einer gleichzeitigen Stundung, Zinsverbilligung oder Erweiterung eines Kreditrahmens im Nachhinein nicht angenommen werden, da der Gläubiger damit ein Recht oder eine Rechtsposition aufgibt; hierin ist eine Gegenleistung und damit ein Entgelt zu sehen.[69] Eine Unentgeltlichkeit ist praktisch nur dann gegeben, wenn der Schuldner nachträglich das Pfandrecht bestellt, ohne dass dem Gläubiger anderenfalls ein Recht zur Kündigung oder zur Zinserhöhung zugestanden hätte.[70]
43
Ferner ist die Inpfandnahme eigener Aktien im Rahmen eines Ermächtigungsbeschlusses ohne Zweckvorgabe nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG denkbar,[71] wenn auch praktisch kaum relevant.
3. Ausnahmetatbestände
44
Eine Ausnahme von dem Verbot der Inpfandnahme gilt für laufende Bank- und Finanzierungsdienstleistungsgeschäfte nach § 71e Abs. 1 S. 2 AktG. Im Rahmen des laufenden Geschäfts dürfen Kreditinstitute oder Finanzdienstleistungsinstitute eigene Aktien bis zur Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals als Pfand annehmen.
3. Teil Transaktionsbezogene Compliance › 10. Kapitel Erwerb eigener Aktien › C. Ausnahmen vom Erwerbsverbot
C. Ausnahmen vom Erwerbsverbot
45
Die Zahlung des Erwerbspreises stellt keine verbotene Einlagenrückgewähr dar und der Erwerb eigener Aktien ist demnach im Sinne des § 57 Abs. 1 S. 2 AktG zulässig, wenn ein Tatbestand des § 71 Abs. 1 AktG erfüllt ist.[72] Dieser Katalog ist abschließend. Der Vorstand muss vor Erwerb eigener Aktien prüfen und durch organisatorische Maßnahmen sicherstellen, dass nachfolgende aktienrechtliche Voraussetzungen erfüllt sind.
I. Schadensabwehr
46
Die AG darf gem. § 71 Abs. 1 Nr. 1 AktG eigene Aktien erwerben, wenn
| (i) | ein schwerer, unmittelbarer Schaden bevorsteht und |
| (ii) | der Erwerb eigener Aktien zur Abwehr notwendig ist. |
47
Der Erwerbstatbestand der Schadensabwehr ist restriktiv auszulegen, da er für den Vorstand eine Sonderkompetenz begründet.[73] Vor dem Hintergrund der Regelung des § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG darf der Vorstand eigene Aktien als finanzpolitisches Instrument nur mit entsprechender Ermächtigung durch die Hauptversammlung erwerben.[74] Der Erwerbstatbestand der Schadensabwehr ermöglicht dem Vorstand nur ausnahmsweise ein eigenmächtiges Handeln zum Erwerb eigener Aktien ohne Beteiligung der Hauptversammlung.[75] Diese Sonderkompetenz greift nur ein, wenn eine Ermächtigung durch die Hauptversammlung nicht einholbar ist.[76] Soweit eine Beteiligung der Hauptversammlung aus Zeitmangel, z.B. bei Gefahr im Verzug, nicht möglich ist, darf der Vorstand zur Abwehr eines Schadens eigene Aktien erwerben.[77] Der Ausnahmetatbestand ist jedoch keine Grundlage dafür, dass der Vorstand grenzenlos ohne Beteiligung der Hauptversammlung eigene Aktien erwirbt.[78]
1. Schadensbegriff
48
Der Schadensbegriff erfasst jede Vermögenseinbuße im Sinne der §§ 249 ff. BGB, die ohne den Erwerb eintreten würde. Hierzu zählt grundsätzlich auch entgangener Gewinn.[79] § 71 Abs. 1 Nr. 1 AktG kann jedoch nicht als Grundlage herangezogen werden, um Spekulationsgewinne in eigenen Aktien zu erzielen. Daher fällt der entgangene Spekulationsgewinn ebenso aus dem Schadensbegriff wie der mit dem Kursrückgang in einem etwa vorhandenen Bestand an eigenen Aktien verbundene Wertverlust.[80] Es muss ein Schaden der Gesellschaft vorliegen, nicht der Gesellschafter.[81]
49
Als Schaden ist der gezielt gegen die AG geführte Angriff (Baisse) zu nennen, dessen Ziel die Zerstörung der Kreditwürdigkeit der AG ist.[82] Der Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 1 AktG zwecks bloßer Kurspflege ist hingegen unzulässig.[83]
50
Schließlich kommt ein zulässiger Aktienerwerb in Betracht, wenn der Schuldner der AG sonst nicht leistungsfähig wäre. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn zur Realisierung der Forderung eigene Aktien gepfändet oder verwertet werden müssen.[84]
51
Eine feindliche Übernahme gilt nach überwiegender Ansicht nicht als Schaden.[85] Dem Vorstand ist es nicht gestattet, eigenverantwortlich eigene Aktien auf Basis von § 71 Abs. 1 Nr. 1 AktG zu erwerben, um eine feindliche Übernahme zu verhindern. Dadurch würde der Vorstand seine Kompetenzen überschreiten und abseits der Erwerbszwecke des § 71 AktG auf die Beteiligungsstruktur der Gesellschaft Einfluss nehmen. Dies geht konform mit dem in § 33 WpÜG festgelegten Vereitelungsverbot.[86] Allerdings kann ausnahmsweise ein Erwerb zur Schadensabwehr im Sinne des § 71 Abs. 1 Nr. 1 AktG in einer Übernahmesituation begründet sein, wenn der Erwerb nicht auf die Erlangung der unternehmerischen Führung der Gesellschaft abzielt, sondern der Übernehmende die Gesellschaft ausplündern oder vernichten will.[87] In diesem Fall ist die beabsichtigte Übernahme als Schaden zu qualifizieren und ein Erwerb eigener Aktien zur Abwehr dieses Schadens zulässig. Der Vorstand muss anhand objektiver Kriterien darlegen und nachweisen, dass eine Schädigungsabsicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit besteht.[88]
52
Die Erhebung und Durchführung einer Anfechtungsklage ist ferner ebenfalls nicht als Schaden im Sinne des § 71 Abs. 1 Nr. 1 AktG zu qualifizieren und berechtigt somit nicht zum Erwerb eigener Aktien, insbesondere um den Anfechtungskläger „hinauszukaufen“.[89] Die Anfechtungsklage dient der Rechtmäßigkeitskontrolle und ist eine legitime Ausübung des Mitgliedsrechts.[90] Der Vorstand darf auf die Ausübung solcher Mitgliedsrechte keinen willkürlichen Einfluss nehmen. In Fällen, in denen eine Kapitalmaßnahme oder eine Strukturentscheidung durch eine Anfechtungsklage blockiert werden, eröffnet das Aktiengesetz die Möglichkeit, ein Freigabeverfahren nach § 246a AktG zu initiieren. In den Fällen, in denen das Freigabeverfahren nicht eröffnet ist, stellt sich für den Vorstand die Frage, ob ein etwaiger durch die mit der Anfechtungsklage einhergehende Verzögerung eintretender Schaden hinzunehmen oder ob der Abkauf der Aktien zu einem überhöhten Preis von Klägern einer Anfechtungsklage zulässig ist.[91] Vor dem Hintergrund der gesetzlichen Wertung, dass mittels einer Anfechtungsklage eine Rechtmäßigkeitskontrolle erfolgen kann, kann die bloße Verzögerung richtigerweise nicht zu einem Schaden führen, der die Gesellschaft berechtigt, sich über das grundsätzliche Erwerbsverbot hinwegzusetzen.[92] Teilweise wird die Anwendbarkeit von § 71 Abs. 1 Nr. 1 AktG zur Verhinderung einer Anfechtungsklage oder um eine Klagerücknahme zu erreichen bejaht, wenn Aktionäre ihr Anfechtungsrecht missbräuchlich und dadurch eine Kapitalmaßnahme oder Strukturentscheidung blockieren, um die Gesellschaft zu einer weit überhöhten Geldzahlung zu bewegen.[93]
2. Schwere des Schadens
53
Die Schwere des Schadens beurteilt sich im Verhältnis zur Größe und Finanzkraft der Gesellschaft.[94] Es muss sich nicht um einen existenzgefährdenden, jedoch mit Blick auf die genannten Kriterien jedenfalls um einen beachtlichen Schaden handeln.[95] Der Schaden muss sich in diesem Sinne von alltäglichen Geschäftsverlusten unterscheiden.[96]
3. Unmittelbares Bevorstehen des Schadens
54
Weiter muss ein Schaden unmittelbar bevorstehen, d.h. ein Schaden muss in überschaubarer Zukunft zu erwarten sein.[97] Für einen zulässigen Erwerb ist es hingegen nicht erforderlich, dass der Schaden sofort eintritt[98] oder mit Sicherheit zu erwarten[99] ist. Die Entscheidung zum Erwerb der eigenen Aktien zur Schadensabwehr beruht daher regelmäßig auf der Einschätzung einer künftigen Entwicklung durch den Vorstand. Fernliegende negative Vermögensentwicklungen allein dürfen nicht zum Anlass genommen werden, eigene Aktien zurück zu erwerben.[100] Ausgehend von der Schadenswahrscheinlichkeit muss ein Schaden in überschaubarer Zeit erwartet werden.[101] Ein unmittelbar bevorstehender Schaden ist nach korrigierender Auslegung der Norm hingegen selbst dann gegeben, wenn Schäden bereits eingetreten sind, aber durch den Rückerwerb eigener Aktien abgewendet werden können.[102]
55
Der Vorstand muss den Sachverhalt, auf dessen Basis er ein schädigendes Ereignis vermutet, sorgfältig aufklären.[103] Soweit er nicht in der Lage ist, die Situation pflichtgemäß einzuschätzen, muss er fachlichen Rat einholen.[104] Die Prüfung, ob der Vorstand im Rahmen seiner Prognoseentscheidung pflichtwidrig einen Schaden angenommen hat, beurteilt sich anhand einer Ex-ante-Betrachtung, also ausschließlich auf der Tatsachengrundlage im Zeitpunkt des Erwerbs.[105] Angesichts der prozessualen Beweislast im Rahmen von Schadensersatzprozessen nach § 93 Abs. 3 Nr. 3 AktG gegen Vorstandsmitglieder empfiehlt sich eine sorgfältige Dokumentation der Aufklärungsbemühungen und Erwägungen, die den Anforderungen der Business Judgement Rule Genüge tun müssen.
4. Notwendigkeit des Aktienerwerbs zur Schadensabwehr
56
Schließlich muss der Erwerb eigener Aktien zur Abwendung eines Schadens notwendig sein. Dies ist der Fall, wenn der Erwerb eigener Aktien nicht nur erforderlich, sondern auch das tauglichste Mittel zur Abwehr des Schadens ist.[106] Die Beurteilung erfolgt anhand objektiver Kriterien, ohne dass die subjektive Einschätzung des Vorstands insofern relevant ist.[107] Somit darf neben dem Rückerwerb keine vernünftige Alternative bestehen, um den Schaden abzuwenden oder zu beseitigen.[108]
57
Es obliegt der Sorgfaltspflicht des Vorstands, im Einzelfall zwischen dem Ziel der Schadensabwehr und dem Risiko eines geplanten Erwerbs abzuwägen.[109]
II. Belegschaftsaktien
58
§ 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG ermöglicht den Erwerb eigener Aktien des Weiteren, um diese Arbeitnehmern der AG oder eines verbundenen Unternehmens im Sinne des § 15 AktG zum Erwerb anzubieten. Die Regelung ist sozialpolitischer Natur und soll die Beteiligung am Unternehmen und die Integration der Arbeitnehmer in das Unternehmen erleichtern.[110]
59
Der begünstigte Personenkreis umfasst nach dem Wortlaut der Vorschrift sowohl gegenwärtige als auch bereits beendete Arbeitsverhältnisse.[111] Der Personenkreis ist nicht abschließend genannt,[112] so dass auch anderen Begünstigten, die zur AG oder zu mit ihr verbundenen Unternehmen in einem vergleichbaren Verhältnis wie ein Arbeitsverhältnis stehen, eigene Aktien zum Erwerb angeboten werden können.[113] Unstrittig sind hingegen Organmitglieder nicht erfasst.[114] Soweit die AG ihren Organmitgliedern ebenfalls Aktien zuwenden möchte, bedarf es einer Ermächtigung durch die Hauptversammlung nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG (s. Rn. 84 ff.). Anderenfalls wäre eine unkontrollierte Selbstentlohnung des Vorstands sowie Gefährdung der Überwachungstätigkeit des Aufsichtsrats denkbar.[115]
60
Einzige Voraussetzung für einen zulässigen Erwerb im Rahmen des § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG ist der Wille des Vorstands, die erworbenen eigenen Aktien Arbeitnehmern oder Arbeitnehmergruppen anzubieten.[116] Diese subjektive Voraussetzung muss im Zeitpunkt des Erwerbs vorliegen, wobei sich die Ernsthaftigkeit des Willens nach außen hin erkennbar manifestieren muss.[117] Zum Nachweis der ernstlichen Absicht bietet sich an, die Eckpunkte der Aktienausgabe zumindest in einer Aktennotiz oder einem Protokoll oder Vermerk festzuhalten.[118] Eine Mitwirkung des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 BetrVG ist nicht erforderlich.[119] Am sichersten ist es, dass der Vorstand als Beweis seiner Absicht einen Beschluss fasst, in dem die realistischen Angebotskonditionen bereits festgelegt werden, wie
| – | maximal erforderliche Aktienanzahl, |
| – | maximaler Erwerbspreis, |
| – | ungefährer Angebotspreis an Arbeitnehmer, |
| – | Regelungen zu Vorzugspreisen oder Gratisaktien sowie |
| – | die Aktienanzahl pro Arbeitnehmer oder Arbeitnehmergruppe.[120] |
Über die Ausgabebedingungen entscheidet der Vorstand im Rahmen seiner Geschäftsführungskompetenz.[121] Die Aktien dürfen unter dem Börsenkurs ausgegeben werden, um einen Anreiz für die Arbeitnehmer für den Erwerb zu schaffen.[122]
61
Ein tatsächliches Angebot an die Arbeitnehmer zum Erwerb oder der spätere Erwerb durch die Arbeitnehmer ist keine (nachträgliche) Voraussetzung für die Zulässigkeit des Erwerbs eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG.[123] Mit anderen Worten gibt es keine zwingende Zweckbindung; vielmehr ist eine Umwidmung zulässig.[124] Soweit daher eigene Aktien für die Zwecke der Arbeitnehmerbeteiligung erworben werden, entfällt die Zulässigkeit des Erwerbs nicht im Nachhinein, wenn der Zweck nachträglich fallengelassen wird oder eine Abnahme durch die Arbeitnehmer nicht erfolgt.[125] Umgekehrt muss der Vorstand zur Begebung von Belegschaftsaktien nicht speziell hierfür angeschaffte (weitere) eigene Aktien erwerben oder neue Aktien schaffen, sondern kann auf ursprünglich zu anderen Zwecken erworbene eigene Aktien zurückgreifen.[126]
62
Der Vorstand muss allerdings zur Erfüllung seiner Sorgfaltspflichten alle ihm möglichen Anstrengungen unternehmen, um den Erwerbszweck durchzusetzen und die Arbeitnehmerbeteiligung zu realisieren. Dabei ist ein unentgeltliches Erwerbsangebot nicht zweckmäßig.[127] Soweit der Vorstand unübliche Angebotskonditionen festlegt, könnte dadurch eine einseitige Benachteiligung der Aktionäre begründet werden.[128] In diesem Fall läge ein Sorgfaltspflichtverstoß des Vorstands vor.