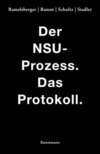Kitabı oku: «Der NSU Prozess», sayfa 2
Die Erkenntnisse aus dem NSU-Prozess
Je nachdem, wie man den Scheinwerfer in diesem Prozess ausrichtete, konnte man sehen, wie der Staat, der behauptet, für die Sicherheit seiner Bürger sorgen zu können, blind war gegenüber dem Terror von rechts. Tino Brandt, ein V-Mann des Thüringer Verfassungsschutzes, hatte die rechte Szene finanziert und ermuntert, viele andere V-Leute hatten in der Szene mitgemischt. Doch Verfassungsschutz, Polizei und Justiz erkannten trotz ihrer Quellen nicht, was sich da zusammenbraute.
Der Prozess hat gezeigt, dass sich viele Vertreter aus Polizei und Verfassungsschutz bis heute damit schwertun, sich und anderen ihr Versagen einzugestehen. Ein Polizist lobte sich, wie freundlich er mit einer Opferfamilie Tee getrunken hatte und erzählte erst auf Nachfrage, dass diese Familie gleichzeitig abgehört wurde. Ein Ermittler erklärte zur Frage, warum die Polizei so lange gegen die Familien der Opfer ermittelt und alle Hinweise auf einen rechtsextremistischen Ursprung der Taten ignoriert hatte, ungerührt: Man solle doch nicht so tun, als wenn es keine türkische Mafia gäbe. Polizeizeugen sagten vor Gericht immer wieder, sie selbst hätten alles richtig gemacht, als sie allein die Angehörigen der türkischstämmigen Opfer für verdächtig hielten.
Der Prozess hat vorgeführt, wie Rechtsradikale immer noch verniedlicht werden – wie schon seit den 1990er Jahren, als der sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf sagte, die Menschen in Sachsen seien »immun gegen Rechtsextremismus«. In einer paternalistischen Geste taten viele West-Politiker damals das offen zur Schau getragene rechtsradikale Gedankengut in den neuen Ländern als Kinderei ab, die sich schon auswachsen werde. Bis heute verharmlost die Gesellschaft rechte Übergriffe als Dumme-Jungs-Streiche und redet rassistische Morde als Auseinandersetzungen zwischen Linken und Rechten klein. Erst wenn, wie in Dresden, der Rassismus die Touristenzahlen dezimiert, wird die antidemokratische Haltung weiter Kreise der Bevölkerung als Problem wahrgenommen.
Im Prozess konnte man sehen, wie die Helfer und Sympathisanten des NSU noch immer eine verschworene Gemeinschaft bilden. Es traten alte Freunde von Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt vor Gericht auf, die mit den dreien über Gewalt geredet, fremdenfeindliche Straftaten vorbereitet und begangen, ihnen beim Untertauchen geholfen hatten. Doch vor Gericht konnten sie sich angeblich an nichts mehr erinnern.
Im Prozess wurde klar, dass all die Menschen im Umfeld des NSU – die Nachbarn, die Freundinnen, der Hausmeister – nichts bemerkt haben wollten vom Treiben der Bande, aber auch von all dem rechtsradikalen und fremdenfeindlichen Gedankengut, das in Ostdeutschland nach der Wende verbreitet und offen zur Schau gestellt wurde. Alles sei ganz normal gewesen, berichteten die Zeugen vor Gericht. Es war für sie normal, dass der Ehemann auf seinem Bauch »Skinhead« tätowiert hat. Es war für sie normal, dass der Mann der Nachbarin auf seinem Facebook-Account das Gedicht stehen hatte: »Der Ali hat Kohle, der Hassan hat Drogen, wir Deutschen zahlen und werden betrogen.« Nein, deswegen seien sie doch nicht rechtsradikal, sagte die Nachbarin. Auch Beate Zschäpe sei »ganz normal« gewesen. »So wie alle.« Die vietnamesische Schwägerin eines Bewohners traute sich dann irgendwann nicht mehr ins Treppenhaus, das an der Wohnung von Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos vorbeiführte.
Vor Gericht wurde nicht nur der Werdegang der Angeklagten seziert, da wurden die Biographien von Unternehmern aus Chemnitz, von Personalsachbearbeitern aus München, Baggerführern aus Jena, Handwerkern aus Zwickau erhellt, vermeintlich unbescholtene Bürger – bis hinter der wohlanständigen Fassade ihre braune Vergangenheit und ihre Gegenwart als Demokratie-Verächter hervorblickten. Man sah, aus welchem Reservoir sich Gruppen wie Pegida und Parteien wie die rechte AfD ihre Anhänger schöpfen.
Man konnte aber auch erkennen, dass es Menschen gibt, die sich trotz ihrer Verstrickung aus der Szene lösten wie der Angeklagte Carsten Schultze, der gestanden hat, dem NSU die Tatwaffe für neun Morde überbracht zu haben, aber dann mit der rechten Szene brach, sein Coming-Out hatte und ein neues Leben anfing: Er studierte Sozialpädagogik und arbeitete in Düsseldorf bei der Aidshilfe. Vor Gericht würgte er Stück für Stück seiner Erinnerungen heraus und belastete sich selbst schwer. Als ihm die Familie eines Getöteten im Gerichtssaal vergab, brach er in Tränen aus.
In diesem Prozess schieben sich verschiedene Schichten übereinander – all die Fehler, die in den Jahren nach der Wiedervereinigung gemacht worden sind. Die Einsamkeit der Jugendlichen, deren Eltern mit der Wende so viel zu tun hatten, dass sie keine Zeit mehr hatten, sich um ihre Kinder zu kümmern. Die Kinder, die dann gegen die Eltern revoltierten – mit der größtmöglichen Provokation, dem Bekenntnis zum Rechtsradikalismus. Vieles kam zusammen: die bröckelnden Autoritäten der DDR, deren frühere Volkspolizisten von den Jungen nur noch mit Spott bedacht wurden. Die West-Importe, die die Behörden in den neuen Bundesländern aufbauen sollten und doch oft nur in den Osten weggelobt worden waren. Die Verunsicherung in den Behörden, was denn nun noch galt und was nicht mehr. Die Nachsicht der Justiz gegenüber den jungen Leuten, die sich doch erst finden mussten in der neuen Welt und die doch klare Ansagen gebraucht hätten. Und all jene Lokalpolitiker, die Rechtsradikale nie bei sich im Ort entdeckten, sondern höchstens im Nachbardorf. Aber dort ging es sie ja nichts an.
Die gefriergetrocknete Welt des Gerichts
Mit großer Präzision, aber mit einem Mindestmaß an Emotion leuchtete das Gericht in München einen Abgrund an Hass, Gewalt und Versagen aus. Die Welt des Münchner Gerichtssaals war eine sehr eigene Welt. Eine Welt wie gefriergetrocknet, in der die Gefühle der Zeugen, der Opfer, der Angehörigen, der Angeklagten durch den Richter sorgfältig extrahiert und dann juristisch vakuumverpackt wurden, so dass nichts mehr stören konnte bei der Suche nach den Fakten. Gefühle waren im Gerichtssaal A101 nicht vorgesehen, sie wurden kurz abgefragt, notiert, dann ins Regal gelegt, zu den anderen Akten. Dieser Prozess verwandelte Hass in Schweigen, Wut in Fragen, Verzweiflung in Beweisanträge. Ein Raum der Regeln. Aseptisch. Wie unter dem grellen Licht über einem Operationstisch wurde im fensterlosen Gerichtssaal eine monströse Reihe von Verbrechen seziert, unter denen Opfer und Hinterbliebene noch immer leiden. Und so sehr die Strafprozessordnung die Regeln vorgibt, so sehr das Gericht versuchte, die Gefühle zu bannen – sie kamen doch beklemmend nahe.
»Reden Sie«, beschwor die Mutter des getöteten Halit Yozgat die Angeklagte. Eindringlich sah die Frau mit dem blauen Kopftuch Beate Zschäpe an. Seit dem Tag, als ihr Sohn im April 2006 getötet wurde, könne sie keine Nacht mehr schlafen. »Sie sind auch eine Dame«, sagte die Mutter zu Zschäpe. »Denken Sie daran, dass ich nicht schlafen kann.« Zschäpe schaute die Frau nicht an. Erst in ihrem Schlusswort wurde klar, dass die Worte der Mutter sie berührt hatten. Sie sei »ein mitfühlender Mensch«, sagte Zschäpe im Juli 2018 zu Mutter Yozgat. Einmal stürzte der Vater von Halit Yozgat nach vorn, warf sich auf den Boden des Gerichtssaals, direkt vor Zschäpe, und zeigte, wie er sein »Lämmchen« gefunden hat. Zschäpe erschrak, senkte den Blick in ihren Laptop. Der Vater am Boden schluchzte auf. Der Sohn, gerade 21, war damals in seinen Armen gestorben.
Es waren Zeugenaussagen wie diese, die für die regelmäßigen Beobachter und Besucher des Prozesses zu den eindringlichsten Ereignissen gehörten. Da gab es die verstörte Witwe eines Opfers, die nicht verstand, was sie noch vor Gericht sagen sollte – nachdem ihr Leben vor 14 Jahren zerstört worden war. Sie herrschte den Richter an, er solle doch Zschäpe fragen, »diese Frau« – sie selbst sei wie eine Verdächtige behandelt worden. Da war der Kollege der getöteten Polizistin Michèle Kiesewetter, der sich in den Gerichtssaal tastete, weil er seit dem Anschlag des NSU das Gleichgewicht nicht mehr halten kann. Er hatte durch den Schuss der Täter schwerste Kopfverletzungen erlitten, sich dennoch danach durch ein Studium gekämpft, um weiter als Polizist arbeiten zu können – im Innendienst. Jedes Mal, wenn er einen Streifenwagen sehe, so gab er zu Protokoll, bange er nun, ob die Besatzung heil nach Hause kommen werde.
Und da war die junge Frau, die als 19-Jährige kurz vor dem Abitur im Lebensmittelgeschäft ihrer Eltern in der Kölner Probsteigasse aushalf. Ein Kunde hatte scheinbar eine Christstollendose im Laden vergessen, seit Wochen stand sie unberührt da. Das Mädchen öffnete die Dose. Als die Bombe explodierte, verbrannte sie die Haare der jungen Frau, zerschnitt ihr Gesicht, schweißte ihr die Augen zu und zerfetzte die Trommelfelle. Aber sie überlebte. Und machte noch im gleichen Jahr das Abitur nach. Sie hat dann studiert und ist heute Chirurgin. Auch ihre Geschwister haben studiert, längst sind alle Deutsche geworden. Die Eltern waren vor Jahren aus dem Iran geflohen. Als die junge Chirurgin am 118. Verhandlungstag als Zeugin vor Gericht aussagte, wurde sie gefragt, ob sie nach dem Anschlag daran gedacht habe, Deutschland zu verlassen. Sie antwortete: Ja, kurz. Doch dann habe sie überlegt, dass die Attentäter genau das bewirken wollten. Und sie sagte: »Nein, jetzt erst recht! Ich lasse mich mit Sicherheit nicht aus Deutschland rausjagen.«
Der NSU-Prozess war auch geprägt von Einsilbigkeit und Schweigen. Vor allem dann, wenn Zeugen aus der rechten Szene vor Gericht erschienen waren. Es waren viele. Sie ließen die Fragen des Gerichts abtropfen an ihren Lederwesten und Szene-T-Shirts, auf denen ständig von »Freedom« die Rede war und auf denen Adler prangten. Über Stunden gaben sie nur Wortfetzen von sich: »Nein«, »nicht dass ich wüsste«, »kann mich nicht erinnern«, »keine Ahnung«. Es waren zermürbende Tage, vor allem für die Opfer-Angehörigen. Sie mussten erleben, wie viele dieser Zeugen den Morden an ihren Männern und Vätern mit demonstrativer Gleichgültigkeit begegneten und kaum Bereitschaft zeigten, ihren Teil zur Aufklärung der Straftaten beizutragen.
Zermürbung
Über mehr als fünf Jahre zog sich dieser Prozess der Erkenntnis – und er trat vom Stadium der Hoffnung auf Aufklärung allmählich in das Stadium der Zermürbung ein. Anfangs hofften noch alle darauf, dass die Hauptangeklagte Zschäpe ihr Schweigen brechen und die Hintergründe der Mordserie preisgeben werde. Dann brachten einzelne Angeklagte mit ihren Geständnissen Bewegung in den Prozess, die Hintergründe des NSU wurden sichtbar. Ein Brandgutachter führte mit mehr als 1000 Fotografien durch den ausgebrannten Unterschlupf und in den Alltag der Terrorzelle. Er führte das Gericht Bild für Bild von der Küche, wo im Kühlschrank noch der Prosecco stand, bis zum Katzenzimmer mit dem Kratzbaum für die zwei Katzen. Und er zeigte Fotos vom Wandtresor, in dem die Handschellen der getöteten Polizistin Kiesewetter lagen, davor im Brandschutt mehrere Waffen.
Auf die Zeit der erschütternden Berichte der Opferfamilien über ihr Leid und ihre Diskriminierung durch die Ermittlungsbehörden folgte die Zeit der juristischen Ränke, der Streit um Zschäpes Verteidiger, die sie ablehnte, aber nicht loswurde. Es begann ein ewiges Hin und Her, Befangenheitsanträge, Gegenvorstellungen, Fragenkataloge, Gutachter, Gegengutachter, Anträge zu Anträgen. Das Gericht ließ sich auf ein zeitraubendes Frage- und Antwort-Spiel mit Zschäpe ein. Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl stellte ihr mündlich Fragen, ihr Anwalt schrieb alles mit. Nach drei, manchmal nach sechs Wochen präsentierte der Anwalt dann Zschäpes Antworten auf die Fragen. Dann schrieben die Richter mit. Dann folgten wieder Nachfragen, wieder drei Wochen Zeit, wieder die ausgefeilten Antworten. Spontane Reaktionen der Angeklagten waren so ausgeschlossen, dafür gab es juristisch ausgefeilte Erklärungen.
Als der Prozess begann, stöhnten die Verantwortlichen am Oberlandesgericht (OLG) München. Die Opferfamilien wollten am Prozess teilnehmen, doch der größte Saal war zu klein. Also baute das OLG den Saal aufwändig um, verbannte die Journalisten und die Besucher auf die Tribüne, schuf Platz für rund 60 Nebenklagevertreter, baute Leinwände ein, auf die die Zeugen projiziert werden konnten, damit auch alle sie sehen konnten. Und das Gericht begrenzte den Zugang zum Gerichtssaal: 51 Besucher hatten dort Platz und 50 Journalisten. In einem sogenannten Windhundverfahren mussten sich die Medienvertreter um die Plätze bewerben – wer als erster kam, hatte einen Platz. Innerhalb kürzester Zeit waren alle Plätze weg. Das war zu schnell für ausländische Medien. Erst das Bundesverfassungsgericht sorgte dafür, dass auch türkische Journalisten zum Zug kamen. Das Akkreditierungsverfahren wurde neu aufgerollt. Der Prozess begann holprig, der Beginn wurde um zwei Wochen verschoben.
So einen Prozess hatte es noch nie gegeben: fünf Angeklagte, 14 Verteidiger, 600 Zeugen, 500 000 Blatt Ermittlungsakten. Das Oberlandesgericht München trieb vor allem die Sorge um, die mehr als 60 Nebenklagevertreter würden das Verfahren unübersichtlich und undurchführbar machen. Doch die Sorge erwies sich als unbegründet. Die Anwälte der Nebenklage waren sehr diszipliniert und arbeiteten zielorientiert und konstruktiv. Es bildeten sich Teams, die sich arbeitsteilig an die Begleitung des Prozesses machten: Die Berliner um Sebastian Scharmer, Peer Stolle und Antonia von der Behrens, die Frankfurterin Seda Başay, die mit Mehmet Daimagüler aus Berlin zusammenarbeitete. Die Hamburger Thomas Bliwier, Doris Dierbach und Alexander Kienzle. Eberhard Reinecke und Edith Lunnebach aus Köln. Und die Münchner Yavuz Narin und vor allem Angelika Lex, die bis zu ihrem frühen Tod im Dezember 2015 die Nebenklagearbeit koordinierte. Zu ihrer Beerdigung kam auch Richter Götzl.
Manche der Nebenkläger machten sich selbst auf die Suche nach Beweisen, die das Bundeskriminalamt übersehen hatte. Und wurden fündig. Manche von ihnen schürften tief in der rechten Szene nach Mitwissern und Unterstützern des NSU und brachten erstaunliche Fakten zutage. Manche von ihnen fragten so pointiert, dass Widersprüche bei den Aussagen der Zeugen offen zutage traten. Aber es gab auch viele Nebenklage-Anwälte, die ihre Zeit im Gerichtssaal nur absaßen und die Sitzungsgelder einstrichen. Und einer vertrat gar eine Mandantin, die es gar nicht gab. Das flog auf, als diese Frau vor Gericht erscheinen sollte.
Die Nebenkläger trieben den Prozess voran, dagegen hielt der Streit um die Verteidiger von Beate Zschäpe das Verfahren über Monate auf. Im Sommer 2015 hatte Zschäpe plötzlich einem Justizwachtmeister mitgeteilt, sie habe kein Vertrauen mehr in ihre drei, von ihr selbst ausgewählten Verteidiger Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl und Anja Sturm. Sie wollte zwei neue. Ihre alten überzog sie mit einer Strafanzeige und blickte sie von diesem Moment an nicht mehr an. Kein Gruß, kein Wort, obwohl sie Ellenbogen an Ellenbogen saßen. Das Gericht gestand ihr am Ende einen neuen Anwalt zu, Mathias Grasel. Ihren zweiten, Hermann Borchert, zahlte das Gericht nicht. Borchert erschien deswegen nur hin und wieder im Gerichtssaal, war aber gleichwohl der Mann, der Zschäpes Verteidigung lenkte. Weil er im Urlaub war, musste das Gericht im Herbst 2015 drei Wochen lang auf die avisierte Erklärung von Zschäpe warten. Gleichwohl mussten die alten drei Verteidiger weitermachen – das Gericht lehnte es ab, sie aus der Pflicht zu entlassen. Sie versuchten, Zschäpe zu verteidigen – obwohl ihre Mandantin das nicht wollte. Viele ihrer Anträge wirkten nach Ansicht von Prozessbeteiligten recht formalistisch. Einen Befangenheitsantrag stellten sie, weil ihnen das Gericht angeblich nicht genügend Vorschuss zahlte, einen anderen, weil auf dem Aktenordner eines Richters das Wort NSU stand – wo doch ihrer Ansicht nach noch nicht erwiesen war, dass es den NSU überhaupt gab. Alle diese Befangenheitsanträge wurden abgelehnt. Am Schluss war Heer, Stahl und Sturm wichtig zu beweisen, dass sie auch unter widrigen Umständen professionell weiterarbeiten. Schließlich stand auch ihre Reputation auf dem Spiel.
Andere Verteidiger wie die des früheren NPD-Funktionärs Ralf Wohlleben versuchten offensichtlich, mit deutlich rechts konnotierten Anträgen bei ihrer Klientel zu punkten. So beantragten sie zum Beispiel einen Demografie-Wissenschaftler zu hören. Er sollte erklären, dass der Begriff »Volkstod«, den Rechtsradikale häufig benutzen, nichts anderes als eine demografische Zwangsläufigkeit sei, wenn weiter Ausländer zuwanderten. Das Gericht lehnte diesen wie auch viele andere Anträge dieser Art ab. Im Plädoyer eines Wohlleben-Verteidigers bekam das Gericht dann sogar reihenweise Hitler- und Göring-Zitate zu hören. Die Anwälte von André Eminger schwiegen fast durchgängig, auch die von Holger Gerlach hielten sich sehr zurück. Und die Anwälte Johannes Pausch und Jacob Hösl, die den Aussteiger Carsten Schultze vertraten, begleiteten ihren Mandanten zu einem frühen und umfassenden Geständnis. Schultze belastete den Angeklagten Wohlleben schwer, deswegen versuchten dessen Anwälte, Schultzes Glaubwürdigkeit zu untergraben. Weder die Bundesanwaltschaft noch das Gericht ließen sich dadurch beeindrucken, der Angeklagte Schultze war mit seinen Aussagen einer der wichtigsten Zeugen des ganzen Prozesses.
Die Angehörigen
Immer wieder wurde in diesem Prozess deutlich, wie sehr sich die Jahre voll ungerechtfertigter Verdächtigungen bei den Angehörigen der Opfer eingegraben haben: Die Ermittler hielten sie für verstockt, für eingesponnen in Mafia-Kreise, in den Drogenhandel. Ihre Nachbarn wurden befragt, ob sie von Liebschaften, Spiel- oder Sex-Sucht der Getöteten wüssten. Die Hinterbliebenen waren beschämt und trauten sich jahrelang nicht mehr auf die Straße. Der Witwe des ersten Mordopfers Enver Şimşek hatten Polizeibeamte ein Bild mit einer blonden Frau gezeigt und erklärt, das sei die heimliche Geliebte ihres Mannes. Er habe zwei Kinder mit ihr. Kein Wort war wahr. Die Witwe war schon dankbar, als ihr ein Polizist nach Monaten sagte, das sei nur eine Finte gewesen, man habe gehofft, so das »Schweigekartell« der Familie zu erschüttern. Auf die Familie Yozgat, deren Sohn in Kassel ermordet worden war, wurde ein verdeckter Ermittler angesetzt, die Anschlüsse von Eltern und Geschwistern wurden monatelang überwacht. Die Witwe eines Mordopfers in München sollte auf Drängen anderer Eltern ihre Tochter von der Schule nehmen. Die Eltern hatten Angst, der Täter aus »türkischem Milieu« könnte auch ihre Kinder treffen, wenn sie in der Pause auf dem Schulhof spielten.
Die Opferfamilien empfanden die Enttarnung des NSU geradezu als Befreiung von einem Alpdruck. Sie erschienen immer wieder im Prozess, um mehr zu erfahren. Sie erlebten, wie das Gericht herausdestillierte, dass die Mordwaffe, eine Česká 83, von einem Waffenhändler in der Schweiz über einen krebskranken Zwischenhändler und einen ostdeutschen Freund in die rechte Szene von Jena gelangte und schließlich dort im Szeneladen Madley an Carsten Schultze übergeben wurde. Und wie der sie dann nach Chemnitz zum NSU brachte. Die Angehörigen hörten im Gerichtssaal, welches Unterstützernetzwerk die drei Untergetauchten hatten. Sie erfuhren, wie rechte Kameraden und Kameradinnen den dreien Wohnungen und Pässe besorgten, für sie Apartments anmieteten, dass der Angeklagte André Eminger Beate Zschäpe sogar als seine Frau ausgab, als sie einmal nach einem Wasserschaden in der Wohnung als Zeugin bei der Polizei aussagen musste.
Viele Angehörige konnten nicht fassen, wie nah Polizei und Verfassungsschutz den drei Untergetauchten immer wieder gewesen waren. Einmal, nach dem Wasserschaden, war Beate Zschäpe sogar im Polizeirevier Zwickau gesessen. Kühn hatte sie behauptet, sie habe in der Wohnung nur die Blumen gegossen. Der Polizist glaubte ihr.
Angeblich wusste keiner, wo sich die drei aufhielten. Dabei war der NSU geradezu umstellt von Spitzeln. Tino Brandt, bestbezahlter V-Mann des Thüringer Verfassungsschutzes, telefonierte sogar mit den untergetauchten Neonazis. Er berichtete darüber dem Verfassungsschutz. Aber Konsequenzen folgten nicht. Auch andere Dienste hatten Spitzel in der Szene, die davon berichteten, die drei wollten nach Südafrika gehen. Auf die Spur aber kamen ihnen die Dienste nicht. Wichtige Informationen wurden nicht beachtet, nicht weitergegeben oder falsch bewertet, V-Leute wurden vor Polizeiaktionen gewarnt. Nicht nur den Angehörigen der Opfer drängte sich angesichts der vom Gericht befragten Verfassungsschutzmitarbeiter und deren V-Männer der Eindruck auf, dass Polizei und Verfassungsschutz fatale Fehler gemacht hatten – auf allen Ebenen und immer wieder.
Obwohl diese Versäumnisse im Prozess offen zu Tage traten, die Fehler der Ermittler vom Gericht ausführlich mitprotokolliert wurden und den Angehörigen der Opfer viel Zeit eingeräumt wurde, um den Schmerz über den Verlust der Ermordeten zu schildern, hinterließ der Prozess bei vielen Nebenklägern einen bitteren Nachgeschmack. Sie hatten dieses Mammutverfahren über all die Jahre verfolgt, waren immer wieder von weit her angereist, hatten Zeit und Kraft geopfert, um dabei zu sein. Sie hatten sich erhofft, dass das Gericht am Ende das Unrecht, das ihnen angetan worden ist, die Unzulänglichkeiten der Behörden und die vielen offenen Fragen im Zusammenhang mit den NSU-Morden zumindest erwähnt. Sie wurden enttäuscht. Richter Manfred Götzl beschränkte sich in seinem nur vier Stunden umfassenden mündlichen Vortrag auf eine knappe, fast kursorische Beweiswürdigung. Kein Wort an die Angehörigen, kein Satz über das Versagen des Staates, nichts zur gesellschaftlichen Bedeutung dieses Verfahrens.
Ein Nebenklage-Anwalt hatte noch wenige Monate vor dem Urteil das Gericht gemahnt: »Ich bin überzeugt davon, dass dieser Senat ein Urteil fällen wird, das der Revision standhält. Ich darf an Sie appellieren: Sprechen Sie ein Urteil, das auch vor der Geschichte Bestand hat.« Er hatte damit vielen Opferfamilien aus der Seele gesprochen. Nach der Urteilsverkündung verließen viele Angehörige das Gerichtsgebäude fassungslos.