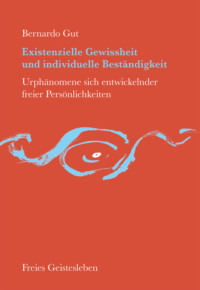Kitabı oku: «Existenzielle Gewissheit und individuelle Beständigkeit», sayfa 2
1. Rechtliche Gebilde –
Gegenstand positiver Rechtssprechung17
In seiner Abhandlung «Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes» (1913) geht Adolf Reinach davon aus, dass die in einem bestimmten Gemeinwesen als verbindlich anerkannten Rechtssatzungen sich in ständigem Fluss und fortlaufender Veränderung befinden. Maßgebend für die Rechtsentwicklung seien die unentwegt wechselnden wirtschaftlichen Verhältnisse und Bedürfnisse sowie die in der Gemeinschaft vorherrschenden sittlichen Anschauungen. So unterscheiden sich die positiv-rechtlichen Bestimmungen, die in dem bürgerlichen Gesetzbuch eines bestimmten Staates enthalten sind, ganz wesentlich von naturwissenschaftlichen und namentlich von mathematischen Sätzen. Dass – um ein Beispiel zu nennen – innerhalb des Rahmens der euklidischen Geometrie beim rechtwinkligen Dreieck die Fläche des Hypotenusen Quadrates gleich der Summe der Flächen der beiden Kathetenquadrate ist, «das ist ein Zusammenhang, der von manchen Subjekten vielleicht nicht eingesehen wird, der aber unabhängig von allem Einsehen besteht, unabhängig von der Setzung der Menschen und unabhängig von dem Wechsel der Zeit»18.
Sehen wir uns demgegenüber folgende Bestimmung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches über «Verwaltung, Nutzung und Verfügung von Errungenschaft und Eigengut im ordentlichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung» innerhalb des Familienrechts an. Art. 201 lautet: «Innerhalb der gesetzlichen Schranken verwaltet und nutzt jeder Ehegatte seine Errungenschaft und sein Eigengut und verfügt darüber»19. Dies ist der seit dem 1.1.1988 gültige Gesetzestext. Nach dem alten Eherecht lauteten die entsprechenden Bestimmungen folgendermaßen: Art. 200: «Der Ehemann verwaltet das eheliche Vermögen. Er trägt die Kosten der Verwaltung …»20 Und Art. 201: «Der Ehemann hat die Nutzung am eingebrachten Frauengut und ist hieraus gleich einem Nutznießer verantwortlich»21.
Deutlich ist erkennbar, dass früher etwas als rechtlich «richtig» galt, das, von der heute vorherrschenden sittlichen Auffassung aus betrachtet, als befremdliches Unrecht erscheint. Aber so wenig die frühere Bestimmung sich als immanent wahr und als unabhängig vom Wechsel der Zeit erwies, so wenig dürfen wir den gegenwärtig geltenden Gesetzeswortlaut als unabänderlich ansehen; und selbst wenn er es wäre – seine aus Inhalt und Form sich zusammensetzende Gesamtgestalt verdankt er der Einsicht der Gesetzgeber und deren Willen, das für richtig Befundene als verbindlich zu erklären.
Sofern wir nur bei derartigen Fallbeispielen der Rechtssetzung bleiben, können wir die Jurisprudenz in der Tat als eine bloße «Notizensammlung von Rechtsgewohnheiten» auffassen. Anders sieht es jedoch aus, wenn wir Reinach folgen und die rechtlichen Gebilde als solche untersuchen, welche den Gegenstand der jeweiligen positiven Rechtsprechung bilden. Hierzu gehören Abmachungen; Verträge aller Art; Verbindlichkeiten, die jemandem aufgedrängt worden sind oder die eine Person freiwillig übernommen hat; Ansprüche, die jemandem erwachsen sind oder die ein Subjekt einem anderen gegenüber erhoben hat; oder – anders formuliert – es zählen dazu sowohl Pflichten und Rechte, denen manche Autoren absoluten Charakter beimessen, als auch solche, die allgemein als von relativer Natur seiend anerkannt werden.
2. Ein Versprechen – und was es impliziert
Als Einstieg in die Analyse relativer Pflichten und Rechte wendet sich Reinach dem Phänomen des Versprechens22 zu. Sehen wir uns hierzu folgendes Beispiel an:
Vor einigen Tagen teilte mir C in einem Gespräch mit, er sei daran, einen Aufsatz über Stefan Zweigs Novelle «Angst» zu schreiben; worauf mir einfiel, dass ich ein Buch besitze, welches einen Essay über diese Novelle enthält. Das erwähnte ich C gegenüber, der sofort sein Interesse bekundete, die betreffende Abhandlung kennenzulernen. Darauf sagte ich ihm: (a) «Ich werde morgen Nachmittag das Buch mitbringen und es Ihnen ausleihen.» Als ich jedoch am folgenden Tag in die Schule ging und den auf mich wartenden C erblickte, wurde mir schlagartig bewusst, dass ich vergessen hatte, das Buch mitzunehmen. Verlegen, konnte ich nur sagen: (b) «Es tut mir leid, ich habe das Buch zu Hause liegen lassen.» C, der eigens gekommen war, um das Buch in Empfang zu nehmen, monierte leicht ungehalten: (c) «Das darf aber nicht wahr sein!»
Ohne von C dazu gedrängt worden zu sein, hatte ich den Satz (a) ausgesprochen und mich dadurch verpflichtet, das in Aussicht Gestellte zu erfüllen. C nahm meine Worte als ernst gemeintes Versprechen auf, und hat daraus den Anspruch hergeleitet, am darauf folgenden Tag das Buch entleihen zu können.
Wie das Beispiel illustriert, entstehen bei einem Versprechen Anspruch und Verbindlichkeit. Daher war es mir selbst peinlich, dass ich das Versprochene vergessen hatte, ein Versehen, welches ich mit dem diffusen: «Es tut mir leid …» zugab. Und deswegen ist es auch verständlich, dass C verärgert reagierte, hatte er doch zu Recht erwarten dürfen, das Buch in Empfang nehmen zu können.
3. Soziale Akte –
ihre Bedeutung für die Erwahrung eines Versprechens
Nachdem unser Einstiegsbeispiel gezeigt hat, was ein Versprechen impliziert, wollen wir im Folgenden unsere kleine Geschichte variieren, um der Frage nachzugehen, wie Versprechen zustande kommen und wirksam werden.
Variation Nr. 1: Hätte ich (a) nicht ausgesprochen, sondern mir den betreffenden Satz nur innerlich gesagt, so hätte ich mir zwar etwas vorgenommen, doch C gegenüber in keiner Weise explizit versprochen, und er hätte nichts von meinem stillen Entschluss erfahren. So wäre C weder veranlasst noch befugt gewesen, anzunehmen, er habe einen Anspruch darauf, dass ich ihm ein Buch brächte. Aller Voraussicht nach wäre C am folgenden Tag gar nicht in die Schule gegangen; das tat er – gemäß dem Ausgangsbeispiel – ja nur, weil er das von mir in Aussicht gestellte Buch abholen wollte.
Variation Nr. 2: Angenommen, ich hätte (a) ausgesprochen, doch C habe meine Worte zwar akustisch vernommen, aber deren Sinn nicht erfasst, und er sei zu verlegen gewesen, um mich zu ersuchen, das Gesagte zu wiederholen; darüber hinaus hätte ich selber nicht gemerkt, dass C meine Worten (d.h. den Satz (a)) nicht verstanden habe: Meinem eigenen Verständnis nach wäre ich dann C gegenüber eine Verpflichtung eingegangen; wohingegen C selbst von einem ihm zustehenden Anspruch, den ich zu erfüllen gehabt hätte, nichts gewusst hätte. Der nichts ahnende C wäre daher – aller Wahrscheinlichkeit nach – weder am folgenden Tag in der Schule erschienen, noch hätte er sich später bei mir nach dem Buch erkundigt. Da er sich meines Versprechens nicht bewusst gewesen wäre, hätte C sich auch nicht veranlasst gesehen, einen Anspruch auf die Verwirklichung der von mir geäußerten, aber nicht eingelösten Intention geltend zu machen. Damit wäre in mir das Bewusstsein allmählich erloschen, der – bzw. schon bald nur noch: einer – Verpflichtung nicht nachgekommen zu sein; und nach einer gewissen Zeitspanne hätte sich schließlich in mir die diffuse Erinnerung an ein eingegangenes Versprechen aufgelöst.
Variante Nr. 3: Diese ergibt sich, wenn wir annehmen, C habe meine Worte (a) nicht verstanden, ich aber sei im Glauben gewesen, er habe sie bewusst vernommen und deren Sinn erfasst; worauf ich ihm, einige Tage danach, das Buch ausgehändigt und dabei bemerkt hätte: (d) «Hier das versprochene Buch; zuerst hatte ich ja vergessen, es mitzunehmen, doch nun kann ich es Ihnen endlich aushändigen.» Hierauf könnte C erstaunt erwidern: (e) «Ich bin ganz überrascht; es war mir gar nicht bewusst, dass Sie mir gesagt hatten, Sie würden mir ein Buch über Stefan Zweig mitbringen und ausleihen …» – In diesem Falle würde mir wahrscheinlich blitzartig klarwerden, dass ich irrtümlicherweise geglaubt hatte, gegenüber C eine Verpflichtung eingegangen zu sein; wusste er doch offensichtlich gar nichts davon, dass ich ihm etwas versprochen hatte.
Überblicken wir das Ausgangsbeispiel und die drei skizzierten Abweichungen, so wird deutlich, dass ein Versprechen nur dann zustande kommt und wirksam wird, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind23:
1. Der Versprechende muss das, was er verspricht, klar und deutlich äußern (mündlich oder/und schriftlich);
2. Der Adressat des Versprechens muss das, wozu sich der Versprechende verpflichtet, inhaltlich erfassen.
Nur wenn diesen Forderungen zweifelsfrei Genüge getan wird, entsteht ein Versprechen sensu stricto, und erst daraus ergibt sich eine Verbindlichkeit des Versprechenden in Bezug auf den Adressaten bzw. erwächst diesem ein Anspruch gegenüber jenem. Somit ist das Zustandekommen eines Versprechens an einen sozialen Akt gebunden, an dem sowohl der Versprechende als auch der Adressat (der nicht notwendigerweise mit dem Begünstigten identisch zu sein braucht) beteiligt sein müssen.
Beide bisher besprochenen Komponenten eines Versprechens – nämlich, was es für die involvierten Rechtssubjekte grundsätzlich impliziert und wie es entsteht – gehören zu den wesentlichen Merkmalen des Rechtsbegriffes Versprechen und hängen nicht von irgendwelchen Bestimmungen positiven Rechtes ab.
4. Relatives und absolutes Erlöschen des Anspruches
Verpflichtung und Anspruch, die beide in dem vollständigen sozialen Akt eines rechtskräftig gewordenen Versprechens begründet werden, stellen Rechtsgebilde relativer Natur dar: der Versprechende hat sich in Bezug auf den Adressaten (und nur relativ zu ihm) verpflichtet; worauf Letzterem gegenüber Ersterem (aber keinem Weiteren) ein Anspruch erwachsen ist. Gleichwie das Entstehen dieses Rechtsgebildes sich aus dem Begriff Versprechen wesensgesetzlich, das heißt: von selbst, ergibt, ebenso gelten auch für das Erlöschen des dem Adressaten zugestandenen Anspruches strenge, begriffsimmanente Zusammenhänge. Auseinanderzuhalten haben wir dabei zwei grundsätzlich verschiedene Fälle:
(i) Der Versprochenhabende erfüllt die von ihm eingegangene Verpflichtung: dadurch wird das zwischen ihm und dem Adressaten geknüpfte Rechtsgebilde definitiv aufgehoben.
(ii) Der Versprechensadressat verzichtet auf den ihm zustehenden Anspruch. Indem er seinen Verzicht dem Versprochenhabenden bekanntgibt, entbindet er ihn von dessen Verpflichtung.
Während der Anspruch als solcher ein Recht darstellt, welches dem Adressaten nur erwächst, wenn der Andere ein Versprechen äußert, das der Adressat vernimmt und versteht, kommt diesem das Recht zu, auf die Erfüllung oder Einlösung des Anspruches zu verzichten, unabhängig von irgendwelchen Taten des Versprechenden. Daran zeigt sich, dass das Recht auf Verzicht von absoluter Natur ist24.
Auf der Seite des Versprechenden gibt es dazu – nach vollendetem Versprechensakt – nichts Äquivalentes. Versprach ich leichtsinnig einem Freund, ihm 1.000 CHF zu geben, wenn er schwimmend den Zürichsee von Horgen nach Meilen und wieder zurück in einem Zug und ohne Hilfsmittel überquere, und hat er das Versprechen vernommen, so kann ich mich selbst nicht davon entbinden. Eine Chance, mich von der eingegangenen Verpflichtung zu befreien, hätte ich allenfalls noch, wenn der Freund – nur zu nachsichtig – vor dem «Abgemacht!» noch ein «Im Ernst?» fallen ließe.
Bereits an diesem halb scherzhaften Beispiel zeigt sich, dass die bisher herausgearbeiteten Gesetzmäßigkeiten, die zum Gesamtphänomen eines Versprechens gehören, völlig unabhängig vom speziellen Inhalt des betreffenden Versprechens sind; wir haben sie vielmehr als unabdingbare Merkmale oder Inhaltsformen des Begriffes Versprechen anzusehen. Sie gelten für jedes Versprechen, sei nun dessen Inhalt ernst oder lächerlich, von hoher moralischer Qualität oder ethisch neutral oder tief verwerflich.
Aus diesem Grunde wird deutlich, dass wir ein konkretes Versprechen nicht für sich allein betrachten dürfen, sondern dessen Beziehungen zu anderen Aspekten der Rechtssphäre ermitteln und berücksichtigen sollten; dies auf die Gefahr hin, dass dadurch sowohl für den Versprochenhabenden die eingegangene Verbindlichkeit – als auch der dem Adressaten erwachsene Anspruch im faktischen sozialen Kontext ganz anders beurteilt werden muss, als wenn man das Versprechen (wie im Vorangegangenen geschehen) als isoliertes Phänomen analysiert. Dies soll an einem klassischen Beispiel veranschaulicht werden.
5. Antonio und Shylock – Einbindung des Versprechens in die gesamte Rechtssphäre
Bei dem berüchtigten Vertrag zwischen Antonio und Shylock in Shakespeares Kaufmann von Venedig hat sich Antonio, für den Fall, dass er die entliehenen 3000 Golddukaten nicht termingerecht zurückzuerstatten vermag, Shylock gegenüber verpflichtet, ihm zu gestatten, ein Pfund Fleisch aus seinem (Antonios) Körper heraus zu schneiden25. Shakespeare lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass sowohl die grausige Verpflichtung als auch der mörderische Anspruch formal zu Recht bestehen. Ob beabsichtigt oder nicht, es offenbart sich daran die Stärke der einem beliebigen Versprechen inhärierenden formgebundenen Verpflichtung in ihrer ganzen Radikalität.
Eine ganz andere Frage ist jedoch, ob der widerliche Vertrag überhaupt rechtsgültig hätte geschlossen werden können. Im Theaterstück wird das Vertragsansinnen nicht expressis verbis verneint, sondern die «Rechtsgelehrte» Portia hebt hervor, dass (a) im Vertragstext nur von einem Pfund Fleisch ohne Blut die Rede ist26 [als ob das möglich wäre!] und (b) Shylock einen Prozess wegen Mordes, oder weil er dem Leben Antonios nachstellt, riskiere oder bereits auf sich gezogen habe27. Abgesehen von allen anderen gravierenden rechtlichen Unzulänglichkeiten der betreffenden Gerichtsfarce im Kaufmann von Venedig (man denke nur an die falsche Identität der «Rechtsgelehrten» Portia, an die faktische Ausschaltung des Richters sowie daran, dass die Einheit der Materie verletzt wird: denn zur Debatte steht die Erfüllung des Vertragsinhaltes, nicht die allfällige Verurteilung von Shylock), ist es ethisch und formaljuristisch stoßend, dass der Vertrag mit dem Pfund Fleisch an sich zwar als rechtsgültig angesehen wird, Shylock jedoch im Nachhinein wegen des Vertragsinhaltes verurteilt wird.
Sobald wir nämlich anerkennen, dass den Prinzipien der Unverletzlichkeit der Person und der Wahrung der Menschenwürde unbedingter Vorrang gebührt, derart, dass jedes Versprechen und jeder Vertrag ihnen unterzuordnen ist und ihnen zu genügen hat, wird einsichtig, dass der Vertrag zwischen Antonio und Shylock gegen die genannten Prinzipien sowie, ganz allgemein, gegen die guten Sitten verstoßen hätte – und somit im Vorhinein als nichtig hätte erkannt werden müssen28. Hieraus ersehen wir, von welch zentraler Bedeutung die Aufgabe ist, die genannten Prinzipien zu begründen, mithin zu klären und zu rechtfertigen – ein Thema, das Gegenstand des zweiten und des dritten Teiles der Urphänomene der Rechtssphäre sein wird.
Überblickt man das bis hierher Entwickelte, so veranschaulicht es uns zweierlei:
(i) Jedem Versprechen als solchem inhärieren begriffsimmanente Gesetzmäßigkeiten, sowohl was die Inhaltsform anbelangt als auch was das Zustandekommen und das Erlöschen des im Versprechen gründenden Anspruchs und der dazu gehörenden Verbindlichkeit betrifft. Wie die oben unter 3. gegebene Charakterisierung dessen, was mit dem Ausdruck ‹Versprechen› gemeint ist, gezeigt hat, sind die dem Gesamtphänomen des Versprechens wesenseigenen Zusammenhänge nicht abhängig von irgendwelchen externen Kategorien, seien es solche des positiven Rechtes oder allgemeiner Rechtsprinzipien, sittlicher Anschauungen bzw. anderweitig erlassener Gebote und Verbote – dies deshalb, weil wir dasjenige, was ein Versprechen ausmacht, erläutern können, ohne dass wir auf eine der genannten Kategorien zurückgreifen müssten.
(ii) Anders sieht jedoch die Situation aus, wenn wir vom reinen Begriff Versprechen zu einem beliebigen konkreten Versprechen übergehen. Hier gilt, dass es nicht ein einziges, von einem Versprechenden einwandfrei formuliertes und von dem jeweiligen Adressaten klar und deutlich vernommenes Versprechen gibt, für dessen Erwahrung in Rechtskraft nicht gezeigt werden müsste, dass Form und Inhalt des Versprechens den grundlegenden Rechtsprinzipien und sittlichen Anschauungen nicht widersprechen.
6. Bestimmungen positiven Rechts – im Widerspruch zu rechtlichen Urphänomenen?
Die faktische Rechtsgültigkeit eines Versprechens oder Vertrages wird nicht nur davon abhängen, ob der Inhalt, um den es geht, mit den in einer Rechtsgemeinschaft anerkannten grundlegenden Rechtsprinzipien vereinbar ist, sondern wird auch maßgeblich von den Bestimmungen tangiert, die in dem Corpus der Bestimmungssätze des positiven Rechts der betreffenden Gemeinschaft festgehalten worden sind. Reinach schreibt: «Wir haben gesagt, dass, wer Versprechen vollziehen kann, eben damit Verbindlichkeiten auf sich lädt. Wer ein Alter von 20 Jahren hat, kann gewiss Versprechungen aller Art vollziehen, und doch erwächst ihm aus ihnen nicht ohne Weiteres eine vollgültige positivrechtliche Verbindlichkeit; sie erwachsen, wenn der Adressat, in dessen Person der Anspruch allein entstehen kann, das Versprechen vernommen hat. In jedem Punkte scheint dem das positive Recht zu widersprechen. Ein vernommenes Versprechen, ein Darlehensversprechen z.B., begründet in der Regel keinen Anspruch, wenn es nicht in einem besonderen sozialen Akt angenommen ist; andere Versprechungen, z.B. das mündliche Versprechen, ein Haus zu verschenken, begründen, auch wenn sie angenommen sind, keinen Anspruch …»29. Wie also «kann man», fragt Reinach, «apriorische Gesetze mit dem Anspruch auf absolute Gültigkeit aufstellen wollen, wenn jedes positive Recht sich in den flagrantesten Widerspruch zu ihnen setzen kann?»30
Die Erklärung für die zahlreichen Diskrepanzen zwischen den Urphänomenen des Rechts und den Bestimmungssätzen des jeweiligen bürgerlichen Gesetzbuches einer gegebenen Rechtsgemeinschaft sieht Reinach darin, dass die Gesetzbücher nicht Behauptungen enthalten, deren Wahrheitsgehalt bei jedem konkreten Rechtsfall mit zu überprüfen ist, sondern schlicht bestimmen, was in einem gegebenen Fall rechtlich gelten soll31. Wenn, um wiederum ein Beispiel aus dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB) heranzuziehen, zur Mündigkeit natürlicher Personen, unter Ziffer 14 des ZGB steht: «Mündig ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat»32 – so handelt es sich hierbei nicht um eine Behauptung wissenschaftlicher Observanz, die dem Kriterium der Falsifizierbarkeit standzuhalten hätte, sondern es ist ein Bestimmungssatz, der festlegt, wie es sein soll. Dies fällt besonders auf, wenn man den zitierten Wortlaut mit der früheren Fassung vergleicht, wo es unter der gleichen Ziffer 14 hieß: «Mündig ist, wer das 20. Lebensjahr vollendet hat. Heirat macht mündig»33. (Der zweite Satz wurde in der Fassung vom 7. Oktober 1994 aufgehoben.) Aus alldem werden auch die üblichen Redewendungen verständlich, mit denen man auf «Soll-Sätze» in den Gesetzbüchern verweist, so zum Beispiel: «Artikel 14 des ZGB hält fest, dass …»
Darüber, was ein rechtliches Urphänomen ist, kann und muss eine wissenschaftliche Debatte geführt werden. Sind jedoch die Wesensgesetze eines bestimmten Teilbereiches der Rechtssphäre erkannt worden und zeigt sich, dass die Bestimmungssätze eines gegebenen Gesetzbuches den aufgefundenen rein begrifflichen Zusammenhängen zuwiderlaufen, dann heißt dies nicht, dass es nun doch keine rechtlichen Urphänomene gebe, sondern, dass die betreffenden Gesetzgeber bei dem, was sie als sein-sollend festlegten, sich nach anderen Gesichtspunkten gerichtet haben. Da die Gesetzbücher ständig verändert werden, die rechtlichen Urphänomene hingegen von unabänderlicher Natur sind und ihnen der Charakter von Prinzipien zukommt, dürfen wir hoffen, dass eine klare, umsichtige Erkenntnis und Darstellung dieser Urphänomene sich allmählich auf das Rechtsempfinden einer namhaften Anzahl von Menschen auswirken. Damit einhergehend gäbe es eine Aussicht darauf, dass künftige Reformen der Gesetzbücher, der Rechtsprechung und des Rechtsvollzuges eine Richtung einschlagen, die das positive Recht – Schritt um Schritt – in ein harmonischeres Verhältnis zu den apriorischen Grundlagen der Rechtssphäre brächten. Dass eine derartige Entwicklung nur möglich ist, wenn unerschrockene, kämpferische Persönlichkeiten sich unablässig dafür einsetzen, versteht sich von selbst.