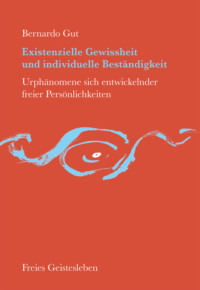Kitabı oku: «Existenzielle Gewissheit und individuelle Beständigkeit», sayfa 3
7. Verzichten – Ausüben eines absoluten Rechtes
Verzichtet der Adressat darauf, das zu beanspruchen, was ihm vom Versprochenhabenden zugestanden worden ist, so betritt er – wie ich ausführte – eine nur ihm zugängliche, übergeordnete Rechtsebene. Da sein Kontrahent von dieser Ebene völlig ausgeschlossen ist und auf seinen Entscheid keinen Einfluss nehmen kann, zerfällt dadurch die mit dem Versprechensakt entstandene Beziehung. In anderen Worten: Der auf die Realisierung seines Anspruches verzichtende Adressat entbindet seinen «Gegner» von dessen Verpflichtung, weil er die Ebene, in der das Versprechen und die darin gründende Beziehung spielen, verlassen hat.
Vergleichen wir:
(a) Wer als Versprochenhabender die Verpflichtung, die er eingegangen ist, erfüllt, befreit sich von der Beziehung zum Adressaten, indem er den Inhalt des Versprechens aufhebt.
(b) Wer als Versprechensadressat auf die Erfüllung seines Anspruches verzichtet, entbindet den Versprochenhabenden von dessen Verpflichtung, indem er das Versprechen formell auflöst.
Im ersten Fall [(a)] bleibt der Adressat wegen der erfahrenen Genugtuung inhaltlich (jedoch nicht rechtlich) an den Kontrahenten gebunden; dieser, hingegen, hat sich vollumfänglich befreit. Im zweiten Fall [(b)] verweigert der Adressat die Beziehung, und der Versprochenhabende, der noch formell (wenn auch nicht rechtlich) auf den Adressaten bezogen bleibt, muss sich damit abfinden und sich neu orientieren.
Wir ersehen hieraus, dass in jedem der beiden Fälle jeweils einer der beiden Kontrahenten sich von der entstandenen Beziehung ganz löst, während sich für den anderen die Beziehung zwar rechtlich aufhebt, er aber zunächst darin in einem gewissermaßen ein-sinnigen Bezug verharrt. Dabei bleibt im Fall (a) der Versprechende für den Anderen in psychologischer Hinsicht prinzipiell erreichbar, denn er befreite sich zwar von seiner Verpflichtung, hat aber dadurch nicht unbedingt eine höhere Ebene betreten. Im Fall (b) jedoch hat der Adressat genau dies getan: sich in eine höhere Ebene entzogen, die für seinen Kontrahenten nicht mehr erreichbar ist.
Darin manifestieren sich einerseits Härte und Überlegenheit des absoluten Rechts gegenüber dem relativen. Anderseits bekundet der auf die Erfüllung des Anspruches Verzichtende, dass er sich selbst genügt und die durch den Verzicht markierte Unabhängigkeit jeder inhaltlichen Bindung vorzieht, welche durch das, was sein Kontrahent vollzieht, nolens volens vermittelt wird. Der Verzichtende optiert für die Einsamkeit; faktisch zwingt er damit aber auch den Versprochenhabenden dazu, sich auf sich selbst zu besinnen.
Mit jedem formulierten und durchgezogenen Verzicht bekräftigt der Einzelne grundsätzlich, dass er in sich selbst eine Instanz gefunden hat, die weder von dem je gerade erreichten Zustand abhängt, noch sich von irgendwelchen äußeren Zuwendungen und Verhältnissen fesseln lässt.
8. Zusammenfassung und Ausblick
Ausgegangen bin ich von der Frage, ob es in der Rechtssphäre apriorische Gesetzmäßigkeiten, das heißt: Urphänomene, gibt, die unabhängig von den jeweils herrschenden äußeren Machtverhältnissen sind. In Übereinstimmung mit den bahnbrechenden Untersuchungen Adolf Reinachs gilt hinsichtlich der relativen Rechte:
1. Es gibt durchaus Rechtsgebilde, denen wesenseigene, formale Gesetzmäßigkeiten innewohnen, die unabhängig sind von äußeren Einflüssen, insbesondere von jeglicher Willkür.
2. Bei einem relativen Rechtsgebilde vom Typus eines Versprechens und eines Vertrages bildet jeweils ein sozialer Akt folgender Geartetheit die unentbehrliche Voraussetzung dafür, dass das betreffende Rechtsgebilde in Rechtskraft erwächst:
a) Der Versprechende muss das, was er zu versprechen gewillt ist, mündlich oder schriftlich äußern;
b) Der Adressat muss die Äußerung vernehmen und deren Sinn erfassen.
3. Der Anspruch des Adressaten bzw. die Verbindlichkeit, welche der Versprechende eingegangen ist, können auf zwei Weisen erlöschen:
a) Indem der Versprochenhabende die eingegangene Verpflichtung einlöst;
b) Indem der Adressat auf die Erfüllung seines Anspruches verzichtet.
4. Wenn der Adressat verzichtet, macht er ein absolutes Recht geltend, dem auf Seiten des Versprochenhabenden nichts Gleichwertiges bzw. Ebenbürtiges entspricht. Psychologisch gesehen, löst der Verzichtende die mit dem Versprochenhabenden eingegangene Beziehung auf, während dieser, sofern er das Versprochene erfüllt, die Beziehung aufhebt.
5. Inhaltlich kann die faktische Rechtsgültigkeit eines Versprechens oder eines Vertrages aus zweierlei Gründen eingeschränkt oder aufgehoben werden:
a) Wenn der Inhalt des Versprechens oder Vertrages Rechtsprinzipien und / oder sittlichen Normen widerspricht, die von der jeweiligen Rechtsgemeinschaft als grundlegend angesehen werden.
b) Wenn die positiv-rechtliche Gesetzgebung einer Rechtsgemeinschaft Bestimmungssätze enthält, die verhindern, dass bestimmte formal-apriorische und / oder inhaltliche Implikationen aus einem zustande gekommenen Versprechen oder Vertrag gezogen werden dürfen.
6. Aus dem unter 4. und 5. Referierten ergibt sich ein weiteres – übergeordnetes – rechtliches Urphänomen, nämlich, dass es in letzter Instanz nicht möglich ist, ein konkretes Versprechen oder einen konkreten Vertrag losgelöst von der übrigen Rechtssphäre zu beurteilen.
7. Die Urphänomene, die wir besprochen haben, sind streng apriorischer Natur, aber sie betreffen – insofern ihnen ein positiver inhaltlicher Sozialcharakter zukommt – nur Rechtsgebilde relativer Natur. Das ebenfalls aufgewiesene absolute Recht auf Verzicht ist demgegenüber von negativem inhaltlichem Sozialcharakter. Damit stellt sich zunächst die Frage,
(i) ob es auch absolute Rechte positiven inhaltlichen Sozialcharakters gibt.
Da wir, darüber hinaus, gesehen haben, dass der Inhalt von Versprechen und Verträgen mit bestimmten Rechtsprinzipien und sittlichen Anschauungen einer Rechtsgemeinschaft in Einklang zu stehen hat, sollen sie innerhalb der betreffenden Gemeinschaft gelten, stellt sich die weitere Frage;
(ii) ob es möglich ist – ausgehend vom Begriff des menschlichen Individuums bzw. der sich auf Individualität gründenden Persönlichkeit –, absolute Rechtsprinzipien auszuweisen, die den Besonderheiten der einzelnen Rechtsgemeinschaften vorausgehen.
Einigen Aspekten dieser Fragen, die sich – meiner Überzeugung nach – erst auf der hier entworfenen Basis, gemäß welcher es Sinn macht, nach objektiven rechtlichen Urphänomenen zu suchen, angehen lassen, sind die folgenden zwei Aufsätze gewidmet.
Anmerkungen
1 Grotius, H., De iure belli ac pacis. Libri tres, in quibus jus Naturae & Gentium, item juris publici præcipua explicantur. Editio Nova. – Amsterdami: Apud Iohannem Blaev, 1646, Prolegomena, S. 5 (§ 22).
2 Goethe, J. W. v., Naturwissenschaftliche Schriften. Bd. I–IV (1./2. Abteilung), herausgegeben, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von R. Steiner. - Stuttgart: Union Deutsche Verlagsgesellschaft, o. J. [1921]; Neudruck Dornach: R. Steiner Verlag, 1975. Bd. IV, 2. Abteilung, S. 481).
3 Vgl. Naturwissenschaftliche Schriften, Bd. III: «Farbenlehre, Physische Farben», § 153 (Grundphänomen), § 174 (Definition des Ausdruckes ‹Urphänomen›).
4 Steiner, in Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftliche Schriften, Bd. II, S. XLIX.
5 Steiner, in Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftliche Schriften, Bd. II, S. I.
6 Steiner, R., Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft (1919). – Stuttgart: Der Kommende Tag, 1920, S. 62.
7 Vgl. Steiner, R., Die Philosophie der Freiheit. Grundzüge einer modernen Weltanschauung (1894/1918). – Dornach: R. Steiner Verlag, 1973, 13. Aufl., z.B.: «Wenn wir das Gesetzmäßige (Begriffliche in dem Handeln der Individuen, Völker und Zeitalter) aufsuchen, so erhalten wir eine Ethik, aber nicht als Wissenschaft von sittlichen Normen, sondern als Naturlehre der Sittlichkeit» (S. 161). Ferner: «Die moralische Phantasie und das moralische Ideenvermögen können erst Gegenstand des Wissens werden, nachdem sie vom Individuum produziert sind. Dann aber regeln sie nicht mehr das Leben, sondern haben es bereits geregelt. Sie sind als wirkende Ursachen wie alle anderen aufzufassen (Zwecke sind sie bloß für das Subjekt). Wir beschäftigen uns mit ihnen als mit einer Naturlehre der moralischen Vorstellungen. – Eine Ethik als Normwissenschaft kann es daneben nicht geben» (S. 194 f.).
8 Naturwissenschaftliche Schriften, Bd. IV, 2. Abteilung, S. 481.
9 Naturwissenschaftliche Schriften, Bd. IV, 2. Abteilung, S. 481.
10 Platon, Sämtliche Werke, herausgegeben von O. Gigon, übertragen von R. Rufener. – Zürich [u.a.]: Artemis, 1974. – Vgl. Der Staat, 469BC, wo Platon dazu auffordert, dass im Kriege [wenigstens] Griechen nicht durch Griechen zu Sklaven gemacht werden sollen; anders steht es mit den Barbaren. In den Nomoi (Gesetze) ist mit Selbstverständlichkeit von Vorschriften, Regeln, Kompetenzen, die sich auf Sklaven beziehen, die Rede; vgl. z.B. 776B bis 778A, 816E, 817E. Im Menon führt Sokrates an einem jungen Sklaven den Vorgang der Wiedererinnerung vor.
11 Aquin, T., S. Thomae Aquinatis Opera Omnia. Ut sint in indice thomistico additis 61 scriptis ex aliis mediiaevi auctoribus; curante R. Busa S. I. Bd. I–VII. – Stuttgart-Bad Cannstatt: F. Fromann Verlag G. Holzboog KG, 1980. – Vgl. Summa Theologiae: «Respondeo dicendum quod circa haereticos duo sunt consideranda, unum quidem ex parte ipsorum; aliud ex parte ecclesiae. ex parte quidem ipsorum est peccatum per quod meruerunt non solum ab ecclesia per excommunicationem separari, sed etiam per mortem a mundo excludi. multo enim gravius est corrumpere fidem, per quam est animae vita, quam falsare pecuniam, per quam temporali vitae subvenitur, unde si falsarii pecuniae, vel alii malefactores, statim per saeculares principes iuste morti traduntur; multo magis haeretici, statim cum de haeresi convincuntur, possent non solum excommunicari, sed et iuste occidi.» (Summa Theologiae, 3, qu 11, ar 3). («Ich antworte, indem ich sage, dass hinsichtlich der Ketzer zweierlei zu überlegen ist: gewiss zum Einen, was deren Seite betrifft; zum Anderen, was die Kirche angeht. Sicher liegt auf der Seite jener ein Vergehen [eine Sünde] vor, wonach sie es nicht nur verschuldet haben, von der Kirche durch Verbannung getrennt, sondern auch von der Welt durch den Tod ausgeschlossen zu werden. Es ist nämlich viel schwerwiegender, den Glauben, durch den die Seele das Leben hat, zu untergraben, als das Geld, durch welches dem vergänglichen Dasein abgeholfen wird, zu fälschen; wenn daher Falschmünzer oder andere Übeltäter von den weltlichen Fürsten auf der Stelle zu Recht dem Tode übergeben werden, dann könnten umso mehr die Ketzer, sobald sie der Ketzerei überführt worden sind, nicht nur verbannt, sondern zu Recht umgebracht werden.»)
12 Vgl. Hegel, G. W. F., Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, herausgegeben von E. Moldenhauer und K. M. Michel; Bd. 7. der Werke. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986. – Mitte Oktober 1820 entwarf Hegel einen Brief an K. A. Fürst von Hardenberg (1750–1822), preußischer Minister und Staatskanzler, worin u.a. steht: «Ich wusste, dass in meiner Darstellung eines Gegenstandes [nämlich der Philosophie des Rechts], auf den zu kommen mir meine amtliche Verbindlichkeit auflegt, die wissenschaftliche Behandlung und die theoretische Form der Hauptzweck ist, – dass meine wissenschaftliche Bestrebung dahin geht, von der Philosophie dasjenige auszuscheiden, was diesen Namen fälschlich usurpiert, und vielmehr den Einklang der Philosophie mit denjenigen Grundsätzen zu beweisen, welche die Natur des Staates überhaupt braucht, am unmittelbarsten aber den Einklang mit demjenigen, was unter seiner [Majestät des Königs] erleuchteten Regierung und unter der weisen Leitung E.D. der Preußische Staat, dem ebendarum anzugehören mir selbst zu besonderer Befriedigung gereichen muss, teils erhalten, teils noch zu erhalten das Glück hat». (S. 516 f.). – Man vgl. ferner Hegel, G. W. F., Philosophie der Geschichte, mit einer Einleitung von T. Litt. – Stuttgart: Reclam, 1961. Im Kap. «Die Aufklärung und die Revolution» findet sich ein Lob auf Friedrich II.: «Friedrich II. kann als der Regent genannt werden, mit welchem die neue Epoche in die Wirklichkeit tritt, worin das wirkliche Staatsinteresse seine Allgemeinheit und seine höchste Berechtigung erhält. Friedrich II. muss besonders deshalb hervorgehoben werden,dass er den allgemeinen Zweck des Staates denkend gefasst hat, und dass er der erste unter den Regenten war, der das Allgemeine im Staate festhielt und das Besondere, wenn es dem Staatszwecke entgegen war, nicht weiter gelten ließ. Sein unsterbliches Werk ist ein einheimisches Gesetzbuch, das Landrecht. Wie ein Hausvater für das Wohl seines Haushalts und der ihm Untergebenen mit Energie sorgt und regiert, davon hat er ein einziges Beispiel aufgestellt.» (S. 586 f.)
13 Vgl. Marten, R., Heidegger lesen. – München: Fink, 1991. Siehe besonders S. 85 ff.
14 Vgl. Kant, I., Werke in zehn Bänden, herausgegeben von W. Weischedel. – Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1956. Bd. 6: Schriften zur Ethik und Religionsphilosophie. In der Grundlegung der Metaphysik der Sitten heißt es zum Beispiel: «Die Handlung, die mit der Autonomie des Willens zusammen bestehen kann, ist erlaubt; die nicht damit stimmt, ist unerlaubt». (S. 74.)
15 ‹Ethischer Individualismus› ist eine Wendung, die Steiner folgendermaßen geprägt hat: «Die Summe der in uns wirksamen Ideen, den [sic!] realen [sic!] Inhalt unserer Intuitionen, macht das aus, was bei aller Allgemeinheit der Ideenwelt in jedem Menschen individuell geartet ist. Insofern dieser intuitive Inhalt auf das Handeln geht, ist er der Sittlichkeitsgehalt des Individuums. Das Auslebenlassen dieses Gehaltes ist die höchste moralische Triebfeder und zugleich das höchste Motiv dessen, der einsieht, dass alle anderen Moralprinzipien sich letzten Endes in diesem Gehalte vereinigen. Man kann diesen Standpunkt den ethischen Individualismus nennen» (Philosophie der Freiheit, S. 160).
16 Zu den erkenntnistheoretischen Ansätzen Steiners siehe besonders: Steiner, R., Wahrheit und Wissenschaft. Vorspiel einer Philosophie der Freiheit (1892). – Dornach: R. Steiner Verlag, 1980, 3. Aufl. – Solov’evs Darstellung in dem Fragment Theoretische Philosophie ist kongenial zu Steiners Auffassung. Siehe dazu: Solov’ev, V., Theoretische Philosophie, in: Deutsche Gesamtausgabe der Werke von W. Solowjew, Bd. VII, übersetzt von W. Szylkarski. – Freiburg i. Br.: Wewel, 1953.
17 Für die folgenden Betrachtungen beziehe ich mich in freier Weise auf den Ansatz, den Adolf Reinach (1883–1917) in seiner epochalen Schrift Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes (1913) entworfen hat. Bestimmte Gesichtspunkte werde ich dabei immanent-kritisch analysieren und um einige Aspekte erweitern. Siehe dazu: Reinach, A., Sämtliche Werke; textkritische Ausgabe in 2 Bänden, herausgegeben von K. Schuhmann und Barry Smith. – München: Philosophia, 1989.
18 Reinach, Sämtliche Werke, Bd. 1, S. 141.
19 Schweizerisches Zivilgesetzbuch und Nebenerlasse (ZGB), herausgegeben von A. Büchler. – Basel: Helbing Lichtenhahn, 2011, 3. Aufl., S. 58.
20 Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB), hrsg. von H. Aeppli (25., überarb. Aufl. der von W. Stauffacher begründeten Ausgabe). – Zürich: Orell Füssli, 1989, S. 509.
21 ZGB, 25. Auflage, 1989, S. 509.
22 Reinach, Sämtliche Werke, Bd. 1, S. 147 ff.
23 Reinach, Sämtliche Werke, Bd. 1, S. 158 ff. und S. 169 ff.
24 Reinach, Sämtliche Werke, Bd. 1, S. 173 ff.
25 Shakespeare, W., The Merchant of Venice / Der Kaufmann von Venedig. Englisch und Deutsch; übersetzt, kommentiert und herausgegeben von B. Puschmann-Nalenz. – Stuttgart: Reclam, 1992, Act I, Scene III, Verses 140 ff.
26 The Merchant of Venice, Act IV, Scene I, Verses 302 ff.
27 The Merchant of Venice, Act IV, Scene I, Verses 344 ff.
28 Zu den rechtlichen Aspekten des Prozesses um den Vertrag zwischen Antonio und Shylock vgl. insbesondere Jhering, R. v., Der Kampf um’s Recht. – Wien: Manz, 1872. Ihering weist u.a. auf Folgendes hin: «Gerade darauf beruht in meinen Augen das hohe tragische Interesse, das Shylock uns abnötigt. Er ist in der Tat um sein Recht betrogen. So wenigstens muss der Jurist die Sache ansehen. Dem Dichter steht natürlich frei, sich seine eigene Jurisprudenz zu bilden, und wir wollen es nicht bedauern, dass Shakespeare dies hier getan oder richtiger die alte Fabel beibehalten hat. Aber wenn der Jurist dieselbe einer Kritik unterziehen will, so kann er nicht anders sagen, als der Schein war an sich nichtig, da er etwas Unsittliches enthielt; ließ der weise Daniel [Portia] ihn aber einmal gelten, so war es ein elender Winkelzug, ein kläglicher Rabulistenkniff, dem Manne, dem er einmal das Recht zugesprochen hatte, vom lebenden Körper ein Pfund Fleisch auszuschneiden, das damit notwendig verbundene Vergießen des Bluts zu versagen. Man möchte fast glauben, als ob die Geschichte von Shylock schon im ältesten Rom gespielt habe; denn die Verfasser der zwölf Tafeln hielten es für nötig, in bezug auf das ‹Zerfleischen des Schuldners› (in partes secare) ausdrücklich zu bemerken, dass es auf etwas mehr oder weniger dabei nicht ankomme. (Si plus minusve secuerint, sine fraude, esto!)» (S. 64 f.). – Sehr aufschlussreiche Konsequenzen aus der elenden Gerichtsfarce sowie dem erbärmlichen Benehmen der «christlichen» Gegenspieler Shylocks hat David Henry Wilson in seinem Theaterstück Shylock’s Revenge dramatisch verarbeitet. Abgedruckt ist Wilsons Theaterstück in: Schwanitz, D., Shylock. Von Shakespeare bis zum Nürnberger Prozess, mit einem Abdruck von «Shylock’s Revenge» by D. H. Wilson. – Hamburg: Krämer, 1989.
29 Reinach, Sämtliche Werke, Bd. 1, S. 238 f.
30 Reinach, Sämtliche Werke, Bd. 1, S. 239.
31 Reinach, Sämtliche Werke, Bd. 1, S. 240 ff.
32 ZGB, 3. Aufl., 2011, S. 17.
33 ZGB, 25. Auflage, 1989, S. 3.
URPHÄNOMENE DER RECHTSSPHÄRE II
Korrelative Rechtsrelationen und fundamentale Menschenrechte
Abstract
1. In the first essay on fundamental phenomena inherent to the Realm of Rights and Justice, I started the investigation by looking at the manifold consequences following from a promise a person A clearly expressed to an addressee B who consciously took it in, and understood what it meant. It is a basic example of a relative legal structure. A has bound himself by what he offered to do and can only bring the undergone relation to an end if he fulfils the promise. The addressee B, on the other hand, is entitled to claim A to meet what he promised, but he is also privileged to renounce his claim – if he chooses –, exerting a typical negative absolute right which dissolves the relation between him and A.
At the end of the article, I raised two questions on which I have – to a certain extent – dealt with in the present second essay on fundamental legal phenomena:
(i) Can we conceive absolute rights having a positive social character?
(ii) Can we establish absolute legal structures, essential for an individual person, which are completely independent of the various, mutually differing legal communities?
2. In contrast e.g. to a mathematician who investigates the objective implications and laws which follow from postulates and axioms, and also in contrast to a natural scientist who analyses the processes of anorganic and organic appearances in the sense perceptive world – a researcher devoted to the study of the Realm of Rights and Justice finds himself confronted with events, facts, dilemmas, processes, riddles that only come into being, i.e. appear, develop, and manifest themselves, when at least two human individuals enter in contact with each other. Wesley Newcomb Hohfeld (1879–1918) tried to peel off typical legal patterns that emerge when two human beings establish a relationship with one another and agree to mutually accept certain rules to be applied in their relation.
Hohfeld found four pairs of Jural Correlatives:
| (a) claim (right sensu stricto) | vs. | duty; |
| (b) privilege (liberty to) | vs. | no-right (no-claim); |
| (c) power | vs. | liability; |
| (d) immunity (exemption from) | vs. | disability. – |
Looking above all at the positive four poles of the jural correlatives, we can summarise:
The (a) is certainly the basic, most important pattern, the one Adolf Reinach had centred his analysis on. If A promises B to bring him tomorrow the book, he had borrowed from him, B has received a claim-right, whereas A is bound by a duty.
A simple example for (b): A has the privilege to freely use his own smart-phone, whereas B doesn’t have any right to use A’s phone without the latter’s consent. A’s privilege means that he has the liberty to do something: to use his own phone, to enter his home, to ride his bicycle – but B has no right to do the very same things with A’s belongings – without A’s permission.
Following Hohfeld, we have to distinguish between claims (rights proper) and liberties (based on privileges) enabling us to do or to refrain from doing something. – (Powers and immunities refer to second order claims and privileges.)
Although the four pairs of Jural Correlatives belong to the vast group of relative legal structures, the liberty to do or to refrain from doing something unveils an individual privilege and faculty that surpasses the ordinary level of relative legal relationships, and points to an absolute right (in the sense of liberty) enabling oneself to act in an independent way.
3. As soon as a child negates to do – or rather to stop doing something his mother has demanded, we perceive how the sense of being an individual with his own sovereign will has awakened the child’s self-consciousness. This is merely a first step. «As soon as a child invokes the principles of equality, consistency, and adherence to a promise or a rule – to argue, for example, that he has a right to a certain toy because his brother had it earlier and because they always take turns with it and because it is his and because his father said so – then it makes sense to speak of an appeal to Right or to Law.» (H. J. Berman7) These observations underline the crucial significance the awakened ability and the courage to negate obedience to authority enables and triggers the young individual to develop his self-confidence and confirm himself as an independent, potentially free personality.
4. Parallel to the ripening personal confidence, the young adult normally becomes aware of other individuals bearing and unfolding individual, personalised traits of many characters common to virtually all human individuals. And he perceives, how these other individuals assert, maintain, partly modify – and as a whole stand to their personalised qualities and traits. If this process leads me, as well as my fellow beings to recognise in each other a mutually equivalent personal dignity, albeit as individuals largely differing regarding the external appearances, the main interests, the abilities, the innermost convictions, and the like – then we are prepared to get acquainted with the elementary and fundamental individual rights and liberties, to discuss them, and – eventually, and hopefully – to adhere and defend them in our own, independent, personal way.
5. Carlos Santiago Nino (3.11.1943–29.8.1993) proposed three fundamental individual rights, and he added a fourth one, the hedonistic right. What Nino concentrated on, are rights to do or to abstain from doing certain things: «to profess or not to profess a religion, to express ideas, to undertake any job or enterprise, to associate with others, to move from one place to another, to engage in sexual practices or personal habits, etc. … [These rights are very broad and generic and suggest that perhaps they] … derive from a general principle which proscribes interference with any activity which in turn does not interfere with the activity of other people.» (C. S. Nino12, p. 130):
(1) The Principle of Personal Autonomy;
(2) The Principle of the Dignity of the Person;
(3) The Principle of Inviolability of the Person;
(4) The Hedonistic Principle. –
The fundamental principle (1) conveys to every individual the personal liberty to choose his aim and purpose in life, and his way of life – as long as he concedes equal liberties to his fellow human beings.
The second principle (2) demands that nobody be ever permitted to withdraw the individual, personal dignity of another human being. Nobody is ever allowed to withdraw from a human being the basic right, to be acknowledged as an individual subject with the right to defend his personal identity and subjectivity.
The third principle (3) stipulates that nobody is ever allowed to torture, wound, torment a human being, whether physically nor psychologically.
The fourth principle (4) grants to every human being the privilege to enjoy pleasure and to strive for the absence of pain – considering these experiences as basic gifts of human life. –