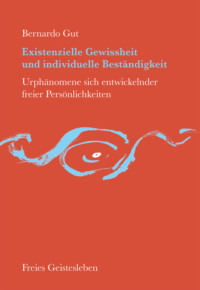Kitabı oku: «Existenzielle Gewissheit und individuelle Beständigkeit», sayfa 5
4. Fundamentale Menschenrechte
Psychische Tatsachen (Erlebnisse, Prozesse) in engerem Sinne, die sich nicht auf ein Etwas als Objekt bezögen, sind ebenso wenig denkbar wie psychische Phänomene in engerem und weiterem Sinne, die unabhängig von einem sie erfahrenden Individuum wären: So gibt es keine Liebe, ohne Liebenden und Geliebtes; keinen Zorn, ohne Erzürnten und das, worauf sein Zorn gerichtet ist; keine Vorstellung, ohne jemanden, der ein Etwas vorstellt. Und im schwer ergründbaren Bereich der seelischen Grundbefindlichkeit gehört zu jeder gedrückten und zu jeder gehobenen Stimmungsnuance ein die betreffende Befindlichkeit erlebendes Subjekt. Daher ist dem für ein Fremd-Ich Blinden und Tauben alles Seelisch-Geistige höchstens in defizienter, rudimentärer Ausprägung zugänglich. Wer beispielsweise die Furcht, ohne den sich Fürchtenden zu erfahren und zu verstehen sucht, denkt abstrakt. Darüber hinaus muss ihm letztlich die Qualität all jener Phänomene verborgen bleiben, die, ohne dass sie auf bestimmte Gegenstände gerichtet wären, personengebunden auftreten, wie dies bei den Stimmungen der Fall ist.
So wird der für ein fremdes Ich Abgestumpfte hinsichtlich seelischer Erfahrungen im Wesentlichen zurückgeworfen auf das Erleben eigener Organempfindungen und der daran gebundenen Affekte. Und weil er Anderen nicht zubilligt, dass sie aus sich heraus originäre Intentionen setzen können und freie Entschlüsse zu ergreifen vermögen, kann er – der keinen Freien toleriert – sich auch nicht als ein Freier unter Freien bewähren.
Fremde Ichs wahrzunehmen, impliziert, sie als da-seiend anzuerkennen, und dies geht einher mit dem Vermögen, das, was jene fühlen, vorstellen und beabsichtigen, in mir selbst als solches zu intendieren. Damit zusammenhängend, wird des Einzelnen Drang, sich auszubreiten und zu imponieren, mit der Präsenz eines Anderen und dem Interesse für das, was ihn beschäftigt, gebremst: die äußere Gegenwart des Anderen, aber auch die innere Beschäftigung mit seinen Anliegen stellen sich der ungehemmten Daseinsentfaltung meiner selbst entgegen, sie hemmend und relativierend.
In dem Maße wie ich im Anderen ein dem Eigen-Ich entsprechendes Fremd-Ich vernehme, verwandelt sich dessen Person für mich in ein mir gleichrangiges Rechtssubjekt – und von diesem Augenblick an bin ich bereit, den rationalen Rechtsdiskurs zu eröffnen, der zur eigentlichen Begründung und Entwicklung der Rechtssphäre führt. Nur insofern ich den Anderen als ein Wesen, dem Rechte (und damit auch Pflichten) zukommen, gelten lasse, erfasse ich mich selbst realiter als Rechtssubjekt – im Austausch mit dem Anderen.
Dadurch, dass wir uns selbst in einer langen Folge von Ablösungsschritten (von Mutter, Vater, Mentoren, Idolen) als werdende Persönlichkeiten zu begreifen suchen, können wir das Vorhandensein fremder Ichs faktisch nicht leugnen. Von früher Kindheit an haben wir uns immer wieder veranlasst gesehen, uns bestimmten Ansprüchen, Übergriffen, Vorschriften Anderer zu widersetzen, uns ihrer Besorgnis und anmaßenden Präsenz zu entziehen – dies freilich in unterschiedlicher Radikalität. Weil jeder Einzelne seinen jeweiligen Persönlichkeitsstand mannigfachen Absetzungen, Negationen und fortgesetzten, langwierigen Verhandlungen verdankt, ist ihm der Wert von Auseinandersetzungen vertraut. Und damit hat er, vielleicht ohne sich darüber Rechenschaft zu geben, im Verlauf seiner eigenen Entwicklung einen rationalen, rechtlichen Diskurs praktiziert. Wer sich dieser Sachlage bewusst wird, dem leuchtet die feinsinnige Beobachtung von Carlos Santiago Nino (3.11.1943–29.8.1993) in ihrer ganzen Brisanz auf: «Sogar die schamlosesten Tyrannen fühlen sich dazu verpflichtet, eine gewisse Rechtfertigung für ihre Handlungen anzubieten, und dieser Rechtfertigungsversuch – wie plump und scheinheilig er auch sein mag – öffnet den Weg zu aufklärender Diskussion»12.
Besinnen wir uns nun auf die im Vorangegangenen hervorgehobenen Momente der Individualentwicklung, des Anerkennens von fremden Ichs, der rechtsrelevanten Beziehungsfiguren und der allgemeinen Kennzeichen der Rechtssphäre, so dürften wir dafür vorbereitet sein, die vier prinzipiellen Forderungen anzuerkennen, die, wie Nino unterstrichen hat, jedes Mitglied einer echten Rechtsgemeinschaft gegenüber seinesgleichen stellt und deren konkrete Ausgestaltung im jeweiligen rechtlichen Diskurs stattfindet13. Es geht um folgende claims (geforderte Rechtsansprüche) und liberties (gewährte bzw. ergriffene Freiheiten):
1. Forderung nach Selbständigkeit der Person (Autonomie-Prinzip), ein Postulat, demzufolge niemand dazu befugt ist, einem Rechtssubjekt zu verbieten, dessen eigene Lebenspläne zu schmieden und in dem Maße zu verwirklichen, als es dadurch andere Rechtssubjekte nicht daran hindert, ihre eigenen Lebenspläne unter Wahrung äquivalenter Kriterien zu entwerfen und auszuführen.
2. Forderung nach Wahrung der Würde (Dignitäts-Prinzip), ein Postulat, gemäß welchem es niemandem gestattet sei, ein Rechtssubjekt seiner Subjektität und prinzipiellen Rechtsfähigkeit zu entheben – dies auch dann nicht, wenn der betreffende Mensch sich in Bezug auf andere Individuen in Rechtsverhältnisse begeben hat, die ihm nur Bürden auferlegten und keine Rechtsgunst einbrachten. –
Während das 1. Postulat das im Ich-Kern selbst gründende Wesensmerkmal, eigene Lebensziele zu setzen, anspricht und das 2. Postulat die grundsätzliche Rechtsfähigkeit schützt, geht es in den zwei weiteren Forderungen um die Integrität der seelischen und körperlich-leiblichen Wesensteile des Individuums und um die durch sie vermittelten Erlebniskomponenten:
3. Forderung nach Unantastbarkeit (Unverletzlichkeit) der Person (Inviolabilitäts-Prinzip), ein Postulat, dank dem wir sicherstellen wollen, dass grundsätzlich niemand dazu berechtigt sei, ein Individuum körperlich-leiblich zu versehren (zu foltern) oder psychisch zu quälen – und dies insbesondere auch nicht im Gefolge von Rechtsstreitigkeiten.
4. Anspruch auf sinnenvermittelte Freude und Lust (Hedonismus-Prinzip). Damit halten wir fest, dass jedem Individuum ein Recht auf sinnenvermittelte Lusterlebnisse zusteht (sowohl organgebundene Empfindungen als auch die durch Sinneseindrücke ausgelösten Gefühle sensu stricto), welche für die Entfaltung menschengerechten Daseins unentbehrlich sind. –
Diese vier von C. S. Nino umfassend begründeten Forderungen gehören zur Kategorie der Rechtsansprüche, der claims bzw. der von den Mitmenschen gewährten und vom Einzelnen ergriffenen lieberties (Freiheitsrechten zu etwas). In meinen Augen bilden sie den Fundus rechtsrelevanter Forderungen, die in der Subjektität des menschlichen Individuums begründet sind und sie kennzeichnen. Keinem Wesen, dem das von H. Arendt hervorgehobene Merkmal zukommt, Rechtssubjekt zu sein und mithin am Rechtsdiskurs teilnehmen zu können, dürfen wir die Fähigkeit absprechen, jene Postulate zu erheben und geltend zu machen. Indem er sie äußert und vertritt, negiert der Einzelne, identisch mit den Anderen zu sein. Er erklärt sich grundsätzlich als ihnen ebenbürtig und fordert für sich und für Andere die betreffenden privileges, liberties, das heißt: die dem Einzelnen wesentlichen Freiheitsrechte, etwas zu tun bzw. zu unterlassen. Das bedeutet jedoch: Jeder Einzelne fordert von den Anderen – in einem Staatswesen mithin von den staatlichen Organen –, dass sie ihm grundsätzlich die Autonomie, die Dignität, die Unverletzbarkeit der Person und das Aufsuchen und Erfahren von Freude und Lust zugestehen. So handelt es sich bei den zum Wesenskern der sich entwickelnden Persönlichkeit gehörenden Forderungen rechtlich gesehen um Forderungen nach liberties, nach verbrieften, gewährten Freiheitsrechten, etwas zu tun bzw. zu unterlassen. Diese, das menschliche Wesen auszeichnenden Grundforderungen, deren Erwahrung dem Einzelnen ein menschenwürdiges Dasein ermöglicht, müssen die Individuen eines Gemeinwesens von den jeweils Anderen, insbesondere von den Vertretern eines Staatswesens immer wieder neu erkämpfen, erstreiten, abtrotzen und unermüdlich verteidigen. Denn die zu den integrierenden Merkmalen der sich entwickelnden Persönlichkeit zählenden Prinzipien – insbesondere jene der Autonomie und der Dignität – schränken die Macht der Regierenden jeder Couleur ein. Daher gehört, als Ergänzung zu den genannten ideellen Grundforderungen des Einzelnen, die moralische Pflicht des Individuums, dafür zu kämpfen, dass im positiven Recht die Gewährung und der Schutz der vier Grundforderungen verankert seien. Ferner gehört es zu seiner moralischen Pflicht, sich gegen deren Aufhebung zu widersetzen – und sei letztere auch nur als zeitlich begrenzte Maßnahme vorgesehen.
Die vier Postulate umschreiben also die fundamentalen Kennzeichen eines Menschen, der als werdende Persönlichkeit die sich entfaltende und wandelnde Rechtssphäre mitzugestalten berufen ist. Die Forderungen erweisen sich als unabhängig von jeder Gruppenkategorie und zeichnen sich so als übergeordnete Rechtsprinzipien freier Individuen aus. Sie ersetzen die positive Gesetzgebung nicht, stellen aber Leitgedanken dar, die nur dann Bedeutung erlangen, wenn jeder Einzelne, der sie anzuerkennen vermag, sie im Diskurs vertritt, sie verteidigt, seine eigene Handlungsweise nach ihnen ausrichtet. –
Anmerkungen
1 Vgl. Urphänomene der Rechtssphäre I, S. 11-35.
2 Vgl. Urphänomene der Rechtssphäre I, S. 17.
3 Reinach, A., Sämtliche Werke. Textkritische Ausgabe in 2 Bänden, herausgegeben von K. Schuhmann und B. Smith. – München (u.a.): Philosophia, 1989.
4 Vgl. Corbin, «Foreword», S. VIII, in Hohfeld, Wesley Newcomb: Fundamental Legal Conceptions. Arthur Corbin (ed.). – Westport, Conn.: Greenwood Press, 1978.
5 Hohfeld, Wesley Newcomb: Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning. And Other Legal Essays. Ed. by Walter Wheeler Cook. – New Haven: Yale University Press, 1923. S. 35 ff.
6 Vgl. Nino, Carlos Santiago: Introducción al análisis del derecho. – Buenos Aires: Astrea, 1993, 6. Aufl. S. 208. – Siehe auch: Arthur L. Corbin, «Legal Analysis and Terminology», in The Yale Law Journal, Vol. 29, No. 2, 1919, 163–173. (1919), der die strenge terminologische Klärung ausarbeitet und an einfachen Beispielen veranschaulicht; ferner Nyquist, C., «Teaching Wesley Hohfeld’s Theory of Legal Relations», in Journal of Legal Education, Volume 52, Numbers 1 and 2 (March / June 2002), p. 238–257. Nyquist legt ebenfalls an mehreren Beispielen dar, wie mit Hohfelds Ansatz die logischen Zusammenhänge klar hervortreten. Corbin und Nyquist zeigen, wie bedeutsam diese begriffliche Klärung für die Ausbildung der Juristen ist.
7 Berman, Harold J., Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition. – Cambridge, Mass.: Harvard U.P., 1983. S. 80.
8 Berman, S. 80.
9 Heraklit, Fragmente. Griechisch und Deutsch. Hrsg. von Bruno Snell. – Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976, 6. Aufl. S. 18. – Ferner: Mansfeld, Jaap und Oliver Primavesi (Hrsg.): Die Vorsokratiker. Griechisch / Deutsch. – Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2011. S. 265.
10 Arendt, Hannah: «Es gibt nur ein einziges Menschenrecht», in Die Wandlung, 1949, 4. Jg., 8. Heft, S. 754–770. S. 760.
11 Anregungen für das Folgende verdanke ich folgenden Schriften: Bollnow, Otto Friedrich: Das Wesen der Stimmungen. – Frankfurt am Main: Klostermann, 1988, 7. Aufl.; Brentano, Franz: Psychologie vom empirischen Standpunkt. Bd. I–III. – Hamburg: Meiner, 1973 (Bd. I, 3. Aufl.), 1971 (Bd. II, 2. Aufl.), 1974 (Bd. III, 2. Aufl.); Steiner, Rudolf: Von Seelenrätseln. – Dornach: R. Steiner Verlag, 1983, 5. Aufl.- Bezüglich der begrifflichen Differenzierungen, vgl. Gut, B., Die Verbindlichkeit frei gesetzter Intentionen. – Stuttgart: Freies Geistesleben, 1990. S. 129 ff.
12 Nino, Carlos Santiago: The Ethics of Human Rights. – Oxford: Clarendon, 1991. S. 3 f.
13 Nino, 1991, S. 129 ff.
URPHÄNOMENE DER RECHTSSPHÄRE III
Die Idee einer Gesamtheit1 freier, selbständiger Einzelner
El sueño de la razón produce monstruos.
F. de Goya (1746–1828): Caprichos.
Der Schlaf des Verstandes erzeugt Ungeheuer.
Abstract
1. In the following Abstract, I will give a succinct summary of the main subjects dealt with in The Idea of an Aggregate (or, in a larger view: Totality) of Free, Independent Individuals. –
As early as the 7th Century BC, we perceive in Ancient Greece a slowly increasing zeal to encourage chosen individual human beings to confide in their innate, latent drive to liberate themselves of family and group-bounds, and to become independent personalities. A telling testimony to this delicate, hazardous adventure is an appeal by Heraclitus (ca. 550 BC – ca. 480 BC), who in one of his fragments simply exhorts: One ought not to act as child of his parents. This demand to cherish one’s personal independency and dignity is a major concern in classical tragedies by Aeschylus (e.g. Prometheus) and Sophocles (e.g. Antigone). The appeal to the individual is paramount in the Gospel of St. Matthew (10, 34 f.), where Christ says: «Think not that I am come to send peace on earth … I came not to send peace on earth, but a sword. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother …» – And in the Gospel of St. John, Christ encourages his disciples, appealing to them as individualities, not as a collective, closed group: «And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.» (St. J., 8, 32). And again: «I call you not servants … I have called you friends …» (St. J., 15,15). The disciples are looked upon as being independent personalities.
2. Independently of the afore mentioned hints in classic tragedies and in founding texts of the Christian religion towards a growing awareness of personal dignity – there was a comparable quest among the Ancient Greek philosophers to understand the essence of Individuality. It was eventually Plotinus (ca. 205 AD – ca. 270), who was the first to introduce the term Ego in philosophical reasoning, and who – in Ennead V,7 – ventured to tentatively consider the existence of separate individual, perennial ideas in every human individual.
3. This hopeful, encouraging advance – at the outset of our common era – towards a definite acknowledgement of the dignity and inviolability of the independent human individual came to a premature stop, as soon as a hierarchically organised, authoritarian «Christian Church» established itself with its dogmatic intolerance. A turning point was the persecution of Pelagius (ca. 350–430) by Augustin of Hippo (354–430). It set in motion a campaign against heretics, independent individuals who searched their own way of life and would neither bend nor conform to the uniform doctrine and commands imposed by the mighty Christian (Catholic) Church. This persecution of independent, free-thinking individuals continued for more than a thousand years. Unfortunately, groups of heretics that managed to evade being harassed, who survived, subsequently initiating new, strictly organised religious movements with new temples often tended to treat their own «new-heretics» in ways which hardly differed from what the founders of their «New-Churches» had experienced from the representants of the «Old-Church».
4. With the outbreak of the French Revolution 1789, started a dramatic debate with the aim to introduce fundamental individual human rights in newly devised Constitutions and Charts. After several attempts, severe drawbacks, terror-regimes, two World Wars, the United Nations was finally able, on the 10th December 1949, to proclaim the Universal Declaration of Human Rights, which declares in Art. 1: «All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.» Art. 2 underlines that it is Everyone [the Individual] who is entitled to all the rights and freedoms [liberties]. And Art. 20, 2 proclaims: «No one may be compelled to belong to an association.» This clear formulation is crucial for the dignity and the defence of the claim-rights and liberties of the individual.
5. It is exactly the quoted Art. 20, 2 and its implications which are absent in the Declaration of Human Rights in Islam (Kairo, 5th August 1990), presented by the Foreign Ministers of the Islamic States. All 25 Articles depend on the Sharia, and they basically express collective rights (group-rights), never independent individual rights. Furthermore: Women are declared to be «equal in dignity» to men, and «they have rights» (Art. 6), but they do not have the same rights as men. Here, as elsewhere, the ministers address collectives, not individuals.
6. A similar objection applies to authoritarian states, e.g. China, Russia, Venezuela, etc., where collective privileges dominate over any attempt to assert and activate an independent individual liberty. Individual liberties are also undermined by the widespread, increasing pressure to introduce collective privileges for all kinds of groups.
7. The independent, self-confident free personality remains the common danger and enemy of every authoritarian church, community, congregation, society, state. A recent example that corroborates these reflections is Luis Ladaria’s letter Placuit Deo, addressed to all the bishops of the Catholic Church (published by order of Pope Francis on the 22nd February 2018), in which he condemns the modern individualism as a renewal of the heresy of Pelagius, urging the believers to proselytize against it. The independent rational personality will always be the heretic par excellence.
In short: With The Idea of an Aggregate of Free, Independent Individuals I mean to draw the attention to three fundamental subjects: (i) The notion of a developing, free personality based on a potentially perennial Ego; (ii) the individual’s innate need to enter in contact with his equals, engaging himself in a deliberative exchange of ideas and projects, and committed to encourage and offer support to every striving individual he or she meets; (iii) to keep in mind that the terms ‹aggregate› and ‹totality› refer to the individuals as such, who remain independent, in an open, liberal relation – and are not embodied in a community nor in any other kind of a collective closed group. – I am well aware that the realization of what has been outlined in the essay will always remain a delicate, fragile ideal.
1. Vom inneren Abstand und dem Kampf um individuelle Menschenrechte
In einer Betrachtung zum 650. Todesjahr Dantes (1265–1321) schrieb der Romanist Theophil Spoerri (1890–1974): «Der Mensch ist das einzige Wesen, das Abstand zu sich selbst und zum andern, damit auch zum unmittelbar Gelebten, dem Drang der Begierde, dem Druck der Angst finden kann. Aus diesem Abstand erwachsen, als Frucht der Freiheit, die Sprache und alle Wunder der Kultur, Formen des Zusammenseins, Recht, Kunst und Religion»2. An der Weite und Tiefe des Abstandes, die der Einzelne zwischen Vorausschau und Rückblick sich offen zu halten vermag, liegt das Maß seiner Größe und Selbständigkeit.
Nur wenn der Einzelne immer wieder diesen Abstand gewinnt und verteidigt, kann er sich aus der Zwangsjacke der ehernen Familien- und Gruppenbindungen, der religiösen Dogmen, der einengenden staatlichen Tyrannei und des wissenschaftlich verbrämten, weltanschaulichen Determinismus befreien.
Im Abstand gründet die Erkenntnis und darin manifestiert sich zuerst die Freiheit; und aus dieser inneren Offenheit nährt sich der Wille zur mutigen Tat. Daher entspricht es nur einem Blick aus einer anderen Ecke, aber auf denselben Sachverhalt, wenn Schiller (1759–1805) ausruft: «Alle anderen Dinge müssen; der Mensch ist das Wesen, welches will. Eben deswegen ist des Menschen nichts so unwürdig, als Gewalt zu erleiden, denn Gewalt hebt ihn auf»3. Von dieser Überzeugung durchdrungen, appellierte der Ehrenbürger der Französischen Revolutionsrepublik4 an seine Zeitgenossen, die kulturelle Entwicklung zu fördern und sich moralisch zu bilden. Einerseits soll die Kultur den Menschen «fähig machen, seinen Willen zu behaupten»; anderseits sei nur der «moralisch gebildete Mensch … ganz frei»5.
So ist frei, wer inneren Abstand zu wahren versteht, seine Lage erfasst, bewusst sich Ziele setzt und darin sich als homme ausweist, der – wie Pascal (1623–1662) es einmal formulierte – «unendlich den Menschen übersteigt»6. In diesem Gedanken wurzelt auch Goethes (1749–1832) Hoffnung auf individuelle Fortdauer: «denn, wenn ich bis an mein Ende rastlos wirke, so ist die Natur verpflichtet, mir eine andere Form des Daseins anzuweisen, wenn die jetzige meinen Geist nicht ferner auszuhalten vermag»7.
Wer, diesem Leitgedanken folgend, dem Einzelnen als solchem prinzipiell, d.h. theoretisch zubilligt, den eigenen Lebensweg selbst entwerfen zu können, darf die Augen nicht davor verschließen, dass er sich eo ipso dazu verpflichtet hat, anzuerkennen, dass dann jedem konkreten Individuum menschlichen Antlitzes dieses Recht – mit allen Konsequenzen – tatsächlich zustehe.
Dass diese Präzisierung nicht obsolet ist, lehrt ein Blick auf die berühmte Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen von 1789, welche dem Einzelnen zwar wichtige Anrechte zuerkannte, aber fast durchwegs mit einem caveat, einem Vorbehalt, versehen hat. So legt Art. 1 zunächst fest: «Die Menschen werden frei geboren und bleiben frei und gleich an Rechten» – worauf jedoch sogleich der Satz folgt: «Die sozialen Unterschiede können in nichts anderem als in der utilité commune [Nutzen für die Allgemeinheit] gegründet sein»8.
Die Individuen sind also nur im Prinzip einander gleichgestellt; deren unterschiedliche Meriten in Hinblick auf die Gemeinnützlichkeit legen den Grundstein zu neuer Diskriminierung. So heißt es beispielsweise in Art. 10 zwar einleitend: «Niemand darf wegen seiner Ansichten, und seien sie auch religiöser Natur, beunruhigt werden» – doch folgt anschließend die Einschränkung: «vorausgesetzt, dass deren Bekundung die durch das Gesetz festgelegte Ordnung nicht störe»9. Ähnlich verhält es sich mit Art. 11, der vielversprechend wie folgt anhebt: «Die freie Äußerung der Gedanken und der Ansichten ist eines der kostbarsten Rechte des Menschen; jeder Bürger kann also frei reden, schreiben, drucken» – aber lakonisch verdeutlicht: «… ausgenommen [sind] die zur Verantwortung zu ziehenden Missbräuche dieser Freiheit in den durch das Gesetz festgeschriebenen Fällen»10.
Diese irritierenden Ambivalenzen hat Matthias Claudius (1740– 1815) mit der bissigen Bemerkung quittiert, es seien «schöne allgemeine Wahrheiten wie zarte Blumen. Aber so leicht wie sie entstehen, vergehen sie auch wieder; weil sie … immer geben und nehmen und zwei Hände haben, dabei man sie anfassen kann»11. Demgegenüber sah Karl Marx (1818–1883) in den Formulierungen von 1789 nichts Anderes als «die Rechte des Mitglieds der bürgerlichen Gesellschaft, d.h. des egoistischen Menschen, des vom Menschen und vom Gemeinwesen getrennten Menschen»12. Deutlich belegt dieser Ausspruch, dass für Marx das Kollektiv die Geschicke des Einzelnen vorzuschreiben habe. Der individuelle Mensch müsse, so meint er, zum Gattungswesen werden, solle sich seine «Emanzipation» vollenden13.
Doch zurück zur Lage in Paris nach dem Aufbruch von 1789: Das Beanstandete, noch Mangelhafte der Déclaration von 1789 hat man bald erkannt und nach Remedur gesucht. Nach mehreren Anläufen haben vor allem Marie-Jean Hérault de Séchelles, Georges Couthon und Louis Antoine de Saint-Just einen Verfassungstext entworfen, Constitution du Peuple Français du 24 juin 1793, den der Nationalkonvent am 24. Juni 1793 verabschiedete und welcher dann am 10. August 1793 in einer Volksabstimmung mit großer Mehrheit angenommen worden ist. In dieser überaus demokratischen Verfassung, die mit einer «Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte» anhebt, stechen zum Beispiel folgende Artikel hervor: «Art. 31. Vergehen der Beauftragten des Volkes oder seiner Vertreter sollen niemals straflos bleiben. Niemand hat das Recht, sich für unverletzlicher als die übrigen Bürger zu halten.»; «Art. 33. Der Widerstand gegen Unterdrückung ist die Folge der übrigen Menschenrechte.»; «Art. 35. Wenn die Regierung die Rechte des Volkes verletzt, ist für das Volk und jeden Teil des Volkes der Aufstand das heiligste seiner Rechte und die unerlässlichste seiner Pflichten.» Obwohl diese Verfassung sofort in Kraft trat, hat sie der Nationalkonvent tragischerweise bereits am 13. August 1793 abgesetzt, angeblich bis zum Friedensabschluss mit den ausländischen Mächten. Er setzte einen Wohlfahrtsausschuss zur Fortführung der Regierungsgeschäfte ein und löste sich auf. Gegen den Herbst 1793 verwandelte sich die Regierung unter dem Wohlfahrtsausschuss, dessen wichtigstes Mitglied Maximilien de Robespierre war, in eine abscheuliche Terrorherrschaft, die bis Sommer 1794 wütete.
Nach dem bedeutenden Schritt von 1789 und dem schrecklichen Terrorregime 1793–94 setzte sich im ganzen Abendland eine langanhaltende, sehr wechselvolle Debatte um die Menschenrechte fort, die bis in die jüngste Zeit an verschiedenen Orten immer wieder von schlimmsten Rückfällen überschattet worden ist. Ein frischer, neuer Geist weht uns erst aus dem von der UNO-Vollversammlung am 10.12.1948 verabschiedeten Text entgegen14. Da lautet Art. 1: «Alle Menschen werden frei geboren und gleich an Würde und Rechten. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen die aufeinander bezogenen Handlungen in einem Geist der Brüderlichkeit vollziehen»15. Hier entfällt der Hinweis auf eine utilité commune und auf die damit scheinbar gerechtfertigten sozialen Unterschiede; stattdessen wird jeder Einzelne dazu aufgefordert, jeden Anderen als ihm selbst ebenbürtig, als seinen Bruder anzuerkennen.
Dass es dabei tatsächlich um das einzelne Individuum geht, hebt Art. 2 hervor, gemäß welchem jedem Einzelnen als solchem die Grundrechte zustünden, unabhängig davon, ob er einer bestimmten Gruppe angehöre oder nicht. Dementsprechend gewährt Art. 19 dem Einzelnen das Recht auf freie Ansichten und auf freie Äußerung seiner Ansichten und schützt das Recht des Einzelnen auf Empfang und Verbreitung von Informationen und Ideen. Und Art. 20, Absatz 2, hält diesbezüglich abschließend fest: «Niemand darf gezwungen werden, irgendeiner Gruppierung anzugehören»16.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.