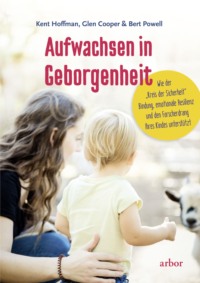Kitabı oku: «Aufwachsen in Geborgenheit», sayfa 3
• das Bedürfnis nach Zuwendung: der Instinkt, in jemandes Nähe zu bleiben, der Geborgenheit und Schutz bieten und die eigenen Gefühle ordnen kann
• Erkundung: der Instinkt, der eigenen Neugier zu folgen und etwas zu meistern
• das Gewähren von Zuwendung: der Instinkt, die benötigte Zuwendung zu geben und eine Bindung zu dem Baby zu entwickeln
Wie Sie in Kapitel 3 sehen werden, bilden diese drei Instinkte die Landschaft für den Kreis der Sicherheit. Diese Instinkte erklären, warum Babys eine sichere Bindung brauchen, damit sie weiterleben, sich entwickeln und zu Individuen werden, und warum sie am besten in Beziehungen gedeihen. Ironischerweise konzentrieren sich viele Menschen in der Pädagogik heutzutage noch immer auf das Verhalten, vielleicht, weil es etwas ist, das wir von außen sehen können, und wenn wir es verändern können, denken wir, dass wir damit die Probleme gelöst hätten. Doch Verhaltensweisen sind lediglich Ausdruck der Bedürfnisse eines Kindes. Verhalten ist eine Botschaft – eine Botschaft bezüglich der Bindungsbedürfnisse, die vor den Augen aller verborgen liegen.
Vor den Augen aller verborgen: Warum Verhaltensmanagement nicht ausreicht
Mal ehrlich: Als Eltern oder werdende Eltern haben wir viel dringendere Sorgen als die Aufwertung der Spezies für eine ungewisse Zukunft. Wir alle haben mehr als genug zu tun, und der Versuch, unseren eigenen Kindern eine gesunde Entwicklung zu ermöglichen, ist schon überfordernd genug. Das ist natürlich auch der Grund, warum so viele Eltern und andere Betreuer von Kindern auf Verhaltensmanagement zurückgreifen, um die Kinder dazu anzutreiben, in Bezug auf ihre Gefühle, ihr Verhalten und ihr ganzes Sein ihr Bestes zu geben. Wie wir bereits sagten, haben Belohnungen durchaus ihren Platz im Leben mit Kindern. Doch wenn wir lediglich auf die sichtbaren Verhaltensweisen abzielen, können wir uns auch gleich an den Gedanken gewöhnen, für immer und ewig mit „Sternchentabellen“ und „Auszeiten“ zu arbeiten. (Stellen Sie sich einmal vor, Sie müssten Ihrer dreißigjährigen Tochter jede Woche zehn Euro schicken, damit sie Sie anruft.) Wenn man nur das Verhalten adressiert, dann ist das in etwa so, wie wenn man zwar die Symptome einer Erkrankung behandelt, deren Ursachen jedoch ignoriert.
Die Entstehung der Bindungstheorie
Wenn Babys mit allen offensichtlichen Notwendigkeiten des Lebens versorgt wurden, aber dennoch nicht gediehen, so spekulierte John Bowlby, lag dem Drang zur Bindung möglicherweise ein tieferer Instinkt zugrunde: Steckte ein evolutionärer Trieb dahinter? Konnte etwas, das Eltern ihren Kindern über die körperlichen, lebensnotwendigen Bedürfnisse hinaus gaben, zum Erhalt der Spezies notwendig sein?
Untersuchungen an Tieren bestätigten dies. Konrad Lorenz, Pionier und Experte auf dem Gebiet der Tierverhaltensforschung, fand heraus, dass kleine Gänschen aufgrund eines Phänomens namens „Prägung“ demjenigen Tier oder Objekt folgen, das sie als Erstes sehen. Später erforschte der Psychologe Harry Harlow die Mutter-Kind-Bindung, indem er das Verhalten von Babyaffen beobachtete. Zunächst stellte er fest, dass die Affen, die im Labor und isoliert von anderen Affen aufgezogen wurden, sich zurückzogen, kein normales Sozialverhalten mit anderen Affen, dafür aber ein ungewöhnliches Ausmaß an Angst und Aggression zeigten. Als er in einer zweiten Studie jungen Affen die Wahl gab zwischen einem Affen aus Draht, der Futter ausgab, und einem Affen aus Stoff, der das nicht tat, wählte die überwältigende Mehrheit der Babys einen Affen, der sich eher wie das Fell der Mutter anfühlte, selbst wenn er kein Futter anbieten konnte. Nachdem sie mit diesen Ersatzmüttern bekannt gemacht wurden, kehrten sie wieder und wieder zu der gleichen Attrappe zurück und zeigten klare Anzeichen dessen, was inzwischen als „Bindung“ bekannt ist.
In den darauffolgenden Jahrzehnten formulierte Bowlby die Bindungstheorie, eine Perspektive, die erklärt, auf welche Art und Weise die Suche nach Verbundenheit mit einer primären Bezugsperson nicht nur dem Überleben des Individuums dient, sondern auch dem Erhalt der Spezies. Prägung als eine Art primitives Bindungsverhalten kann somit als Weg betrachtet werden, auf dem das neugeborene Tier in seine Spezies eingeführt wird – nicht nur, damit das Junge von einem Tier mit denselben Bedürfnissen und dem Wissen, wie sie befriedigt werden können, Überlebensstrategien lernt, sondern auch, damit es später weiß, nach welchen anderen Tieren es zur Paarung und Fortpflanzung suchen soll.
Doch in welchem Maß ähneln wir Menschen den Tieren? Wie wird der Erhalt der menschlichen Spezies durch Bindung gefördert? Die einfachste Antwort ist die: Wenn menschliche Babys in der Nähe eines sie beschützenden, fürsorglichen Erwachsenen bleiben, ist die Wahrscheinlichkeit des langfristigen Überlebens höher, und je mehr Kinder das Erwachsenenalter erreichen, desto eher bleibt die Spezies bestehen. Allerdings wissen wir inzwischen, dass Bindung sich positiv auf die Entwicklung auswirkt und nicht nur für mehr erwachsene Menschen sorgt, sondern auch für bessere. Durch sichere Bindungen überlebt die Spezies nicht nur, sie entwickelt sich auch weiter. Wenn der Bindung also ein solch enormes Potenzial innewohnt, wie lässt sich dann ihre Entstehung begreifen, und wie kann man dafür sorgen, dass sie sich so oft wie möglich entwickelt?
Zurück ins Labor der Menschheit. Die Entwicklungspsychologin Mary Ainsworth, Mitarbeiterin in Bowlbys Forschungsteam in London, spielte eine entscheidende Rolle dabei, die Muster bei der Entstehung von Bindung aufzuzeigen. Basierend auf ihren Beobachtungen bei einer bahnbrechenden Feldstudie in Uganda und später in Baltimore in den Vereinigten Staaten legte Ainsworth verschiedene Bindungsstile fest, die zwischen der Mutter (oder einer anderen primären Bezugsperson) und dem Baby entstehen. Später entwickelte Ainsworth außerdem ein sehr nützliches Forschungsinstrument zur Identifikation des Bindungsstils einzelner Eltern-Kind-Paare. Ainsworths sogenannter Fremde-Situations-Test (FST, auf Englisch: Strange Situation Test, SST), der in Kapitel 4 beschrieben wird, ist heute der Maßstab zur Erfassung des Bindungsstils und ein zentraler Bestandteil unserer eigenen Arbeit mit Familien. Er hilft uns und anderen, die mit der Bindungsthematik arbeiten, zu verstehen, wo Bindung möglicherweise nicht sicher ist und wie man Eltern und Kindern helfen kann, eine Bindung zu entwickeln.
Wenn wir es mit einem Kind zu tun haben, das „sich danebenbenimmt“ oder bekümmert wirkt, ist es hilfreich zu überlegen, was möglicherweise vor aller Augen verborgen liegen könnte: Ist das Kind frustriert, weil es das Gefühl hat, uns sein Bedürfnis nach Geborgenheit nicht verständlich machen zu können? Ist dieses kleine Mädchen „so emotional“, weil es nicht gelernt hat, seine Gefühle mithilfe des liebevollen Verständnisses und der souveränen Begrenzungen eines Erwachsenen zu regulieren? Tut dieser kleine Junge sich so schwer damit, das Alphabet zu lernen, weil er innerlich ständig versucht, sein Bedürfnis auszudrücken, selbst der Architekt seiner eigenen Abenteuer zu sein? Hat dieses Kind vielleicht deswegen Schwierigkeiten damit, Freunde zu finden, weil es nicht gelernt hat, auf das Wohlwollen anderer zu vertrauen?
Das, was vor den Augen aller verborgen liegt, wurde in den letzten fünfzig Jahren von der Wissenschaft ausführlich erforscht. Wir wissen jetzt, dass die Bindung sich auf den Stresslevel eines Kindes, seine Fähigkeit, mit emotionalen Erfahrungen umzugehen, seine Lernkapazität, seine körperliche Vitalität, sein soziales Wohlbefinden und vieles mehr auswirkt. Je mehr wir als Eltern darüber wissen, was unter dem Verhalten unseres Kindes und vor unseren Augen verborgen liegt, desto klarer erkennen wir die Notwendigkeit, eine sichere Bindung zu ihm aufzubauen.
Der führende Neuropsychologieforscher Allan Schore fand heraus, dass die Entwicklung vieler regulierender und überlebenswichtiger Funktionen in der rechten Gehirnhälfte (die während der ersten drei Lebensjahre dominanter ist als die linke) von den Erfahrungen des Babys abhängt, insbesondere von den Bindungserfahrungen mit seiner primären Bezugsperson.
Eine sichere Bindung schützt Kinder vor toxischem Stress
Wenn Bindung ein solch hartnäckiger, ursprünglicher Instinkt ist, dann stellen Sie sich einmal vor, wie viel Stress es verursachen muss, wenn er blockiert ist. Der Stress unerfüllter Bindungsbedürfnisse kann sich im Verhalten eines Kindes ausdrücken (Wie verhalten Sie sich, wenn Sie großen Stress haben?), und aus zahlreichen Studien wissen wir, dass er sich ebenfalls negativ auf die mentale, emotionale, soziale und körperliche Entwicklung des Kindes auswirkt.
Die Art von Stress, die in der frühen Kindheit beginnt, wenn die Nöte eines hilflosen Neugeborenen nicht durch die Geborgenheit eines Elternteils gelindert werden, nennt man „toxischen Stress“, weil er im Gehirn neuronale Bahnen erzeugt, durch deren Aktivierung das Kind sich ständig in einem alarmierten Zustand befindet. Dieser Zustand erschwert es dem Kind, sich auf das Lernen zu konzentrieren, und macht es anfällig dafür, vorschnell zu reagieren, bevor es sich fragen kann, was überhaupt los ist. Wenn ein Baby hungrig, nass oder verängstigt ist, strömt das Stresshormon Cortisol durch sein Gehirn; Cortisol löst eine Art von Verlangen aus, das sich wie ein „schwarzes Loch“ anfühlt und das ein Neugeborenes zwar nicht artikulieren kann, aber intensiv spürt. (Auf Seite 51 finden Sie weitere Details zu den gesundheitlichen Auswirkungen von übermäßigem Stress.)
Wenn wir uns in der Anwesenheit einer liebevollen, verlässlichen Bezugsperson sicher fühlen, ist das so, als ob man uns eine zweite Haut gibt, die uns in stressigen Zeiten schützt.
Sicherheit sorgt dafür, dass Kinder sich gesund entwickeln
Der durch unerfüllte Bindungsbedürfnisse ausgelöste Stress kann ein Kind nicht nur in der frühen Kindheit, sondern auch während seiner gesamten Entwicklung belasten. Auch wenn sich nur schwer sagen lässt, wie direkt eine sichere Bindung sich auf die Erreichung bestimmter Entwicklungsmeilensteine auswirkt, wies eine bahnbrechende, dreißig Jahre andauernde Studie an der Universität von Minnesota, die Mitte der 1970er-Jahre begann, langfristige Muster zwischen einer sicheren Bindung und bestimmten Entwicklungsaspekten nach. Stellen Sie sich einen Neunjährigen vor, dessen Mutter Brustkrebs hat oder dessen Vater als Alleinverdiener der Familie seine Arbeit verloren hat. Ereignisse wie diese, tragisch, aber weit verbreitet, sorgen für großen Stress. Hier kommt die Sicherheit, die wir aus einer guten Bindung beziehen, zur Rettung. Die Wissenschaftler aus Minnesota fanden unter anderem heraus, dass Kinder in der vierten Klasse mit einer sicheren Bindungsgeschichte weniger Verhaltensprobleme hatten, wenn ihre Familien unter großen Stress gerieten, als solche, die keine sichere Bindung erlebt hatten.
Stress und Gesundheit
Der menschliche Körper ist mit einem brillanten System zum Umgang mit Bedrohungen ausgestattet. Allerdings haben wir meist keine Kontrolle über die Art der Bedrohungen, denen wir uns gegenüber sehen: ständige Sorgen um die finanzielle Situation, Familienkonflikte, das Leben in einer gefährlichen Umgebung oder, im Falle eines Kindes, die allgemeine An- oder Abwesenheit einer feinfühligen, zugänglichen Bezugsperson – und dadurch entsteht Stress. Eine wahrgenommene Bedrohung löst eine komplexe Reihe neurochemischer Prozesse aus, in die auch das Stresshormon Cortisol involviert ist. Die Hauptaufgabe des Cortisols ist es, den Körper nach dem stressigen Ereignis in einen Zustand des Gleichgewichts und der Stabilität (Homöostase) zurückzubringen. Das Problem ist, dass sich das Cortisol bei der Regulation verschiedener von Stress beeinflusster Systeme, hauptsächlich des Stoffwechsels, nebenbei auch auf andere Systeme auswirkt, allen voran auf das Immunsystem. Die Aufgabe des Cortisols besteht darin, dem Körper zu signalisieren, dass er mit dem Kämpfen aufhören und in einen stabilen Zustand zurückkehren soll; es hat auch eine dämpfende Wirkung auf das Immunsystem und macht den Körper damit anfälliger für Krankheiten. Das ist einer der Gründe dafür, dass Menschen, die unter chronischem Stress leiden, häufiger krank werden als andere. Unglücklicherweise werden durch wiederholte Episoden von akutem Stress und auch durch chronischen Stress übermäßige Mengen an Cortisol freigesetzt – das kann das Gedächtnis und die kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigen und sogar für eine Zunahme von Bauchfett sorgen, was wiederum ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko nach sich zieht. Babys, deren Bindungsbedürfnisse nicht erfüllt werden, beginnen ihr Leben also unter schlechteren geistigen wie körperlichen gesundheitlichen Bedingungen.
Als Erwachsene haben wir oft keinen Begriff mehr davon, wie stressig solch profane Probleme für ein Kind sein können, doch bei einem Baby kann jedes unerfüllte Bedürfnis zu einem Anstieg des Cortisolspiegels führen – und damit zu einer Erweiterung des schwarzen Lochs. Glücklicherweise gibt es ein Gegenmittel: die Geborgenheit, die es bei der Mutter oder dem Vater erlebt. In Laborstudien konnte gezeigt werden, dass der Cortisolspiegel von Babys sinkt, wenn sie in einer stressigen Situation auf den Arm genommen und gehalten werden.
In der Studie aus Minnesota untersuchten L. Alan Sroufe, Byron Egeland, Elizabeth A. Carlson und W. Andrew Collins die Entwicklung von 180 Kindern vom letzten Schwangerschaftstrimester bis ins Erwachsenenalter und stellten fest, dass eine sichere Bindung am Anfang des Lebens einen nachweisbaren Schutz vor den verheerenden Auswirkungen von Stress während der gesamten untersuchten Zeitspanne darstellte.
Außerdem fanden sie Zusammenhänge zwischen Unsicherheit und späteren psychischen Problemen. Sicherheit zu geben bedeutet, einen sicheren Hafen der Geborgenheit und eine sichere Basis für Erkundung zu bieten, je nachdem, was gebraucht wird. In der zuvor beschriebenen Szene konnten wir sehen, wie Leis Vater seiner Tochter beides gab. In der Minnesota-Studie zeigten Kinder, deren Eltern ihnen keine emotionale Geborgenheit geben konnten, mehr Störungen des Sozialverhaltens in der Adoleszenz, und Kinder, die von ihren Eltern am Erkunden gehindert wurden, litten als Jugendliche mit größerer Wahrscheinlichkeit unter Angststörungen. Die Studie fand zudem einen Zusammenhang (wenn auch keinen ganz so deutlichen) zwischen diesen zwei Arten von Unsicherheit und Depressionen – die Kinder fühlten sich entweder hoffnungslos und entfremdet oder hilflos und ängstlich.
Der Weg der Entwicklung ist voller Aufgaben, die Ihr Baby bewältigen muss, Fertigkeiten, die es zu lernen, und Fähigkeiten, die es zu entwickeln gilt. Und wie sie sehen werden, spielt Bindung bei vielen davon eine entscheidende Rolle.
Lernen, Gefühle zu regulieren
Ihr Wonneproppen mag Ihnen während der ersten Monate oftmals gar nicht so wonnevoll vorkommen. Experten der Entwicklungspsychologie sind sich weitgehend einig, dass ein zuverlässiges Elternteil oder eine andere primäre Bezugsperson – in der Psychologie „Bindungsfigur“ genannt – vor allem dazu dient, dem Säugling in seiner ganzen Angst zu helfen. Offensichtlich können Babys mit der intensiven und verwirrenden Erfahrung von Gefühlen nicht alleine umgehen. Zuerst regulieren Mutter oder der Vater die Gefühle des Babys von außen – sie beruhigen es, wenn es schreit, singen Schlaflieder, lächeln es zärtlich an, wiegen es hin und her und vielerlei mehr. Wenn das Baby erlebt, dass jemand ihm helfen kann, schwierige Gefühle annehmbar und verkraftbar zu machen, wendet es sich in Situationen, in denen es etwas braucht, in zunehmendem Maße an diese Bezugsperson, und dadurch lernt es langsam, sich selbst zu beruhigen. Schließlich, wenn alles nach dem in uns angelegten Plan verläuft, lernt das Kind, seine eigenen Gefühle zu regulieren. Jetzt beginnt in ihm die Fähigkeit zu knospen, sich selbst zu trösten, wenn es in den Kindergarten gebracht wird, anstatt den ganzen Vormittag lang zu schluchzen. Es kann sich jetzt die Angst vor dem Monster unter dem Bett manchmal selbst ausreden, anstatt endlos bei anderen nach Beschwichtigung zu suchen, weil es sich nicht selbst beruhigen kann. Jetzt kann es sich kurz wegdrehen, wenn es sich bei der Begegnung mit jemand Unbekanntem schüchtern fühlt, und dann noch einmal hinschauen, sobald es sich beruhigt hat. (Außerdem hat es die wichtige und wertvolle Lektion gelernt, dass es sich, falls notwendig, auch im weiteren Leben zur Co-Regulation an andere wenden kann.) Seine emotionale Erregung steuern zu können gibt dem Kind nicht nur die Freiheit, sich dem Lernen und seiner Entwicklung zu widmen, sondern es verhindert zudem die gefährliche Anhäufung von Cortisol und fördert folglich die Gesundheit. Aktuelle und noch laufende Forschungen zeigen, dass die Fähigkeit zur Gefühlsregulation weitreichende positive Auswirkungen hat, denn wenn man nicht unter dem Stress zu lange anhaltender oder übertriebener Gefühle leidet, ist man frei, das Leben in seiner ganzen Fülle auszukosten.
In der Minnesota-Studie wurde festgestellt, dass Sicherheit Kinder weniger für Frustration oder Aggression anfällig machte, wenn sie sich sozialen Konflikten ausgesetzt sahen, ebenso weniger dafür, einfach aufzugeben und sich abzuwenden. Sie zeigten größere Hartnäckigkeit und Flexibilität, sowie allgemein weniger Geheule und Getue.
Auf diese Weise leistet uns die Fähigkeit zur Emotionsregulation während unseres ganzen Lebens gute Dienste. Sie hilft uns, unsere Arbeit produktiver zu machen, effektiv und liebenswürdig mit diesem nervigen Nachbarn umzugehen und unseren Wunsch, „die Welt zu verändern“, in die von uns gewünschten Bahnen zu lenken – und Emotionsregulation ist auch für Beziehungen super. Und das nicht nur, weil wir unserem tobenden Kleinkind nicht tatsächlich „den Hals umdrehen“ oder uns permanent über die „Unsensibilität“ unserer Freunde beschweren, wenn wir unsere Gefühle regulieren können, sondern auch, weil die Fähigkeit zur Co-Regulation von Gefühlen ein wichtiger Bestandteil von Intimität ist. Sie haben einen Arzttermin, vor dem Sie sich fürchten? Wenn Sie Ihren Partner oder einen engen Freund an Ihrer Seite haben, kann Ihnen das helfen, Ihre Angst (und das Cortisol) auf einem erträglichen Niveau zu halten. Haben Sie schon einmal an der Seite eines vertrauten Menschen einen Verlust betrauert und festgestellt, dass Ihr Kummer sich schneller verflüchtigte, als Sie es für möglich gehalten hätten? Falls ja, was fühlen Sie jetzt, während Sie sich an diesen Moment erinnern, in Bezug auf diesen Menschen?
Ein warnender Hinweis: Verwechseln Sie „Emotionsregulation“ nicht mit dem Abwehren oder Unterdrücken von Gefühlen. In der Wiege einer sicheren Bindung lernen Babys und Kinder, dass Gefühle etwas Normales, Akzeptables und Nützliches sind. Allein die Akzeptanz eines Gefühls ist schon sehr wirksam, um zu verhindern, dass es außer Kontrolle gerät oder über seine Nützlichkeit hinaus weiter bestehen bleibt. Wir helfen unseren Babys, diese wertvollen Fertigkeiten zu lernen, indem wir während ihrer gesamten Erfahrung „mit ihnen sind“. Diesem Thema ist Kapitel 4 gewidmet.
Achten Sie jedoch auch darauf, den Gefühlen Ihres Kindes nicht zu viel Priorität einzuräumen. In dem Versuch, für die emotionalen Bedürfnisse unsere Kinder sensibel zu sein, bringen wir ihnen manchmal unabsichtlich bei, dass jedes Gefühl, das sie haben, von überragender Wichtigkeit ist und „jetzt sofort“ beachtet werden muss – was aber in Wirklichkeit der Entwicklung von Resilienz entgegenwirkt.
Ein Individuum werden – ohne allein zu sein
Die kleinen Hände eines sechsjährigen Mädchens fingern an dem dünnen Docht herum, den ihr Vater an einen Kleiderbügel gebunden hat. Vor ihr steht der vertraute Einmachtopf der Familie, der jetzt warmes Wasser und einen Behälter mit flüssigem Wachs enthält. Vorsichtig und mit der nervösen Präzision einer Erstklässlerin taucht das Mädchen den Docht langsam in das leicht sprudelnde Wachs. Die erste Schicht ist kaum sichtbar, als sie ihn hochzieht und ihren Eltern zeigt. Der Vater spürt ihre Verunsicherung und vergewissert ihr, dass die Kerze nach und nach entsteht, wenn sie sie immer wieder eintaucht. Auch die zweite und die dritte Runde bringen noch kaum sichtbare Ergebnisse. Dann sieht das Mädchen plötzlich freudig überrascht, wie das Wachs an dem vor ihr baumelnden Docht haftet. Immer wieder taucht sie ihn ein. Und Immer wieder schaut sie hinüber, um das Lächeln in den Augen ihrer Mutter zu sehen, während die Kerze größer wird. Die Vergewisserung, die sie wenige Minuten zuvor noch zu brauchen schien, ist jetzt in ihr eigenes Wissen übergegangen, während sie den Prozess der Kerzenherstellung fortsetzt. Noch Monate, sogar Jahre später, wenn diese eine Kerze angezündet wird, kann sie die Vergewisserung, das Vertrauen, das Vergnügen und die Freude, die sie bei ihrer Herstellung erlebt hat, wieder spüren.
Früh gelerntes Vertrauen wirkt sich sehr langfristig aus. Dieses sechsjährige Kind durfte sozusagen in der fürsorglichen Reaktion ihrer Eltern baden, eine Ressource, die sie seit dem Moment ihrer Geburt kennt. In ihren frühesten Jahren hat sie eine Einstimmung und eine Feinfühligkeit erfahren, die ihr erlauben, sich in ihrer Umgebung niederzulassen und darauf zu vertrauen, dass gut für sie gesorgt wird. Kleine Kinder brauchen die Sicherheit, dass jemand da ist, der sich verlässlich um ihre körperlichen und emotionalen Bedürfnisse kümmert. Vertrauen in sich selbst und Vertrauen in andere beruht stets auf der frühen Erfahrung, sich auf die Feinfühligkeit und die Zugänglichkeit mindestens einer ansprechbaren Bezugsperson verlassen zu können – mit anderen Worten, es beruht auf durch Bindung vermittelte Sicherheit. In der Entwicklungspsychologie wird die Entwicklung eines kohärenten Selbstgefühls – also die Entwicklung der Persönlichkeit, der Identität und so weiter – natürlich als ein wichtiges Ziel betrachtet. Wenn ein Elternteil feinfühlig und warmherzig auf die frühesten Bedürfnisse eines Kindes reagiert, wird das Selbst mit jeder Interaktion geformt, ähnlich wie der Docht, der so oft in das Wachs getaucht wird, bis die Kerze entstanden ist. Die Betonung liegt hierbei auf Interaktion, denn in dieser ersten Beziehung beginnt die Individuation des Babys, und durch alle weiteren Beziehungen in unserem Leben entwickeln wir uns weiter. Wenn die Bindung sicher ist, werden alle psychischen Fähigkeiten des heranwachsenden Kindes so gefördert, dass sie schließlich ein kohärentes Selbst bilden – eines, in dem die Erinnerungen und das Selbstbild eines Menschen in einem verständlichen Zusammenhang stehen mit der Geschichte, die ihn geprägt hat.
Es mag paradox erscheinen, dass wir nur im Kontext anderer Menschen ein starkes Selbstgefühl entwickeln. Aber womöglich ist das ganz und gar nicht paradox: Ein Baby erkennt, dass es ein Individuum ist, wenn es sich dessen bewusst wird, dass es in diesem „Wir“ ein „Ich“ und ein „Du“ gibt. Eine sichere Bindung zu einem fürsorglichen Erwachsenen unterstützt das Baby, ein eigenständiges Individuum zu werden, und erspart ihm die Verwirrung und den Stress, allein und hilflos zu sein. Um die oft schwierigen und verwirrenden Erfahrungen, die mit dem Entstehen des Selbstgefühls einhergehen, zu bewältigen, braucht das Baby einen „anderen“, der für es da ist, der es versteht und einfühlsam reguliert. Wenn ein Kind viele Male die Erfahrung macht, getröstet und auf feinfühlige Weise angeregt und beruhigt zu werden, ist das ungefähr so, wie wenn der Docht des sich entwickelnden Selbst immer wieder in die Qualität der Beziehung zu den Menschen um es herum eingetaucht wird.
Für ein neugeborenes Baby ist es natürlich überlebenswichtig, nicht allein zu sein. Doch Experten sowohl der Bindungstheorie als auch der Objektbeziehungstheorie2 betonen, dass Überleben mehr bedeutet als ein schlagendes Herz und ein voller Bauch. Babys stellen instinktiv eine Verbindung mit dem „anderen“ her, der ihnen helfen kann, die chaotische Welt, in der sie sich wiederfinden, zu begreifen. Ist eine solche Verbindung nicht möglich, hinterlässt das eine beängstigende Leerstelle. Psychoanalytiker wie Donald Winnicott nannten den Terror des Allein- und Verlassenseins, wenn man noch nicht einmal in der Lage ist, Worte zu formen, einen der „Urschmerzen“. Stellen Sie sich einen freien Fall von einem Trapez vor – Sie strecken sich nach den Händen des anderen Akrobaten aus und lassen rechtzeitig die Stange los, um sie zu erreichen… und müssen feststellen, dass da gar niemand ist. Wenn es uns angeboren ist, unser Selbst im Kontext anderer Menschen zu entwickeln, dann bedroht es ganz bestimmt unser Überleben, wenn wir niemanden vorfinden. Stellen Sie sich jetzt vor, dass dieses Gefühl der Verlassenheit – dieses fürchterliche Gefühl, sich im freien Fall zu befinden – für den Rest Ihres Lebens in Ihrer unbewussten Gedankenwelt umherschwirrt. Was für ein Stress!
Der Geist muss frei sein, damit er lernen kann
Es ist keine Übertreibung, zu sagen, dass bei Kindern, die sich sicher und unterstützt fühlen, das Lernen fast von allein vonstattengeht. Wir Menschen sind von Natur aus neugierig, das muss uns nicht erst eingeredet werden. Man muss uns nicht abfragen, um unsere Wahrnehmung zu aktivieren („Welche Farbe ist das?“). Man muss die Kinder nur in ihrem eigenen, naturgegebenen Wunsch danach, etwas zu können, unterstützen. Dieser Wunsch wird ganz natürlich seinen eigenen Fokus und seine eigene Geschwindigkeit finden. Für den vierjährigen Jakob ist es derzeit ein über den ganzen Wohnzimmerboden verteilter Zoo voller Plastiktiere. Im Alter von sieben Jahren wird es dann möglicherweise das Spiel Minecraft auf dem iPad sein. Für einen anderen Siebenjährigen könnte es Malen und Zeichnen sein, oder ein Online-Spiel. Für die dreijährige Lei ist es, wenn sie nicht gerade auf dem Spielplatz ist, alles, was sie in kleine Menschen verwandeln kann, die das ausleben können, was auch immer ihr in den Sinn kommt. In zehn Jahren mag es dann die Konstruktionsweise der höchsten Gebäude der Welt sein, oder höhere Mathematik, von der ihre Eltern noch nie gehört haben.
In der Minnesota-Studie wurde festgestellt, dass sicher gebundene Kinder offener und flexibler Probleme lösen, neue Situationen begrüßen und schwierigen Lernaufgaben mit weniger Frustration und Angst begegnen. Das ist wenig überraschend für uns. Zentral dafür, die Bedürfnisse eines Kindes zu erfüllen, ist die Haltung „Wir kriegen das zusammen hin“ – dass emotionale Schwierigkeiten innerhalb des „Und“ bewältigt werden können.
Natürlich unterscheiden sich Kinder im Hinblick auf ihre intellektuellen Fähigkeiten. Aber eine sichere Bindung bildet zumindest eine gute Grundlage dafür, dass sie ihr einzigartiges Potenzial entfalten können. Ohne diese Sicherheit sind die Kinder von dem Ödland ihrer unerfüllten Bedürfnisse und dem Mangel an Verbindung so gestresst, dass sie an nicht viel anderes denken können, zumindest nicht sehr effizient. Wenn wir mit Lehrern und Eltern über den Zusammenhang von Bindung und kognitiven Fähigkeiten sprechen, sagen wir oft:
Kinder können nicht lernen, wenn ihre Haare in Flammen stehen.
Kinder, die unter großem Stress aufwachsen, sind aufgrund des Mangels an Geborgenheit und anderen Notwendigkeiten oft so sehr damit beschäftigt, sich für Gefahren zu wappnen, dass sie sich nicht konzentrieren können.
Sie scheinen in Ermangelung von sozialem Kontakt auch weniger gut lernen zu können. Schließlich ist bekannt, welche positiven Auswirkungen es auf die Lesekompetenz hat, wenn Eltern ihren Kindergartenkindern vorlesen, oder wie wertvoll es ist, einen wirklich guten Lehrer zu haben. Eine sichere Bindung ist der erste soziale Kontakt, der Ihr Baby beim Lernen unterstützt. Das funktioniert so:
1. Das Elternteil dient als sichere Basis, von der aus das Kind etwas erkunden kann – ob es der Spielplatz ist, wie in Leis Fall, oder ein Chemiebaukasten.
2. Vertrauen in das Elternteil macht es sicher gebundenen Kindern leichter, bei den Eltern Unterstützung beim Lernen zu suchen.
3. Konstruktive, erfreuliche Interaktionen zwischen Eltern und Kind erleichtern den Informationsaustausch.
4. Durch Bindung entwickeln Kinder ein kohärentes Gefühl für sich selbst und für andere, was sie dazu befähigt, klar zu denken und ihren Denkprozess effizient zu regulieren.
Es wurde beobachtet, dass sicher gebundene Kleinkinder aktiver in ihrer Erkundung sind und längere Aufmerksamkeitsspannen haben. In einer Studie beteiligten sich sicher gebundene Zweijährige mehr an symbolischen Spielen, die die Entwicklung einer gesunden, kreativen Fantasie fördern (siehe Seite 61). Ein Diagramm der Wissenschaftler Corine de Ruiter und Marinus van Ijzendoorn zeigt, dass Eltern, wenn sie eine sichere Bindung mit ihren Kindern aufbauen, indem sie ihnen feinfühlige, sanfte und nicht-bestrafende Anleitungen geben, die Selbstachtung des Kindes sowie seine Motivation, Aufmerksamkeitssteuerung, Ausdauer bei Aufgaben und metakognitive Fähigkeiten fördern. All diese Fähigkeiten tragen zu schulischem Erfolg bei.
Die Längsschnittstudie aus Minnesota zeigte, dass unsicher gebundene Kindergartenkinder viel mehr auf ihre Betreuerinnen angewiesen waren als sicher gebundene Kinder im gleichen Alter. Das gleiche Muster zeigte sich in Ferienlagern, als die Kinder zehn Jahre alt waren.
Sicherheit → Selbstvertrauen → Eigenständigkeit
Als Spezies sind wir nicht dazu bestimmt, unabhängig bis hin zur Isolation oder äußersten Selbstgenügsamkeit zu sein, anderseits leben wir nicht sehr lange, wenn wir nicht ein gewisses Maß an Selbstständigkeit erreichen. So wie es auf den ersten Blick paradox erscheinen mag, dass wir jemand „anderen“ brauchen, um ein „Selbst“ zu entwickeln, so werden Kinder, die sich von Geburt an auf einen Erwachsenen verlassen können, auch in der Lage sein, sich auf sich selbst zu verlassen, wenn sie älter sind – weil sie wissen, wann es gut ist, Rat oder Trost bei einer vertrauten Person zu suchen. Und natürlich ist auch das Gegenteil wahr: Kinder ohne eine sichere Bindung haben, wenn sie älter sind, möglicherweise Probleme damit, sich auf sich selbst zu verlassen (oder sie sind unfähig, sich auf irgendjemanden außer sich selbst zu verlassen).