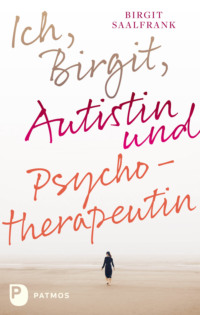Kitabı oku: «Ich, Birgit, Autistin und Psychotherapeutin», sayfa 3
Schuschisch
Meine Mutter las meiner Schwester und mir oft aus dem Buch »Urmel aus dem Eis« von Max Kruse vor. Damals war ich zehn oder elf Jahre alt und Simone sechs. In dieser Geschichte gibt es verschiedene Tiere, denen Herr Professor Habakuk Tibatong das Sprechen beigebracht hat, die jeweils einen individuellen Sprachfehler haben. Mir hatte es besonders der Schuhschnabel »Schusch« angetan, der statt eines »i« immer ein »ä« benutzte. Fortan entwickelte ich auf der Basis der Sprechweise des Vogels Schusch die Sprache »Schuschisch«. Meine Mutter liebte es, wenn ich schuschisch sprach, sie fand das ungemein kreativ. Mein Vater konnte damit gar nichts anfangen und lehnte es ab. »Äsch bom dr Wockl Schosch« hieß zum Beispiel »Ich bin der Vogel Schusch«. Ich sprach vor allem dann schuschisch, wenn ich meinen Gefühlen Ausdruck verleihen wollte, was ich in der normalen Sprache nicht konnte. Ich sagte oder schrieb zum Beispiel meiner Mutter auf einen Zettel, dass ich »drouräg« war, was »traurig« bedeutete. Oder ich fragte sie: »Mugscht mäsch?« Das hieß: »Magst du mich?« Leider erkannte meine Mutter bei ihrer Begeisterung für das Schuschische nicht, dass ich mich oft traurig fühlte und eigentlich Zuspruch und Trost von ihr benötigt hätte. Sie war so auf die angebliche Kreativität dieser Sprache versessen, dass sie mein dahinterstehendes Bedürfnis nicht sah. Außerhalb meiner Familie sprach ich niemals Schuschisch, denn es wäre mir peinlich gewesen und hätte mich verletzlich gemacht.
Der Vogel Schusch war, ähnlich wie später das Würzel, meine Ausdrucksmöglichkeit für Bedürfnisse und Gefühle (die ich im Alltag nicht hatte).
Zwischen dem Vogel Schusch, der etwa bis zu meinem fünfzehnten Lebensjahr existierte beziehungsweise in meinem Leben eine Rolle spielte, und dem Würzel, das in meinem 26. Lebensjahr entstand, lagen zeitlich gesehen ungefähr zehn Jahre.
Ab dem fünfzehnten Lebensjahr bis zum Ende meiner Schulzeit war ich die meiste Zeit überzeugt davon, dass ich keine Gefühle hatte. Ich spürte mich nicht, zeigte auch keine Gefühle nach außen. Zudem litt ich in diesen zehn Jahren unter Essstörungen.
Prägung
Zäsur
Am Mittwoch, dem 15. Februar 1984, ich war knapp dreizehn Jahre alt, zogen wir weg von Oberursel in eine Kleinstadt in der Nähe von Hannover. Am folgenden Montagmorgen klopfte meine Mutter zusammen mit mir an die verschlossene Tür einer mir zugeteilten siebten Gymnasialklasse und öffnete sie. Mir ging es nicht gut, ich fühlte mich kurz vorm Weinen, weil ich Angst hatte, in die neue Klasse zu gehen. In der ersten Pause standen alle Klassenkameraden auf dem Schulhof in einem großen Kreis um mich herum und amüsierten sich über meine Aussprache. In Hannover ist man ja besonders stolz darauf, dass dort das reinste Hochdeutsch gesprochen wird. Ich hatte wohl einen leicht hessischen Einschlag, den ich mir dann aber bald abgewöhnte. Die Reaktion auf mich war nicht eigentlich bösartig, ich wurde einfach neugierig von allen beäugt. Trotzdem war das enormer Stress für mich, dort so im Mittelpunkt zu stehen. Weil ich recht gut in der Schule war, guckte das Mädchen, das neben mir saß, oft von mir ab. Wenn ich jedoch etwas von ihr wissen wollte, hielt sie immer die Hand schützend vor ihr Heft. Ich war deshalb einmal so wütend, dass ich ihr – ehe ich mich versah – den Ellenbogen in die Seite rammte. Ich hatte schneller zugehauen, als ich denken konnte. Das ist mir aber nur ein einziges Mal passiert.
Meine Mutter sagte mir, dass es wichtig sei, Freundinnen zu finden, um jemanden zu haben, wenn es einem mal schlecht geht. Also versuchte ich, in meiner Klasse Kontakte zu knüpfen. Ich lud ein beliebiges Mädchen zu mir nach Hause ein. Zum Spielen waren wir mit unseren dreizehn Jahren inzwischen zu alt. Also saßen wir in meinem Zimmer und versuchten, uns miteinander zu unterhalten. Ich wusste nicht, wie das ging, also überlegte ich mir Fragen, die ich ihr stellen konnte, zum Beispiel: »Was ist deine Lieblingsfarbe?« »Was ist dein Lieblingstier?« Das Gespräch geriet zu einem langweiligen Frage-Antwort-Spiel. Ich habe mich nie wieder mit diesem Mädchen verabredet.
Am Ende der siebten Klasse fuhren wir eine Woche an die Nordsee. Da ich mit den gleichaltrigen Mädchen nichts anfangen konnte, spielte ich immer Fußball mit den Jungen. Bei der Klassenfahrt in der achten Klasse ging es an den Edersee. Ich erinnere mich, dass ich dabei vor allem Rundlauf beim Tischtennis mitspielte und außerdem Federball, also immer sportlichen Betätigungen nachging, die es nicht erforderten, dass man sich mit seinen Klassenkameraden unterhielt. Denn das konnte ich nicht, ich hätte nicht gewusst, worüber ich mit ihnen reden soll.
In meiner Klasse war ein Mädchen, das ich sofort sympathisch fand. Jenny war meine erste Freundin, mit der ich mich auch unterhalten habe. Wir waren beide sehr sportbegeistert, gingen zusammen zum Leichtathletiktraining und sprachen häufig über unsere Väter, an denen wir viel auszusetzen hatten.
Eigentlich war ich aber nur Jennys zweitbeste Freundin. Denn ihre beste Freundin hieß Babette. Sie kannten sich schon seit ihrer Kindergartenzeit. Unsere Englischlehrerin gab uns einmal die Aufgabe, eine Geschichte über unseren besten Freund beziehungsweise unsere beste Freundin zu schreiben. Das war beschämend für mich, denn Jenny war zwar meine beste Freundin, ich aber nicht ihre. Das zeigte sich auch immer wieder bei Klassenfahrten, wenn es darum ging, wer neben ihr im Bus sitzen durfte. Das war natürlich Babette. Ich versuchte immer so zu tun, als machte mir das alles nichts aus, aber ich litt schon ziemlich darunter, nur »zweite Wahl« zu sein.
Gelegentlich ging ich mit Jenny ins Kino. Sie machte sich immer lustig über mich, weil ich mir die verschiedenen Menschen, die im Film mitspielten, nicht merken konnte und deshalb regelmäßig Probleme hatte, die Handlung zu verstehen. Ich litt unter Prosopagnosie (Gesichtserkennungsschwäche), vor allem in Bezug auf Fernsehen und Kino, im realen Leben hatte ich damit nicht so große Probleme. Insbesondere die Männer konnte ich kaum auseinanderhalten, da sie für mich aufgrund ihrer kurzen Haare alle gleich aussahen. Bei Menschen aus anderen Kulturkreisen, zum Beispiel Asiaten, hatte ich dieses Problem auch im realen Leben: Die Männer hatten meist kurze, die Frauen lange schwarze Haare. Zudem waren die Augen- und Nasenformen jeweils ähnlich. Ich fragte mich: Wie konnte man diese Menschen voneinander unterscheiden?
In der Schule interessierten mich einerseits Sprachen (Englisch und Französisch) und andererseits Naturwissenschaften, hier vor allem Chemie. Ich hatte von Anfang an eine wunderbare Chemielehrerin, die uns Jugendlichen dieses Fach mit sehr einfachen bildhaften Beispielen vor Augen führte. So erklärte sie uns, dass bestimmte Atome »einander mögen« und deshalb eine Verbindung miteinander eingehen. Folgerichtig verwendete ich in einer Klassenarbeit ihre kindlichen Formulierungen, wurde dann aber von ihr korrigiert: So etwas dürfe ich doch nicht schreiben! Aber sie hatte es doch so gesagt?! Das verstand ich nicht, hielt mich fortan jedoch daran und schrieb nichts mehr über Sympathien und Antipathien von Atomen und Molekülen. Trotz dieses Zwischenfalls fand ich meine Chemielehrerin weiterhin sehr gut.
Auch Mathematik mochte ich gern, weil ich mir das alles gut vorstellen konnte. Ganz anders als Geschichte und Sozialkunde, da bekam ich keine Bilder in den Kopf und hatte demzufolge große Schwierigkeiten, Begriffe wie zum Beispiel »Judikative« oder »das Kaiserreich« oder »Weimarer Republik« mit ihren jeweiligen Aufgaben beziehungsweise Inhalten zu verstehen und mich für diese Themen zu interessieren. Jahreszahlen waren mir ein Gräuel. Ich verband nichts damit. Ich hätte eine konkrete Geschichte benötigt, die sich um eine bestimmte Person in einem bestimmten Zeitalter rankt, damit ich Interesse an diesen Fächern entwickelt hätte. Nicht nur Zahlen und bildlose Fakten.
Der Sport war in meiner Gymnasialzeit meine Rettung. Wer im Schulsport bei den Besten war, hatte gute Chancen, von der Klassengemeinschaft akzeptiert zu werden. So gewann ich Pluspunkte. Auch in den übrigen Fächern war ich ganz gut. Ich war ehrgeizig und lernte gern. Durch meine Leistungen hatten die Lehrer Achtung vor mir. Deshalb konnte ich mich, da ich ein starkes Gerechtigkeitsempfinden hatte, auch manchmal für meine Mitschüler einsetzen, ohne mir Strafen einzuhandeln. Zum Beispiel hänselte unsere Englischlehrerin häufiger Schüler, die schlecht in Englisch waren oder die sie aus anderen Gründen nicht leiden konnte. Das fand ich nicht gut und sagte das auch laut in der Klasse. Einmal wurde ich deswegen aus dem Klassenraum geschickt, aber weiter passierte nichts.
Jenny und ich waren knapp drei Jahre lang gute Freundinnen. Anfangs verbrachten wir jede große Pause miteinander. Das war eine schöne Zeit. Eines Tages steckte uns jedoch eine Mitschülerin einen Zettel zu, auf dem stand, wir sollten uns nicht immer so von der Klassengemeinschaft ausgrenzen. Ich erschrak, schämte mich und war verunsichert: Anscheinend war es nicht in Ordnung, wie wir uns verhalten hatten.
Mit Jenny verband mich in dieser Zeit auch die Schwärmerei für unseren jungen Trainer in Leichtathletik. Wir stellten uns vor, dass wir uns beim Sport verletzten und er würde sich um uns kümmern. Schwärmerei eben, mehr war das nicht, zumindest nicht für uns. Auf ähnliche Weise schwärmten wir für unsere Sportlehrerin.
Einige Zeit danach fing Jenny jedoch an, sich ernsthaft für Jungen zu interessieren. Genau wie damals in der fünften Klasse Miriam entwickelte sich Jenny jetzt durch die Pubertät weiter – anders als ich, die ich mich weiterhin hauptsächlich für Schule und Sport interessierte, aber nicht für romantische Beziehungen. Bald danach hatte Jenny einen Freund. Dadurch wurde sie mir völlig fremd, ähnlich wie ich ihr vermutlich auch, weil sie nicht verstehen konnte, dass ich meine sportlichen Aktivitäten in dieser Zeit eher noch intensivierte. Unsere Freundschaft zerbrach, weil wir uns nichts mehr zu sagen hatten. Andere Freundschaften hatte ich nicht, also war ich wieder einmal sehr alleine in der Schule.
Leidenschaft
Im Alter von vierzehneinhalb ging ich häufiger im nahe gelegenen Hallenbad zum Schwimmen. Gerne hätte ich bei dieser Gelegenheit auch einmal die Sprunganlage genutzt, aber sie war immer besetzt von den Kunst- und Turmspringern, die dort am Nachmittag trainierten. Irgendwann wurde es mir zu bunt und ich fragte, ob ich mittrainieren könne. Ich durfte und es gefiel mir sehr gut. Es fiel mir auch vergleichsweise leicht, da ich wegen meiner Turnerfahrung bereits über ein gewisses Maß an Körperspannung und Körperkontrolle verfügte.
Fortan ging ich regelmäßig zweimal die Woche zum Springen. Freitags ins Hallenbad, mittwochs in die Turnhalle. Hier gab es innen an einer Seitenmauer eine Vorrichtung, an der man ein Sprungbrett montieren konnte. Von dort aus sprang ich auf eine dicke Matte und übte sozusagen auf dem Trockenen.
Sehr bald intensivierte ich mein Training und nahm an den ersten Wettkämpfen teil. Nach etwa einem Jahr trainierte ich bereits jeden Tag, dazu kamen häufig Lehrgänge am Wochenende. Unser hauptverantwortlicher Trainer hieß Heiko und war der damalige Bundestrainer der Wasserspringer. Viele seiner Schützlinge zählten zu den besten bei den Deutschen Jugendmeisterschaften. Er behandelte seine Springer insgesamt sehr unterschiedlich. Zu einigen war er sehr streng und fasste sie viel härter an als andere. Zu mir war er eigentlich immer freundlich und gutmütig, da hatte ich Glück.
Da ich erst als Jugendliche mit dem Kunstspringen angefangen hatte, trainierte ich aufgrund unseres ähnlichen Leistungsniveaus mit den jüngeren Springern. Mit diesen verstand ich mich ohnehin viel besser. Die älteren unterhielten sich über »Jugendthemen« und interessierten sich für das andere Geschlecht. Damit konnte ich nichts anfangen.
Bei einem Lehrgang schlief ich in einem Dreibettzimmer zusammen mit zwei gleichaltrigen Springerinnen. Am späteren Abend kam einer der älteren Springer zu uns ins Zimmer und schlüpfte zu einer der beiden unter die Decke. Ich erstarrte vor Angst, weil ich dachte, dass die beiden annehmen würden, ich sei schon eingeschlafen. Ich fürchtete, sie würden bemerken, dass ich doch noch wach war, und dann sehr erschrocken oder sogar wütend auf mich sein.
An Weihnachten vor meinem fünfzehnten Geburtstag bekam ich ein Tagebuch geschenkt. Wenn ich nach den Tagebuchnotizen gehe, gewinne ich den Eindruck, dass es mir sowohl in der Zeit mit Jenny als auch in der Anfangszeit des Springens psychisch relativ gut ging. Auffällig ist jedoch, dass ich sehr darauf bedacht war, dort möglichst nichts Negatives zu schreiben. Diese sehr kontrollierte Art des Tagebuchschreibens änderte sich erst mit meinem Auszug von zu Hause. Aus einem Eintrag entnehme ich beispielsweise indirekt, dass das Meerschweinchen Butzilein meiner Schwester gerade gestorben war. Statt darüber zu schreiben und wie es mir und meiner Schwester damit ging, zähle ich im Tagebuch Verhaltensweisen auf, die mir bei der Bewältigung eines solchen Unglücks in Zukunft sinnvoll erscheinen:
1. Keinen Panikausbruch kriegen!
2. Sich klarmachen, dass jedes Tier nicht ewig leben kann.
3. Ruhig gleich in die Stadt gehen und sich ein neues Tier kaufen. Das aber nicht überstürzt in der Aufregung tun, sondern sich das erwählte Tier erst noch einmal näher auf Krankheiten angucken. Wenn möglich zum Züchter gehen.
4. Wenn es geht, das neue Tier aufgrund der Gefahr von Erkältungskrankheiten möglichst nicht im dicksten Winter, sondern eher zu der wärmeren Jahreszeit kaufen.
5. Sich auf jeden Fall nicht »gehenlassen«! Den gewohnten Nachmittagsplan, wenn irgend möglich, beibehalten und auch zur Schule gehen.
Es findet sich ebenfalls kein Eintrag in meinem Tagebuch dazu, dass einige Monate später mein Kaninchen Schnupperle starb. Stattdessen ist zu lesen, dass ich ein neues Kaninchen, Seppelchen, vom Züchter geholt habe und wie sehr ich mich darüber freue.
Ich hatte immer Angst, dass meiner Familie etwas zustoßen könnte. Aus diesem Grund betete ich, obwohl ich eigentlich nicht sonderlich gläubig war, jeden Abend dasselbe: »Lieber Gott, ich danke Dir für den heutigen Tag und ich bitte Dich, mach, dass kein Atomkrieg kommt und kein anderer Krieg und dass heute, morgen, übermorgen und allezeit nichts passiert und dass wir alle noch lange gesund und glücklich leben und mit ein bisschen Geld: Mami, Papi, Birgit und Simone, Butzilein und Schnupperle. Danke, danke, danke, lieber Gott. Amen.« Außerdem schreibe ich in diesem Tagebuch ziemlich genau auf, welche Sprünge ich beim Training gelernt habe und worauf ich bei der Ausführung achten muss. Vom Springen bin ich in dieser Zeit noch total begeistert, von Angst keine Spur. Ich liebte die Körperkontrolle, Spannung und Ästhetik dieses Sports.
Mit sechzehn Jahren fuhr ich mit meiner Mutter und meiner Schwester das erste Mal in meinen Leben so richtig in Urlaub. Diesmal ging es für drei Wochen nach Kreta! Das war toll. Mein Tagebuch ist gefüllt mit detaillierten Schilderungen über unsere Aktivitäten dort.
In Kreta sprach mich an der Strandpromenade ein gleichaltriger Junge an. Ich war völlig erschrocken und hatte Angst, wusste überhaupt nicht, was ich jetzt tun soll. Zu ergänzen ist, dass mein Vater mir immer vermittelt hatte, dass mein Geschlecht nicht weiblich ist, auch nicht männlich, sondern »sportlich«. Das war für mich so etwas wie ein drittes Geschlecht. Mit meiner Weiblichkeit hatte ich mich zu diesem Zeitpunkt also noch gar nicht auseinandergesetzt. Umso mehr fühlte ich mich jetzt überfordert, mit einem Jungen zu sprechen. Aber offensichtlich fingen Mädchen in meinem Alter normalerweise damit an, sich mit Jungen zu treffen, das zeigte ja mein Erlebnis am Strand!
Da ich diesbezüglich noch gar keine Erfahrungen hatte, beschloss ich, dass es nun an der Zeit wäre, sich damit zu beschäftigen. Also nahm ich das Angebot eines anderen jungen Mannes an, der mich am Strand auf eine Cola einlud. Ich verbrachte etwa eineinhalb Stunden mit ihm, in denen ich darauf achtete, dass ich nie mit ihm alleine war, denn das Ganze machte mir doch große Angst. Letzten Endes schwammen wir gemeinsam im Meer, aber nur dort, wo auch andere Menschen waren, und spielten zusammen Beachball. Die Auswertung dieser Erfahrung in meinem Tagebuch erbrachte die Erkenntnis, dass ich:
a) stolz auf mich war, dass ich meine Schüchternheit überwunden hatte und auf den Kontaktversuch eines jungen Mannes eingegangen war (der allerdings, wie ich erfuhr, schon 23 Jahre alt war und rauchte, das fand ich beides nicht so gut);
b) dass ich in Zukunft nicht mehr auf ein x-beliebiges derartiges Kontaktangebot eingehen wollte, sondern nur, wenn der Junge mir auch gefallen würde und in etwa gleichaltrig wäre.
Dieses Erlebnis blieb aber das einzige dieser Art in Kreta. Ich hatte es einmal gewagt und das war fürs Erste genug an Erfahrung.
Grenzen
Zurück in Deutschland, fing ich wieder mit dem Training in Wasserspringen an. Im Oktober, ich war damals sechzehneinhalb, bekam ich beim Training einen Weinkrampf. Ein älterer Springer hatte mich wiederholt kritisiert, als ich versuchte, zweieinhalb Salto vorwärts vom Drei-Meter-Brett zu lernen beziehungsweise Vorübungen dafür machte – mich, die ich so selbstkritisch war! Das hat mich total verletzt. Eine ältere Springerin, Susanne, setzte sich daraufhin neben mich, legte mir den Arm um die Schulter und streichelte mich am Kopf. Das kannte ich gar nicht, dass jemand einen so tröstet.
Meine Mitspringer sowie meine Trainer waren für mich die Menschen, bei denen ich mir in sozialer Hinsicht sehr viel abschaute. Meine Beobachtungen dazu finden sich in meinem Tagebuch wieder. Ich war dabei bemüht, über die Beobachtung ihres Verhaltens ihre Persönlichkeit zu ergründen. Dabei finden sich auch Auflistungen darüber, wen ich mochte und warum. Die Springer waren die Menschen, mit denen ich am meisten Zeit verbrachte und mit denen mich das große gemeinsame Interesse des Wasserspringens verband.
Meine Tage bestanden aus Schule, Hausaufgaben und Springen. Wenn ich abends gegen 21 Uhr vom Training zurückkam, stand das Abendessen noch auf dem Tisch, und meine Mutter setzte sich meistens zu mir. Das Wasserspringen bedeutete mir sehr viel und die Menschen dort waren wie eine richtige Familie für mich. Zumal die Eltern der anderen Springer oft in dem zum Schwimmbad gehörigen Café saßen und uns durch die trennende Glasfront beim Training zusahen. Wenn man dort hinkam, gab man erst einmal allen der Reihe nach die Hand. Ich akzeptierte das Händeschütteln als Ritual, und deshalb war es okay für mich. Meine Eltern kamen nie zum Zuschauen vorbei. Ich hatte es ihnen verboten, und sie hielten sich ohne weiteres Nachfragen daran. Es hätte mich total verunsichert. Ich fürchtete ihre Bewertung meiner Sprünge (Kritik ebenso wie Bewunderung) und hielt sie deshalb vom Wasserspringen gänzlich fern.
Nur wenige Tage nach meinem Weinanfall kugelte ich mir beim kopfwärts Eintauchen vom Turm das linke Schultergelenk aus. Heiko kugelte mir den Arm glücklicherweise gleich wieder ein. Auf dem Heimweg brachte er mich ins örtliche Krankenhaus zum Röntgen. Der Arzt gab mir für ein paar Tage ein Schmerzmittel mit. Als es aufgebraucht war, hatte ich außerordentliche Schmerzen, vor allem nachts, wenn sich die Schulter entspannte. Auf die Idee, deshalb noch mehr Schmerzmittel zu nehmen, kam ich jedoch nicht, sprach auch mit niemandem darüber. Ich dachte: »Die Tabletten sind alle, dann muss das wohl so sein.«
Am Tag nach dem Unfall ging ich mit dem Arm in der Schlinge zur Schule. Die Schulter tat sehr weh, aber ich nahm das alles als gegeben hin. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, deshalb nicht zur Schule zu gehen. Nach einer Woche kam die Schlinge ab und die Schulter war komplett versteift. Also musste ich regelmäßig zur Physiotherapie und die Schulter wurde gedehnt und gekräftigt. Mehrere Wochen konnte ich nicht am Training teilnehmen. Stattdessen machte ich exzessiv meine krankengymnastischen Übungen und ging öfter ins Schwimmbad-Café, um den anderen beim Training zuzusehen und bei meiner »Springer-Familie« zu sein. Nach einigen Monaten begann ich wieder mit dem Trainieren. Immer wieder hatte ich Angst, dass ich mir erneut die Schulter auskugeln würde. Also nahm ich mir in meiner Zielorientiertheit einfach Folgendes vor und notierte es in meinem Tagebuch als eine Art Mantra:
Ich werde mir nie mehr den Arm auskugeln, sondern weiter jede Menge Krafttraining machen, genauso wie Bauchmuskelübungen wegen meiner Rückenschmerzen. Und das sage ich dir: Meine Rückenschmerzen werden weggehen und nicht mehr wiederkommen, auch während des nächsten Lehrgangs nicht! Und ich werde den nächsten Lehrgang voll normal und gut mitmachen, ohne dass mir irgendwas wehtut oder ich erkältet bin oder irgendwas Derartiges!!! Und dasselbe gilt für die Deutschen Jugendmeisterschaften!!! Alle beide in diesem Jahr und auch für die folgenden Jahre!!!
Sozialkontakte hatte ich in dieser Zeit einerseits über das Springen, andererseits aber auch mit ein paar Mitschülerinnen, in deren Gemeinschaft ich sogar die Pausen in der Schule verbringen konnte. Was für ein Glück für mich! Gelegentlich trafen wir uns abends zum Kino oder zu anderen gemeinsamen Unternehmungen. Einmal wöchentlich gab ich außerdem einer jüngeren Schülerin Nachhilfe in Englisch und Mathematik und verdiente mir damit ein bisschen zusätzliches Geld. Nach der Schulterluxation begann ich nun wieder, nicht nur vom Einer, sondern auch vom Dreier zu springen. Sehr gerne mochte ich den Doppelsalto gehockt vom Einer. Ich sprang ihn hoch an, drehte schnell und streckte trotz geschlossener Augen immer zum rechten Zeitpunkt. Ich hatte nie Probleme mit der Orientierung bei diesem Sprung, sondern fühlte einfach, wenn die Doppeldrehung geschafft war. Erst einmal ging es mir also ziemlich gut. Nach einiger Zeit geriet ich jedoch in große Schwierigkeiten.
Diesen Text über meine Jugend zu schreiben, kommt mir am schwierigsten vor. Das liegt daran, dass große Diskrepanzen bestehen zwischen meinen Erinnerungen einerseits und dem, was ich andererseits in meinen beiden Tagebüchern lese. Ich erinnere mich vor allem an psychische Zustände, die ich offenbar nicht mit meinem Tagebuch geteilt habe. Ich schätze, ich wollte sie dort nicht verewigen, sondern dachte, wenn ich sie nicht weiter beachte, gehen sie vielleicht von selbst wieder weg. Was aber nicht der Fall war.
Beim Springen hatte ich seit Neuestem oftmals Angst. Wenn ich Angst vor einem bestimmten Sprung hatte, spürte ich, wie mein Körper sich bewegte, aber ich war nicht mehr da. Es fühlte sich an, als ob mein Körper sich ferngesteuert von mir bewegen würde und ich mit dem Sprung gar nichts zu tun hätte. Das war immer ein sehr erschreckendes Gefühl, als ob ich nicht mehr die Kontrolle über meinen Körper hätte oder nicht mehr in meinem Körper wäre. Wie ich später erfuhr, nennt man diesen Zustand Depersonalisation.
Phasenweise litt ich unter Schlafstörungen, schreckte nachts hoch und ging immer wieder in einer Art von zwanghaften Gedanken beziehungsweise Bildern und Körpergefühlen den Doppelsalto vorwärts durch, bei dem ich irgendwann ganz plötzlich die Orientierung verloren hatte. Ich hatte zu viel nachgedacht über diesen Sprung. Das war so, als ob ein Tausendfüßler beginnt, darüber nachzudenken, wie er es eigentlich schafft, die Bewegung seiner vielen Beine miteinander zu koordinieren – und plötzlich verknoten sich daraufhin seine Beine, weil er versucht, eine unbewusst gut funktionierende Bewegung bewusst zu steuern. Ich fing an mich zu fragen, woher ich eigentlich wusste, wann die beiden Drehungen beim Doppelsalto vorwärts geschafft waren, wenn ich immer die Augen geschlossen hatte. Unser Trainer sagte uns schließlich, dass wir die Augen beim Springen stets offen haben sollten, um die Körperdrehungen mit dem Blick aktiv kontrollieren zu können. Als ich das jedoch versuchte, klappte gar nichts mehr. Ich wusste im Flug überhaupt nicht mehr, wo ich war. Dazu kam, dass ich seit einiger Zeit den Schraubensalto vorwärts übte, das heißt, den Salto vorwärts mit einer ganzen Schraube vom Ein-Meter-Brett beziehungsweise eineinhalb Salto vorwärts mit einer Schraube vom Drei-Meter-Brett. Plötzlich wusste ich nicht mehr, wie man einen Vorwärtssalto ohne eine zusätzliche Schraubendrehung sprang. Ich hatte das Gefühl dafür komplett verloren. Sehr beeinträchtigend war zudem, dass ich mich nur bei unserem Trainer Heiko sicher fühlte, aber oft bei anderen trainieren musste. Wenn Heiko neben mir stand, hatte ich das Gefühl, er würde mir sein ganzes Vertrauen und die Fähigkeiten dazu einflößen, meine Sprünge gut zu bewältigen. Ich fühlte mich wie abhängig davon, bei ihm zu trainieren, als ob er allein über die Kraft verfügte, mich gut springen zu lassen. Alleine hätte ich mich zum Beispiel nie getraut, meine Sprünge zu trainieren, davor hatte ich viel zu große Angst. Bei meinen anderen Trainern hatte ich dieses positive, unterstützende Gefühl deutlich weniger ausgeprägt. Ich benötigte die Anwesenheit und ungeteilte Aufmerksamkeit von Heiko, damit ich überhaupt mit dem notwendigen Vertrauen in meine Fähigkeiten meine Sprünge absolvieren konnte.
Im Philosophieunterricht hatten wir für ein Halbjahr das Thema »Zeit« im Unterricht. Das beschäftigte mich sehr. Wenn ich zu Hause war und Angst vor dem nächsten Training hatte, dachte ich oft darüber nach, dass ich zum Beispiel in sechs Stunden Springtraining gehabt haben würde. Dann wäre die Zeit vergangen, und ich hätte es geschafft.
Vor jedem Training erhielten wir von Heiko einen Plan, was wir an diesem Tag trainieren sollten. Wenn ich meine Serie sah, die ich springen sollte, hatte ich große Angst. Gleichzeitig wusste ich, dass ich sie bald gesprungen haben würde. In dieser Zeit litt ich sehr stark unter den genannten Selbstentfremdungsgefühlen beim Springen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es in meiner Macht liegt, die Sprünge zu steuern, sondern dass mein Körper das irgendwie alleine ohne mich hinbekommen muss.
Kürzlich schaute ich abends einen Livestream der Trampolin-Wettkämpfe der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro 2016. Der Reporter unterhielt sich mit einem Fachmann und plötzlich fiel der Ausdruck »Lost move syndrome (LMS)«. Ich wurde hellhörig und recherchierte im Internet, was damit gemeint war. Dort stieß ich auf einen Fachartikel aus dem Jahr 2015 von Jenn Bennett und anderen Forschern über LMS. Es tritt demzufolge vorzugsweise bei Sportlern aus dem artistischen Formenkreis (Kunstturnen, Wasserspringen, Trampolinspringen) auf. Ganz plötzlich verlieren erfahrene Sportler die Fähigkeit, ein bestimmtes automatisiertes Bewegungsmuster auszuführen, zum Beispiel eine Salto- oder Schraubendrehung. Diese Unfähigkeit hat emotionale, kognitive und andere schwerwiegende Folgen. Der Betroffene hat eine ausgeprägte Angst vor der Übungssequenz, auch Ärger, Frustration und Ohnmachtsgefühle kommen vor. Er kann sich im Geist nicht mehr vorstellen, wie man zum Beispiel einen bestimmten Sprung absolviert. Wenn er daran denkt, visualisiert er nur missglückte Sprünge. Beschrieben wird auch das Gefühl, dass jemand anderes als man selbst die Kontrolle über den Sprung hat. Zudem haben die Betroffenen kein Gefühl mehr für die Lage des eigenen Körpers im Raum. Negative Gedanken kreisen im Kopf und können zu Schlafstörungen führen. Der erlebte Vertrauensverlust in sich selbst kann ausgeprägte Selbstzweifel zur Folge haben. Viele betroffene Athleten müssen ihren Sport deswegen aufgeben.
All das kam mir so bekannt vor! Zum ersten Mal nach fast dreißig Jahren fand ich in diesem Artikel eine Beschreibung der Zustände, die ich selbst so schmerzlich und angstvoll beim Wasserspringen erlebt hatte. Das kannten also auch andere. Und es gab sogar eine Bezeichnung dafür!
Als ich siebzehn Jahre alt war, bekam unsere Springergruppe für mehrere Wochen Besuch von Springern aus den USA. Mit diesen zusammen fuhren wir zu einem Lehrgang nach Italien. Trotz meiner Ängste, meiner Schwierigkeiten bezüglich der Orientierung im Raum und meiner wiederkehrenden Depersonalisationserlebnisse trainierte ich – mal besser mal schlechter – weiter meine Sprünge.
Wir sprangen im Freibad von Villafranca in Lunigiana in der Toskana, besichtigten aber auch den schiefen Turm von Pisa und die Marmorsteinbrüche von Carrara. In dieser Zeit in Italien war ich teilweise sehr aufgekratzt und gab mich kontaktfreudig und extravertiert. Aus meiner heutigen Sicht befand ich mich damals sehr in meinem »falschen Selbst« – ein Ausdruck, den Alice Miller in ihrem Buch »Das Drama des begabten Kindes« beschreibt. Für mich bedeutete das: Meine Mutter hatte mir immer gesagt, dass es wichtig sei, dass man lustig und fröhlich sei und die anderen Menschen durch interessante Erzählungen mitreißen und dadurch Interesse für sich wecken müsse. Das tat ich nun in Italien. Kurz danach fuhr ich mit meinen Eltern und meiner Schwester für drei Wochen nach Österreich zum Wandern. Während des Urlaubs gab es regelmäßig Streit in der Familie. Ich war gereizt und dachte häufig ängstlich an meine Sprünge beim Training. Im Freibad unseres Urlaubsorts übte ich gelegentlich Salto vorwärts vom Beckenrand. Ich hatte Angst, dass ich das Gefühl für das Springen noch mehr verlieren würde, als es ohnehin schon der Fall war, wenn ich jetzt nicht dranblieb mit Üben. Meine Unbeschwertheit war komplett verschwunden. Während ich den Kreta-Urlaub im Jahr zuvor noch sehr genossen hatte, ging es mir inzwischen psychisch deutlich schlechter.