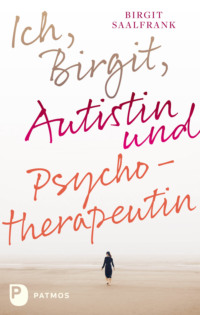Kitabı oku: «Ich, Birgit, Autistin und Psychotherapeutin», sayfa 4
An einem Tag ging ich alleine auf einen Flohmarkt und fand dort zufällig ein Buch über Schizophrenie. Ich hatte Angst, es zu kaufen, fürchtete, dass mich jemand dabei entdecken könnte, den ich kannte. Schließlich kaufte ich es trotzdem. Tief in meinem Inneren war ich überzeugt, dass ich psychisch sehr krank war, aber meine Umwelt erfolgreich darüber hinwegtäuschte. Dieses Buch habe ich jedoch nie gelesen. Da ich keine Erklärungen für meine Entfremdungsgefühle hatte, befürchtete ich, an Schizophrenie zu leiden. Ich hatte solche Angst davor, mich in den Schilderungen des Buches wiederzuerkennen und meinen Verdacht bestätigt zu sehen!
In der Schule hatte ich schon lange das Gefühl, jeden Tag auf extrem anstrengende Art und Weise neu beginnen zu müssen, ohne auf meine bisherigen sozialen Fähigkeiten zurückgreifen zu können. Wenn ich in der ersten Stunde im Unterricht saß, fühlte es sich so an, als ob es eine unsichtbare Mauer zwischen mir auf der einen Seite und den anderen Schülern und dem Lehrer auf der anderen Seite gäbe. Meine Sprache war in meinem Körper gefangen, ich konnte sie nicht herauslassen, denn sie wäre an dieser Mauer nach innen auf mich zurückgeworfen worden, ohne dass die anderen Menschen meine Worte hätten hören können. Trotzdem zwang ich mich täglich zum Sprechen im Unterricht, da ich auch mündlich die Noten haben wollte, die meinem schulischen Leistungsstand entsprachen. Die ersten Worte, die ich mich dann jeden neuen Tag im Unterricht sagen hörte, fühlten sich immer völlig selbstentfremdet an. Ich hörte mich selbst wie von außen, hatte dabei nicht das Gefühl, dass die Worte aus meinem eigenen Körper kamen. Mithilfe dieser ersten Sätze, die ich unter jeweils großer Kraftanstrengung aus mir herausbrachte, gelang es mir jedoch, die unsichtbare Mauer immer wieder zu durchbrechen. In den folgenden Stunden konnte ich mich im Unterricht mündlich beteiligen und war zuweilen sogar recht redselig – bis zum nächsten Tag, da ging alles wieder von vorne los.
Der siebzehnte Geburtstag war der schlimmste überhaupt. Ich wusste nicht, wen ich einladen sollte, denn innerhalb der Springergruppe feierte man nicht zusammen Geburtstag. Gleichzeitig dachte ich, dass ich das endlich einmal tun sollte, und lud deshalb meine ganze Klasse zu mir ein. Es kam aber nur ein Junge. Ich schämte mich entsetzlich und versuchte gleichzeitig, mir das nicht anmerken zu lassen – zeig niemals, dass du verletzlich bist!
Ich erinnere mich auch, dass ich in meiner Jugendzeit darauf hoffte, bald mein eigenes Leben zu beginnen, um dann endlich eine Psychotherapie machen zu können. Während ich noch zu Hause wohnte, kam das für mich nicht infrage, denn dann hätte ich vor meinen Eltern zugeben müssen, dass es mir nicht gut ging, und ihr Bild ihrer kompetenten Tochter wäre zusammengebrochen.
In unserer Familie herrschte vor allem bezogen auf die Bewertung durch meine Mutter eine Art Rollenverteilung. Ich war in ihren Augen diejenige, bei der alles glattlief, die mit dem Leben und der Schule bestens und ohne jegliche Hilfestellung zurechtkam. Meine Schwester wurde von meiner Mutter konstant als »Problemkind« betrachtet, was ich nicht nachvollziehen konnte. Oftmals wehrte ich mich gegen diese Zuschreibungen, aber es hatte keinen Zweck. Ich blieb festgelegt auf diese hochfunktionale Rolle, in der ich mich nicht wiederfand und nicht in meiner wahren Persönlichkeit gesehen fühlte. Ich wusste, dass ich Hilfe benötigte, aber ich kam nicht auf die Idee, sie in der Gegenwart zu suchen, d. h. mir aktuell ein professionelles Gegenüber zum Reden zu suchen. Ich wagte auch nicht, mit anderen über diese bedrohlichen Themen zu sprechen. Sie mussten mich für völlig verrückt halten, wenn sie davon erfahren würden. Ich hatte Angst vor der Psychiatrie und davor, einem professionellen Helfer gegenüberzusitzen, der dann sehen würde, wie extrem krank ich wirklich war, und der mich dann vielleicht in die Psychiatrie einweisen würde. Zudem dachte ich: Wenn ich erzähle, wie es mir wirklich geht, werde ich völlig verrückt. Indem ich diese bedrohlichen Gefühle und Gedanken für mich behielt, hatte ich sie einigermaßen unter Kontrolle. Solange ich sie nicht aussprach oder aufschrieb, existierten sie nicht.
Dann gab es da noch dieses Problem mit dem Essen. Angefangen hatte es beim Springlehrgang in Italien und im darauffolgenden Urlaub mit meinen Eltern. Ein Faktor bei der Entstehung meiner Essstörungen war vermutlich das regelmäßige Wiegen beim Training und entsprechendes Lob beziehungsweise entsprechende Kritik durch unseren Trainer. Ich fing an, mein Essen zu kontrollieren, es mit dem Kopf zu steuern. Wenig zu essen und gesunde Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, war gut. Viel und Ungesundes zu essen, war schlecht. Wenn mein Vater als Nachtisch nach dem Mittagessen einen Fruchtquark zubereitet hatte, fragte ich ihn immer, ob er Zucker hineingetan hatte. War nur ein Hauch Zucker darin, verweigerte ich den Nachtisch. Mein Ziel war nicht unbedingt, viele Kilos abzunehmen, sondern nur ein bisschen. Ich wollte durchaus meinen athletischen Körper behalten, wie er war. Gleichzeitig beschäftigte ich mich, angeregt von meiner Mutter, mit gesunder Ernährung und der Schädlichkeit von Zucker. Meine Gedanken kreisten derartig zwanghaft um meine Nahrungsaufnahme, dass ich an manchen Tagen in der Schule Mühe hatte, dem Unterrichtsstoff zu folgen. Ständig überlegte ich, was ich wann essen würde und wie viel ich heute schon gegessen hatte. Ich war völlig fixiert auf dieses Thema. Dabei wollte ich meinem Körper nicht schaden, es war nicht so, dass ich ihn gehasst hätte. Außer wenn ich zu viel gegessen hatte – eine Folge meiner manchmal zu geringen und rationierten Nahrungsaufnahme. Es konnte schon vorkommen, dass ich bei einem Fressanfall doppelt oder dreimal so viel aß, wie mir guttat, und mich danach extrem schlecht, dick und unbeherrscht fühlte. Das passierte regelmäßig am Abend nach dem Training sowie am Wochenende, wenn ich nach einem Wettkampf oder Lehrgang nach Hause kam und nichts vorhatte. Ich reagierte auf solche Essattacken mit Selbstabwertung und extremer Enttäuschung über mich selbst sowie mit dem Versuch, erst wieder Essen zu mir zu nehmen, wenn mir der Magen knurrte. Glücklicherweise habe ich mir niemals nach dem Essen den Finger in den Hals gesteckt und mich wieder erbrochen und auch nie zu Abführmitteln gegriffen.
In meinem Tagebuch analysierte ich, siebzehnjährig, meine Essattacken. Ich fand heraus, dass sie immer dann auftraten, wenn ich negativ gestimmt war. Entsprechend war meine Schlussfolgerung, dass ich darauf achten müsste, immer positiv gestimmt zu sein. Gemäß der Sichtweise meiner Mutter, die ich schon längst übernommen hatte, handelte es sich bei der eigenen Stimmung ja um etwas, was man willentlich beeinflussen konnte. Es war eine Frage des Wollens, ob man gut oder schlecht gelaunt war! Damit meine Stimmung positiv und ich voller Selbstvertrauen wäre, müsste ich einfach dauerhaft ein positives Bild von mir haben und positiv von mir selbst denken. Nur wenn ich über ein positives Selbstbild verfügte, konnte ich kontrolliert essen, also musste ich zuerst dieses positive Selbstbild entwickeln. Aber wie konnte ich das schaffen?
In einer Buchhandlung fand ich ein esoterisches Buch über kreatives Visualisieren und das »Höhere Selbst«, das in jedem Menschen verborgen ist und zu dem man nur Zugang finden muss. Ich las und schrieb Sätze auf wie zum Beispiel: »Das Gute ist in mir. Ich bin voller positiver Kraft und Energie, Ruhe und Gelassenheit.« Oder: »Das Licht meines Höheren Selbst strahlt jetzt in mir.« Ich versuchte, mir diese Sätze bildlich vorzustellen und an sie zu glauben. Im Grunde ging es bei diesen Affirmationen um die Macht des Positiven Denkens, der ich damals folgen wollte. Heute sehe ich das sehr kritisch. Damals kaufte ich mir jedoch eine Kassette mit dem Titel: »Ich kann, was ich will«. Über mehrere Wochen hörte ich sie mir täglich an. Danach glaubte ich tatsächlich fest daran – und das über die nächsten zwei Jahrzehnte –, dass ich alles können würde, wenn ich es nur fest genug wollte. Ein fataler Trugschluss, wie sich aber erst nach vielen Jahren herausstellte.
Einmal hörte ich diese Kassette zusammen mit meiner Mutter an. Dazu legten wir uns auf Decken auf den Boden, und ich sagte ihr, sie solle sich ganz auf den Text einlassen. Nach dem Hören fragte ich sie, wie sie es empfunden habe. Leider konnte sie damit überhaupt nichts anfangen. Sie sprach aber auch nicht weiter mit mir darüber, fragte mich nicht, warum ich mich mit derartigen Sachen beschäftigte. Also machte ich fortan alleine weiter. Mit anderen Menschen sprach ich niemals über meine Versuche, mittels Suggestionen mein Selbstvertrauen zu steigern. Ich kam gar nicht auf die Idee, dass ich das hätte tun können.
Auch das Autogene Training, ein anerkanntes Entspannungsverfahren, arbeitet mit der Macht von körperbezogenen Vorstellungen. Man sagt sich zum Beispiel: »Meine Arme und Beine sind strömend warm«, auch wenn das gerade gar nicht der Fall ist. Tatsächlich werden die Arme und Beine durch diese Vorstellungsübung auch wirklich warm, wenn man in dieser Technik geübt ist.
Ich glaubte an die Macht dieser Vorstellungsübungen und belegte zu Beginn meines dreizehnten Schuljahrs einen Kurs in Autogenem Training an der Volkshochschule. Ich wollte mich mit dieser Methode auf den Prüfungsstress des Abiturs vorbereiten. Ich war die Jüngste in dieser Gruppe und schrieb Martina in einem Brief, dass die anderen Leute ja »wirkliche Probleme« hätten, anders als ich. Offensichtlich hatte ich meine Schwierigkeiten mit dem Essen und meine Angst vor dem Springen dabei völlig ausgeblendet, weil ich auch mit niemandem darüber sprach. Wenn meine Gedanken einmal nicht ums Essen kreisten, waren sie auf die Sprünge fixiert, vor denen ich Angst hatte.
Kurz vor meinem achtzehnten Geburtstag passierte es, dass ich bei einem neuen Sprung gestreckt mit dem Rücken auf die Wasseroberfläche knallte. Ein Gefühl wie ein Elektroschock ging durch meinen Körper, irgendwie mussten meine Nerven verrückt gespielt haben, und es tat sehr weh. Kurz nachdem ich aus dem Wasser geklettert war, zitterten meine Beine und konnten mich kaum mehr tragen. Ich schwamm noch ein paar Bahnen im Becken, übte ein paar einfache Sprünge und beendete dann das Training für diesen Tag. Bei einem Wettkampf wenige Tage später verweigerte ich diesen Sprung, ich traute mich einfach nicht. Umso erstaunter war ich, in meinem damaligen Tagebuch zu lesen, dass ich auch nach diesem Unfall eigentlich gar keine so große Angst vor dem Sprung hatte. Ich müsse nur einfach volle Pulle abspringen. Ich glaube, ich habe damals nach dem Motto gehandelt: Was ich nicht aufschreibe, existiert nicht. Wenn ich nicht von meiner großen Angst vor diesem Sprung schreibe, habe ich auch keine.
Einmal war ich mit meiner Familie bei einer eigentlich sehr schönen Ballettaufführung von »Schwanensee« – ich bekam nur leider kaum etwas davon mit, weil meine Aufmerksamkeit nach innen auf meine Angstvorstellungen gerichtet war. Es gelang mir nicht, sie nach außen zu richten. Damit habe ich bei Theatervorstellungen oder Konzerten noch heute oft Probleme. An diesem Tag jedoch hatte ich wie so oft große Angst vor dem nächsten Training und versuchte diese mittels gedanklicher Vorübungen in Schach zu halten, anstatt mit jemandem über meine Ängste zu sprechen. In dieser Zeit kam meine Mutter zu mir und erzählte, Heiko hätte sie gefragt, ob es mir nicht gut gehen würde, ich würde in der letzten Zeit nicht gut aussehen. Sie habe ihm daraufhin sofort geantwortet, mit mir sei nichts, es gehe mir gut. Das ist schon seltsam: Mein Trainer sah mir an, dass ich litt, und er hatte recht – während meine Mutter, die kaum etwas von meinem Befinden wusste, trotzdem einfach behauptete, es gehe mir gut. Ich klärte sie nicht auf, denn sie hatte mich nicht nach meinem Befinden gefragt, sondern mir nur von dieser Begebenheit berichtet.
Zu Hause litt ich sehr unter der angespannten Atmosphäre in unserer Familie. Ich erlebte sie als zerpflückt und zerstritten. Meine Mutter lud seit Jahren ihre Sorgen und Eheprobleme bei mir ab. Sie schätzte meine Fähigkeit, ihr zuzuhören und gut zuzureden. Nur für mich und meine Probleme war niemand da. Ich machte alles mit mir alleine aus, weil ich den Eindruck hatte, meine Mutter benötigte die Gewissheit, dass wenigstens ich mit allen Anforderungen zurechtkam. Ich war gut in der Schule, war im Leistungssport eingebunden und gab außerdem Nachhilfe. Meine Mutter bewunderte mich als Kind und Jugendliche immer sehr, da ich in ihren Augen sehr patent war und ihr sogar Tipps gab, wie sie sich verhalten solle. Diese Bewunderung war mir immer unangenehm, da ich sie nicht als zutreffend empfand und mich von ihr darin überhaupt nicht gesehen fühlte.
Von meinen Ängsten und psychischen Problemen ahnte meine Mutter nichts. Das lag sicher zum Teil daran, dass ich sie ihr gegenüber nicht offen zeigte. Aber wie sollte ich das auch? Schließlich traute ich mich nicht, sie noch zusätzlich mit meinen Problemen zu belasten. Auf meinen Vater reagierte ich damals vor allem mit heftiger Wut und Abwertung seiner Person, übernahm dabei die Perspektive meiner Mutter, die seit Jahren sehr schlecht auf ihn zu sprechen war. Denn wegen ihm und seiner Berufsperspektive waren wir vor einigen Jahren nach Norddeutschland gezogen, wohin meine Mutter ihren Angaben zufolge nie hatte ziehen wollen. Leider hatten sich die beruflichen Möglichkeiten meines Vaters schnell zerschlagen, während meine Mutter inzwischen mit einer sehr ungeliebten Sekretariatstätigkeit für die Familie das Geld verdiente.
Anders als in den Fachartikeln zu LMS beschrieben, war es bei mir nicht so, dass ich gar nicht mehr springen konnte. Mit großem Kraftaufwand und vielen Autosuggestionen schaffte ich es mit der Zeit, meine Ängste vor dem Springen einigermaßen unter Kontrolle zu halten, zumindest so weit, dass ich weiter springen konnte. Denn trotz meiner Ängste bedeutete mir das weiterhin sehr viel.
Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im März 1989 in Köln stand ich vor dem ersten Sprung auf dem Sieben-Meter-Turm. Eine Stimme ertönte durchs Mikrofon: Einer der Kampfrichter gratulierte mir zum achtzehnten Geburtstag. Ich verbrachte ihn bei einem Wettkampf, das war eigentlich sehr passend für mein damaliges Leben. Vor den Deutschen Jugendmeisterschaften im folgenden Sommer in Lüdenscheid war ich springtechnisch sogar in einer sehr guten Form. Beim letzten Sprung meines ersten Wettkampfes kugelte ich mir jedoch wieder das linke Schultergelenk aus. Bei den Wettkämpfen der anderen Springer schaute ich in den folgenden Tagen zu, springen konnte ich selbst leider nicht mehr. Ich war demoralisiert: Jetzt war mir das schon zum zweiten Mal passiert! Je häufiger eine Luxation vorkommt, desto leichter passiert dasselbe wieder, auch ohne größere Gewalteinwirkung. Heiko redete mir gut zu und sagte: »Das wird schon wieder!« Ich erfuhr, dass man sich auch operieren lassen und danach wieder springen könne.
Kurz danach traten zwei unserer Trainer mit sechs von uns Springern eine lang geplante Reise in die USA an, es war der Rückbesuch der Springer, die uns ein Jahr zuvor in Deutschland besucht hatten. Innerhalb von vier Wochen wohnten wir jeweils bei drei verschiedenen Gastfamilien in Pennsylvania und Virginia. Wir trainierten dort regelmäßig, lernten aber auch verschiedene touristische Attraktionen kennen und verbrachten gemeinsame Zeit mit unseren Gasteltern beim Barbecue. Natürlich konnte ich mit meiner Schulterverletzung nicht richtig mitmachen. Ich übte einfache Sprünge, bei denen man nicht kopfwärts tauchen musste, oder machte Krafttraining. Diese Reise in die USA war rundum gelungen und ein tolles Erlebnis! Essstörungen hatte ich aber auch in dieser Zeit.
Pläne
Zurück in Deutschland begann mein letztes, dreizehntes Schuljahr. Ich überlegte, was ich nach dem Abitur tun wollte. Viele meiner Mitschüler hatten schon einen Plan für die Zeit danach, anders als ich. Also fing ich an, mich zu informieren, was für mich infrage kommen könnte. Es war völlig klar, dass ich studieren würde (meine Mutter und mein Vater und viele andere Verwandte hatten auch alle studiert) – die Frage war nur: Welches Studienfach? Mit meinen Eltern sprach ich inhaltlich (leider) nicht über diese Fragen, sie aber auch nicht mit mir. Sie schienen die Einstellung zu haben, dass die Studienwahl allein meine Angelegenheit sei – was ich damals ähnlich sah. Ich nahm jedoch das Angebot meines Vaters an, zwei Bücher zum Thema Studienwahl zu bestellen. Außerdem informierte ich mich beim Berufsinformationszentrum in Hannover und ging auch zu einem Berufsberatungsgespräch beim Arbeitsamt. Ich stellte fest, dass ich gerne etwas Naturwissenschaftliches studieren wollte. Infrage kamen Medizin, alternativ der damals recht neue Studiengang Haushalts- und Ernährungswissenschaften (Ökotrophologie) sowie Lebensmittelchemie. Ich hatte Chemie als Leistungsfach in der Oberstufe, also waren insbesondere die letzten beiden Studiengänge recht naheliegend. Lebensmittelchemie schied aber aus, als ich erfuhr, dass dafür ein Numerus Clausus von 1,3 galt. Das würde ich nicht schaffen. Eine Zeitlang war ich überzeugt, dass Medizin für mich die richtige Wahl wäre, bis ich eine Liste mit Stichpunkten dazu schrieb, die meines Erachtens gegen ein Medizinstudium sprachen:
Ich habe Angst, dass ich als Ärztin von morgens bis abends nichts anderes mehr tun werde, als zu arbeiten. Ich möchte neben meiner Arbeit auch noch genug Zeit für mich selbst haben.
Meine Motivation zum Medizinstudium ist nicht in erster Linie, dass ich als Ärztin arbeiten möchte, sondern vor allem mein Interesse an den verschiedenen naturwissenschaftlichen Fächern, die theoretisch den Menschen betreffen. Ich möchte nicht so gerne praktisch am Menschen arbeiten.
Ich möchte nicht ständig in der Nacht arbeiten müssen und nicht ständig auf Abruf alles stehen und liegen lassen, um zu arbeiten.
Ich möchte auf alle Fälle die Möglichkeit haben, mein Berufsleben von meinem Privatleben zu trennen, und das ist als Ärztin wahrscheinlich schwierig. Die Ärzte im Krankenhaus leben fast nur noch dort und haben kaum mehr Zeit für ihre Familie.
Ich möchte an der Möglichkeit arbeiten, wie jeder Mensch sich am besten gesund erhalten kann, und nicht daran, wie die Krankheiten des Menschen am besten kuriert werden können.
Große Verantwortung für Menschenleben.
Es würde mir schwerfallen, mich zu Hause oder abends nicht mehr mit bestimmten Patienten und deren Problemen zu befassen. Ich könnte wohl nicht abschalten und hätte Stress.
Aufgrund der diversen Punkte, die gegen ein Medizinstudium sprachen, nahm ich dann doch den Rat meines Chemielehrers an und entschied mich für Ökotrophologie. Warum hatte er mir eigentlich nicht zu einem reinen Chemiestudium geraten? Ich war doch gut in Chemie! Traute er Frauen das nicht zu?
Gegen ein Chemiestudium sprach für mich persönlich damals allerdings auch die Überlegung, dass man als Chemikerin im Labor viel Zeit stehend verbringen müsste. Ich konnte noch nie lange stehen, das strengte mich sehr an, auch schon als Kind. Interessant in Bezug auf die Liste, die gegen ein Medizinstudium sprach, ist, dass ich dann später zwar nicht Medizin studiert habe, aber Psychologie – allerdings ohne das vorher so gründlich zu reflektieren wie meine Entscheidung gegen das Medizinstudium. Und interessant ist auch, dass ich später tatsächlich an der gefühlt (oder tatsächlich?) großen Verantwortung gescheitert bin, die man als Psychotherapeutin für seine Patienten hat. In all meinen Berufsjahren habe ich nicht lernen können, wie man abends nach der Arbeit abschaltet.
Parallel zu diesen Zukunftsüberlegungen beschäftigte ich mich in der Zeit vor dem Abitur damit, wie es für mich mit dem Springen weitergehen sollte. Seit mehr als einem Jahr litt ich nun diesbezüglich unter Ängsten und Schlafstörungen. Nicht zu vergessen die Essstörungen und das Selbstentfremdungserleben. Ich fragte mich zusehends häufiger, warum ich eigentlich noch zum Training ging, da ich mir sicher war, nach dem Abitur ohnehin damit aufhören zu wollen. Ich ging davon aus, dass ich ein Studium in einer anderen Stadt aufnehmen und damit verbunden von zu Hause ausziehen würde. Wenn ich ohnehin bald aufhörte zu trainieren, könnte ich das auch sofort tun! Neben meinen psychischen Symptomen gab es außerdem noch die Schulterverletzung – rückblickend ein deutliches körperliches Signal dafür, dass ich mit dem Wasserspringen endlich aufhören sollte. Ich tat mir dennoch sehr schwer mit dem Abschied von meinem früher so geliebten Sport. Meine Trauer um das Springen erlebte ich wie eine Art Liebeskummer. Mir lag auch viel an den Leuten, sowohl an meinen Trainern als auch meinen Springkameraden. Schweren Herzens, aber auch erleichtert, dass ich nun keine Angst mehr haben musste vor schwierigen Sprüngen, vor meinen Selbstentfremdungserlebnissen und vor der Waage, gelang es mir dann doch noch vor dem Abitur, mit dem Kunst- und Turmspringen aufzuhören.
Später besuchte ich Susanne, meine Springerkameradin, einige Male in Köln. Sie fand, dass ich weiblicher werden müsse, und lieh mir deshalb einen Rock, eine dünne Strumpfhose und Schuhe mit Absätzen für einen Abend im Kabarett aus. Ich war sehr unsicher, wie ich meine Weiblichkeit ausdrücken sollte, also nahm ich ihren Ratschlag an. Später stöckelte ich dann allein zum verabredeten Treffpunkt, aber ich fühlte mich sehr unwohl in den schicken Sachen. Nie mehr wieder habe ich mich so aufgestylt.
Auf die schriftlichen Abiturprüfungen in Chemie, Englisch und Philosophie bereitete ich mich systematisch vor. Inzwischen kannte ich mich auch mit dem Thema Lernstrategien aus. Ich hatte einen sehr interessanten Artikel in einer Zeitschrift darüber gefunden und setzte die dort gewonnenen Erkenntnisse gleich um. Meine Nervosität bei den Prüfungen hielt sich glücklicherweise in Grenzen – schließlich war ich durch meine häufigen Sportwettkämpfe an Prüfungssituationen gewöhnt – aber ich konnte hier auch zusätzlich auf das Autogene Training zurückgreifen, das ich erlernt hatte.
Die Osterferien nutzte ich, um das Schreibmaschineschreiben mit dem 10-Finger-System zu erlernen. Das gehörte für mich zu den Grundkenntnissen, die jeder beherrschen sollte. Das lag wohl daran, dass ich erlebt hatte, wie meine Mutter abends nach der Arbeit regelmäßig die berufsbezogenen handschriftlichen Notizen meines Vaters für ihn abtippte. Dann noch die letzte mündliche Abiturprüfung in Biologie – und fertig war ich mit der Schule.
Angeregt durch eine Jahrgangskameradin kam ich auf die Idee, nach dem Abitur für drei Monate in einem Sommercamp für behinderte Kinder und Jugendliche in den USA als Betreuerin zu arbeiten. Warum habe ich mich für diese Tätigkeit interessiert? Zum einen wollte ich meine Angst vor behinderten Menschen überwinden, die ich damals spürte. In Oberursel hatte es einen alten Mann gegeben, von dem meine Eltern sagten, er sei verrückt. Immer, wenn er mich sah, winkte er mir und rief: »Huhu!« Ich hatte Angst vor diesem Mann und vor behinderten Menschen überhaupt. Außerdem wollte ich weg von zu Hause, da ich die Spannungen in meiner Familie nicht mehr aushielt. Zudem war ich begierig nach neuen Eindrücken und wollte mich in ein völlig neues Erlebnisfeld hineinbegeben. Die USA erschienen mir besonders reizvoll, da ich den Eindruck hatte, die Menschen dort seien sehr kontaktfreudig, extravertiert und positiv gestimmt. Ich dachte: Wenn ich nur genug übe und entsprechende Vorbilder habe, wird es mir schon gelingen, meine Stimmung und Persönlichkeit in diese Richtung zu entwickeln.
Das Camp befand sich im Mittleren Westen der USA, in der Nähe von Indianapolis, Indiana. Es lag mitten in einem großen Waldgebiet, und das Klima war feucht-heiß. Wir wohnten mit fünf Betreuerinnen und etwa acht bis zehn Kindern in jeweils einer größeren Blockhütte. Die Kinder waren zum Teil sehr stark beeinträchtigt, litten beispielsweise unter Cerebraler Lähmung und konnten sich nur mit großer Mühe verständigen. Viele saßen im Rollstuhl und mussten beim Essen gefüttert werden.
Ich kam mit einer jungen Frau aus Holland zusammen im Camp an, nachdem dort schon die Einführungswoche für die Betreuer stattgefunden hatte. Wir wurden also ins kalte Wasser geworfen. Bei meinen Kolleginnen schaute ich mir ab, wie man mit den Kindern umgehen musste und welche Hilfe sie benötigten. Ich war dabei sehr nach außen orientiert, bemüht, ihr (Sozial-)Verhalten zu kopieren. Nach innen fühlte ich überhaupt nicht mehr, sondern wollte mich bewusst von der begeistert-überschwänglichen Atmosphäre im Camp beeinflussen lassen. Auch die Sing- und Rufspiele, die zum Campleben dazugehörten, machte ich mit – etwas, was mir eigentlich völlig widerstrebt.
Ich arbeitete sehr hart, gönnte mir kaum eine Pause. Wir hatten nur wenig Rückzugsmöglichkeiten und Zeit für uns, aber das suchte ich damals auch gar nicht. Ich wollte Ablenkung von mir selbst. Mir ging es um mein soziales Engagement und um die Veränderung meiner Persönlichkeit. Denn meine eigentliche, echte Persönlichkeit, die eher nachdenkliche und ernsthafte Züge hat, galt es zu »übermalen«. Obwohl ich einerseits den Lebensstil der Amerikaner schätzte und mich bemühte, ihn zu übernehmen, kritisierte ich andererseits deren Oberflächlichkeit. Das tat ich auch einmal sehr deutlich in einem Artikel, den ich für die Campzeitung geschrieben hatte. Die Campleiterin entschied jedoch, dass dieser Artikel nicht gedruckt wurde, was mich damals sehr verärgerte und mich in meiner Auffassung bestärkte, dass man in den USA nicht wirklich seine Meinung sagen darf. In meinem Zeugnis über die Tätigkeit als Betreuerin formulierte die Campleiterin unter anderem folgenden Text:
(...) Working in the United States, for many of our international staff is an adjustment. Cultural differences are at times difficult to comprehend and fully understand. Birgit has had to adjust to some of those differences. She voiced, however, those differences that she did not understand or with which she did not agree. She is very open in with what she believes and will stand firm in what she believes is right. She is a very strong willed individual (...)
Übersetzt bedeutet das Folgendes: In den USA zu arbeiten, bedeutet für viele unserer internationalen Teilnehmer, sich anpassen zu müssen. Kulturelle Unterschiede sind für die Betreffenden manchmal schwierig zu verstehen. Birgit musste sich an manche dieser Unterschiede anpassen. Sie machte jedoch deutlich auf die Unterschiede aufmerksam, die sie nicht verstand oder mit denen sie nicht einverstanden war. Sie ist sehr offen in ihrer Meinungsäußerung und tritt stark für das ein, was sie für richtig hält. Sie hat einen starken Willen.
Meiner heutigen Auffassung nach wurden meine sozialen Schwierigkeiten in den USA damit sehr freundlich umschrieben und darauf zurückgeführt, dass ich aus Deutschland kam, das heißt kulturellen Unterschieden zugeschrieben. Ich glaube jedoch, dass diese Ursachenzuschreibung meine eigentlichen, autistisch begründeten Schwierigkeiten verdeckte, die ich generell in sozialen Zusammenhängen hatte.
Im Anschluss an den Campaufenthalt reiste ich durch Amerika, ließ mich treiben von der belebenden Atmosphäre, auf die ich in den dortigen Jugendherbergen gestoßen war. Unkompliziert schloss man hier Bekanntschaften mit den jungen Reisenden aus der ganzen Welt und verbrachte die Tage miteinander oder fuhr gemeinsam zum nächsten Highlight an einem anderen Ort.
Zurück in Deutschland erfuhr ich, dass ich ab dem Herbst einen Studienplatz für Ökotrophologie in Gießen bekommen hatte. Ich packte meinen Rucksack und fuhr in meine ehemalige hessische Heimat, übernachtete dort in der Jugendherberge und machte mich auf Zimmersuche.