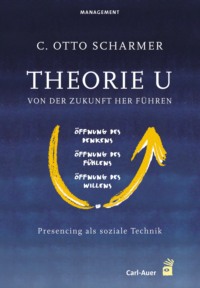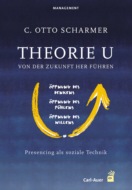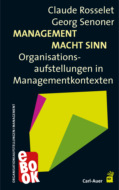Kitabı oku: «Theorie U - Von der Zukunft her führen», sayfa 9
Teil I: Begegnung mit dem blinden Fleck
Was sehen wir, wenn wir menschliche Handlung beobachten? Wir sehen Sprechen, Lachen, Weinen, Streiten, Spielen, Tanzen, Beten. Was wir nicht sehen, ist der Entstehungsort dieser Handlungen. Wo entstehen unsere Handlungen? Von welchem Ort, im Innern oder aus unserem Umkreis, rühren sie her? Um diese Frage zu beantworten, hilft es uns, die kreative Tätigkeit eines Künstlers genauer zu betrachten. Das lässt sich aus drei Blinkwinkeln heraus tun:
•Als Erstes können wir auf das Resultat der künstlerischen Arbeit schauen, das Ding, das fertige Bild etwa.
•Zweitens können wir beim Malen zuschauen: Wir können den farbigen Pinselstrichen folgen, die gerade im Begriff sind, das Kunstwerk zu erschaffen.
•Oder wir können, drittens, beobachten, wie der Künstler vor der leeren Leinwand steht. Es ist diese dritte Perspektive, die die Leitfrage dieses Buches ist: Was passiert vor der leeren Leinwand? Was veranlasst den Künstler zum ersten Pinselstrich?
Dieses Buch hier ist für Menschen mit Führungsaufgaben geschrieben, also für Leserinnen und Leser, die mit Individuen oder Gruppen Innovationen oder Veränderungsprozesse initiieren, mithin in diesem Sinne künstlerisch tätig sind. Alle Führungspersonen und Innovatoren, sei es in Unternehmen, lokalen Projekten, gemeinnützigen Organisationen oder im Staatsdienst, tun etwas, was Künstler auch tun: Sie schaffen etwas Neues und bringen es in die Welt. Die offene Frage aber lautet: Woher kommen ihre Handlungen? Wir können beobachten, was Führungspersonen machen. Wir können auch beobachten, wie sie es tun, welche Strategien und Prozesse sie anwenden. Was wir nicht sehen, ist der innere Ort, die Quelle, aus der heraus sie handeln, wenn sie – zum Beispiel – auf höchstmöglichem Niveau agieren oder umgekehrt ohne Einsatz und Engagement handeln.
Das führt uns zum »blinden Fleck«. Dieser blinde Fleck betrifft einen Aspekt unseres Sehens oder Wahrnehmens, den wir normalerweise nicht genauer betrachten. Es ist der innere Ort oder die innere Quelle, aus der heraus der Einzelne oder ein soziales System handelt. Dieser blinde Fleck ist tagtäglich in allen Systemen gegenwärtig, aber er ist verdeckt, und seine Wahrnehmung und unser Umgang mit diesem blinden Fleck sind wesentlich für Veränderungs- und Innovationsprozesse.
Francisco J. Varela, verstorbener Professor für kognitive Wissenschaft und Epistemologie in Paris, sagte mir, der blinde Fleck der heutigen Wissenschaft sei Erfahrung. Dieser blinde Fleck tritt in vielfältiger Weise auf, was ein zentrales Thema unseres weiteren »Feldgangs« und unserer »gemeinsamen Lernreise« sein wird.
Die folgenden sieben Kapitel beschreiben sieben Sichtweisen in Bezug auf die verschiedenen Ausgestaltungen dieses blinden Flecks und erkunden, wie er als Merkmal unserer Zeit in Gesellschaft, Wissenschaft und im systemischen Denken sichtbar wird. Blinde Flecke treten bei Individuen, Gruppen, Institutionen, Gesellschaften und Systemen auf. In unseren Theorien und Vorstellungen treten sie in der Form tiefer epistemologischer und ontologischer Grundannahmen in Erscheinung.
Ich lade Sie ein, gemeinsam mit mir verschiedene Bereiche dieses blinden Flecks zu erforschen. Wir beginnen mit der Perspektive des Selbst, dann der des Teams (Kapitel 3), der Organisation (Kapitel 4), der Gesellschaft (Kapitel 5) und abschließend in den Sozialwissenschaften und zuletzt der Philosophie (Kapitel 6).
1Im Angesicht des Feuers
Als ich an diesem Morgen unseren Hof verließ, einen 350 Jahre alten Bauernhof 40 Kilometer nördlich von Hamburg, ahnte ich nicht, dass dies das letzte Mal ist, dass ich das Haus meiner Kindheit sehe. Zunächst war es ein ganz normaler Schultag bis etwa gegen 13 Uhr, als meine Lehrerin mich aus der Klasse holte. »Du solltest jetzt nach Hause gehen, Otto.« Ich bemerkte, dass ihre Augen etwas rot waren. Sie sagte mir nicht, warum ich schnell nach Hause gehen musste. Am Bahnhof angekommen, versuchte ich zu Hause anzurufen. Es war kein Klingelton zu hören. Die Leitung war offensichtlich tot. Ich hatte keine Ahnung, was los war. Mir wurde dann allerdings klar, dass es wahrscheinlich nichts Gutes verhieß. Nach der üblichen einstündigen Bahnfahrt nach Hause rannte ich zum Bahnhofsausgang und sprang in ein Taxi. Irgendwas sagte mir, dass ich keine Zeit hatte, auf meinen Bus zu warten. Noch lange bevor wir den Hof erreicht hatten, bemerkte ich, wie sich riesige graue und schwarze Rauchwolken hoch in die Luft türmten. Mein Herz pochte, als das Taxi sich der Hofeinfahrt näherte. Ich sah Hunderte unserer Nachbarn, daneben Feuerwehrleute aus der Umgebung und Polizisten sowie viele Menschen, die ich bis dato nie gesehen hatte. Ich sprang aus dem Taxi und rannte die letzten 800 Meter unsere Kastanienallee hinunter durch die Menge hindurch.
Als ich im Innenhof ankam, traute ich meinen Augen nicht. Die Welt, in der ich mein ganzes Leben bisher verbracht hatte, existierte nicht mehr. Verschwunden. Komplett in Rauch aufgegangen.
Vom Haus war nichts – gar nichts – mehr übrig, außer den tobenden Flammen. Als die Realität des Feuers vor meinen Augen langsam begann, in mich einzusinken, fühlte ich mich so, als hätte mir jemand mit einem Mal den Boden unter meinen Füßen weggerissen. Der Ort meiner Geburt, meiner Kindheit und Jugend war weg. Ich stand regungslos da. Und während mein Blick immer tiefer in die Flammen drang, merkte ich, dass die Zeit sich verlangsamte. Mir war, als ob sie stillzustehen begann. Mir wurde schlagartig klar, wie sehr ich mich, ohne es vorher zu bemerken, über die ganze materielle Welt definiert hatte, die jetzt vor meinen Augen in Flammen stand. Alles, von dem ich dachte, dass ich es war, hatte sich schlagartig in nichts aufgelöst. Alles? Nein, vielleicht nicht alles, denn ich fühlte, dass ein winziges Element von mir noch existierte. Jemand war noch da, der dies jetzt alles beobachtete. Wer?
In diesem Moment, als die Zeit stillzustehen schien, fühlte ich, wie ich nach oben gezogen wurde und anfing, das Geschehen von diesem Ort etwas oberhalb meines Körpers zu erspüren. Ich fühlte mich angezogen von einem intensiven Möglichkeitsraum, von einem zukünftigen Potenzial, das ich durch mein Leben in die Realität bringen könnte. In diesem Moment der Stille erlebte ich eine mir bis zu diesem Zeitpunkt vollkommen unbekannte Klarheit und gesteigerte Anwesenheit meiner Aufmerksamkeit, meines Selbst. Mir wurde klar, dass das alte Selbst, dessen Identität mit dem materiellen Besitz aus der Vergangenheit in Flammen aufgegangen war, nicht mein wirkliches Selbst war. Mein wirkliches Selbst war plötzlich viel erlebbarer und gegenwärtiger als je zuvor. Ich fühlte mich nicht mehr beschwert von den materiellen Besitztümern, die das Feuer gerade verzehrt hatte. Ohne sie war ich viel leichter und offen dafür, dem anderen Teil meines Selbst zu begegnen, dem Teil, der mich in die Zukunft zog, in eine Zukunft, die mich erwartete, die mich brauchte, damit sie durch mich in die Welt kommen konnte.
Am nächsten Tag kam mein 87-jähriger Großvater zu einem letzten Besuch auf den Hof. Er hatte in diesem Haus sein ganzes Leben gelebt, seit 1890. Aufgrund von medizinischen Behandlungen war er eine Woche vor dem Feuer außer Haus gewesen, und als er einen Tag nach dem Feuer auf dem Hof ankam, raffte er all seine Kräfte zusammen, stieg aus dem Auto und ging schnurstracks auf meinen Vater zu, der mit Aufräumarbeiten beschäftigt war. Er ging zu meinem Vater, nahm seine Hand und sagte: »Kopf hoch, mein Junge, blick nach vorn!« Sie wechselten noch einige Worte. Dann drehte er sich um, ging zum wartenden Auto zurück und wurde zurückgefahren. Wenige Tage später verstarb er sanft.
Erst Jahre später wurde mir bewusst, dass meine Erfahrung angesichts des Feuers der Anfang eines Weges war. Meines Weges. Dieser Weg fing an mit der Erkenntnis, dass ich nicht nur ein Selbst besitze, sondern zwei: Das eine Selbst reflektiert unseren vergangenen Weg; das andere, unser werdendes Selbst, erleben wir als ein Sich-hinein-Lehnen in unseren zukünftigen Weg, in einen Möglichkeitsraum, der auf uns wartet, um in die Welt zu kommen. Was an jenem Tag angesichts des Feuers geschah, lässt sich vielleicht so verstehen, dass diese zwei Formen des Selbst anfingen, sich gegenseitig wahrzunehmen. Heute, vierzig Jahre später und viele Tausende Kilometer entfernt, in Boston, Massachusetts (USA), scheinen zwei Fragen aktueller denn je: »Wer ist mein wirkliches Selbst?« und: »Wie verhält es sich zum anderen Zeitstrom, der mich von der entstehenden Zukunft her in sich hineinzuziehen schien?«
Der Weg von Theorie U ist im Grunde eine Erforschung der Frage, wie wir diese tieferen Quellen von Zeit, Sein und Selbst auf eine Weise erschließen können, die verlässlich, praktisch und kollektiv ist – und die funktioniert, ohne dass Haus und Hof deiner Familie jeden Morgen in Flammen aufgehen. Diese Fragen haben mich schließlich dazu bewogen, Deutschland zu verlassen, 1994 in die USA zu gehen und dort meine Forschung am Organizational Learning Center des MIT (Massachusetts Institute of Technology) weiterzuführen.
2Der Weg zum »U«
Theorie U: Die Anfänge • Das Interview mit Brian Arthur von Xerox PARC • Das Gespräch mit Francisco Varela über den blinden Fleck in den Kognitionswissenschaften
Theorie U: Die Anfänge
Der blinde Fleck wirft die Frage nach dem Ursprungsort unserer Aufmerksamkeit auf. Während eines Interviews mit Bill O’Brien, dem ehemaligen CEO der Hanover Insurance Group, habe ich zum ersten Mal diesen blinden Fleck in Organisationen wahrgenommen. Bill erzählte mir, seine größte Einsicht, nachdem er als CEO jahrelang Veränderungsprozesse initiiert und durchgeführt hatte, sei gewesen, dass »der Erfolg einer Intervention von der inneren Haltung desjenigen abhängt, der die Intervention durchführt«. In diesem Gespräch wurde mir klar, dass es nicht nur darauf ankommt, was Führungspersonen machen und wie sie es tun, sondern mit welcher Intention sie handeln. Das heißt, der innere Ort, von dem aus sie handeln – der Quell- oder Ursprungsort von Handlung, die Qualität unserer Aufmerksamkeit – beeinflusst das Ergebnis unserer Handlung. Die gleiche Person kann mit der gleichen Aktion ein völlig anderes Ergebnis bewirken, je nachdem von welchem inneren Ort aus sie handelt.
Über das Was und das Wie von Handlung, d. h. über Führungsprozesse, wissen wir viel. Aber was wissen wir über den inneren Ausgangspunkt von Führung oder Handlung? Mir war nicht klar, ob es nur einen Ausgangspunkt von Handlung gibt oder vielleicht mehrere. Der Ausgangspunkt von Handlung ist ein blinder Fleck. In meinen Interviews mit Führungskräften und auch mit Kreativen habe ich immer wieder gehört, wie wichtig dieser Quellpunkt oder blinde Fleck ist. Es ist dieser blinde Fleck, der den Unterschied macht zwischen einer Meisterleistung und einem durchschnittlichen Ergebnis. Vor 2300 Jahren beschrieb Aristoteles den Unterschied zwischen dem »Was-Wissen« (episteme) und dem praktischen und technischen »Wie-Wissen« (phronesis, techne) auf der einen Seite sowie dem inneren Wissen erster Prinzipien und Quellorte der Aufmerksamkeit (nous) und der Weisheit (sophia) auf der anderen Seite (Aristoteles 1972).
1994, in meinem ersten Jahr am MIT, sah ich eine Live-Videopräsentation zum Thema organisationales Lernen. Nach einer Frage aus dem Publikum ging Rick Ross, der Mitautor von The Fifth Discipline Fieldbook (1994, dt. 1996: Das Fieldbook zur fünften Disziplin), zur Tafel und notierte die folgenden drei Wörter (Abb. 2.1):

Abb. 2.1: Ebenen organisationaler Veränderung
Als ich dieses einfache Bild sah, wurde mir klar, dass organisationale Veränderungen auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Plötzlich sah ich diese Ebenen. Neben den drei Ebenen aus der Präsentation gab es noch subtilere Veränderungsebenen. In meinem Kopf fügten sich zwei weitere Ebenen hinzu – oberhalb von »Struktur« und unterhalb von »Denken«. Außerdem wurde mir noch eine horizontale Dimension deutlich, der Weg von der Wahrnehmung zur Handlung. Damit entstand die U-förmige Skizze, wie sie in Abb. 2.2 wiedergegeben ist.
Den tiefsten Punkt in diesem U nannte ich »Presencing«. Die Überlegungen dazu werde ich im Teil III dieses Buches ausführlicher darstellen. Hier reicht es aus, Presencing zu beschreiben als »von der Quelle her« oder »von der höchsten zukünftigen Möglichkeit her handeln und wahrnehmen«. Das ist der Zustand, den jeder von uns erleben kann, wenn wir nicht nur unser Denken, sondern auch unser Herz und unseren Willen – unseren Impuls zum Handeln – öffnen, um mit den neuen Realitäten, die überall um uns herum entstehen, umzugehen.
Ich begann, dieses Konzept meiner Arbeit in Unternehmen und Organisationen vorzustellen, und merkte, dass es für viele Praktiker hilfreich war, um die eigenen Erfahrungen klarer zu sehen und zu reflektieren. Durch die Arbeit mit der U-Skizze erkannten sie die Bedeutung der zwei entscheidenden Dimensionen:
•Die horizontale Achse trennt Wahrnehmung und Handlung voneinander und beschreibt den Weg von der Wahrnehmung oder dem Erspüren (Sensing) über den Entschluss zum In-die-Tat-Umsetzen.
•Die vertikale Achse beschreibt die verschiedenen Ebenen von Veränderung: von der oberflächlichsten Antwort, der »Re-Aktion«, bis zum umfassenden »Re-Generieren«.24

Abb. 2.2: Fünf Ebenen von Veränderung
Die meisten Lern- und Veränderungsprozesse basieren auf dem Kolb-Lernzyklus, der den folgenden Lernprozess beschreibt: 1) Beobachtung, 2) Reflexion, 3) Handlung. Diese Abfolge macht die Erfahrungen der Vergangenheit zum Ausgangspunkt von Lernprozessen (Kolb 1984). Chris Argyris, Professor in Harvard, und Don Schön, bis zu seinem Tod Professor am MIT, haben in ihrer Arbeit über Lernprozesse (1995) die Unterscheidung zwischen Single-loop- und Double-loop-Lernen eingeführt:
•Single-loop-Lernen heißt, dass Erfahrungen der Vergangenheit der Ausgangspunkt für Lernen sind: die Differenz zwischen intendierten und realisierten Ergebnissen einer Handlung. In der Sprache der Abbildung findet diese Form von Lernen auf den Ebenen des Reagierens und Restrukturierens statt.
•Double-loop-Lernen heißt, dass nicht nur von den Erfahrungen der Vergangenheit gelernt wird, sondern dass auch der Prozess und die Annahmen des Handelnden reflektiert werden. Ein Beispiel für Double-loop-Lernen ist das, was in Abb. 2.2 als Reframing bezeichnet wird. Grundlegende Annahmen, auf denen das Handeln basiert, werden in den Lernprozess mit einbezogen.
In der Abbildung des U-Prozesses wird die unterste Ebene mit Regenerating bezeichnet. Regenerating geht über das Double-loop-Lernen hinaus. Diese Ebene umfasst eine andere Zeitdimension, indem sie auf die Ankunft einer in der Zukunft liegenden Möglichkeit Bezug nimmt. Diese Form von Lernen, die über die Vergangenheitserfahrung hinausgeht, bezeichne ich in diesem Buch als »Presencing« oder als den »U-Prozess«.
Das Konzept des U ist natürlich nicht aus dem Nichts entstanden. Die Theorie U entstand aus meiner Arbeit als Aktionsforscher bei zahlreichen Veränderungsprojekten in unterschiedlichen Kontexten und Bewegungen und auf der Grundlage meiner früheren Forschung (vgl. Scharmer 1991, 1996).
Wichtige Denkanstöße zum Thema soziale Entwicklung und Veränderung lieferte das Global Studies Program, eine Lernreise, die das Ziel hatte, die Dynamik von Krieg und Frieden zu erforschen (1989–1990). Sie führte mich nach Indien, wo ich Ghandis Konzepte der gewaltfreien Konfliktlösung studierte, sowie nach China, Vietnam und Japan, wo ich die Entwicklungsideen im Buddhismus, Konfuzianismus und Daoismus näher kennenlernte. Ich hatte auch das Glück, mit einzigartigen akademischen Lehrern arbeiten zu dürfen, Ekkehard Kappler und Johan Galtung, die mich unterwiesen, welche Rolle kritisches Denken und die Wissenschaft für soziale Transformation und Veränderung spielen. Weitere Quellen, die mein Denken beeinflusst haben, sind unter anderem das Werk des Avantgardekünstlers Joseph Beuys, die Schriften von Henry David Thoreau, Martin Buber, Friedrich Nietzsche, Edmund Husserl, Martin Heidegger, Jürgen Habermas sowie einige von den alten Meistern wie Hegel, Fichte, Aristoteles und Plato.
Maßgebend für mich war auch die Auseinandersetzung mit dem Werk Rudolf Steiners. Dessen Synthese von Wissenschaft, Bewusstsein und sozialer Innovation hat meine Arbeit nachhaltig inspiriert (vgl. Steiner 1894), und seine in Goethes phänomenologischer Wissenschaftssicht gründende Methodologie hat die Theorie U entscheidend geprägt.
Am einfachsten lässt sich die Theorie U in der Landschaft intellektueller Traditionen verorten, indem man sie als angewandte Phänomenologie betrachtet – eine achtsame phänomenologische Praxis zur Erforschung des sozialen Feldes. In diesem Zusammenhang war die Arbeit von Friedrich Glasl eine weitere wichtige Inspirationsquelle für mich. Angeregt durch die Arbeit Rudolf Steiners entwickelte Glasl ein mit der Theorie U verwandtes Konzept, das Unternehmen und Organisationen als miteinander zusammenhängende Subsysteme auffasst (Glasl 1997, 1999).
Die wichtigsten Erkenntnisse, die ich aus Steiners Grundwerk, Die Philosophie der Freiheit (1894), gewann, sind dieselben, die sich nach Abschluss meines ersten MIT-Forschungsprojekts mit Edgar Schein einstellten. In diesem Forschungsprojekt untersuchten wir die verschiedenen Veränderungstheorien, mit denen Wissenschaftler an der MIT Sloan School of Management arbeiteten. In unserer Auswertungssitzung betrachtete Ed Schein die Ergebnisse unserer Untersuchung, eine recht komplexe Verflechtung von Konzepten und Referenzrahmen, und sagte:
»Vielleicht sollten wir zurück zu den Daten gehen und noch mal ganz von vorne anfangen. Vielleicht müssen wir unsere eigenen Erfahrungen mit Veränderungsprozessen ernster nehmen und zum Ausgangspunkt unserer Forschungsarbeit machen.«
Ich verstand das so, dass wir – um mit Steiner zu sprechen – unsere eigene Erfahrung und unseren eigenen Denkprozess klarer, transparenter und rigoroser untersuchen müssen. Mit anderen Worten: Vertraue deinem Wahrnehmungsapparat, vertraue deinen Beobachtungen, vertraue deiner eigenen Wahrnehmung, und mache sie zum Ausgangspunkt der Untersuchung –verfolge diese Beobachtungsreihe dann aber bis zur Quelle, genauso wie Husserl und Varela dies in ihrer Beschäftigung mit der phänomenologischen Methode empfehlen. Die phänomenologische Methode beginnt mit den individuellen Wahrnehmungen. Die Theorie U baut auf dieser Methode auf und stellt die Frage nach den Strukturen und Quellen der kollektiven Aufmerksamkeit in Teams, Organisationen und größeren Systemen.
Das Interview mit Brian Arthur von Xerox PARC
Im Jahre 1999 begann ich ein Projekt mit meinem Kollegen Joseph Jaworski, dem Autor von Synchronicity: The Inner Path of Leadership (Jaworski 1996; Synchronizität: Der innere Weg von Führung). Der Ausgangspunkt war ein Veränderungsprojekt mit einer Gruppe von Managern in einem großen globalen Unternehmen, das nach einem Firmenzusammenschluss gerade neu strukturiert worden war. Ziel des Projekts war es, die Lern- und Innovationsfähigkeiten der Manager in dem sich schnell verändernden wirtschaftspolitischen Umfeld zu vergrößern.
Zunächst interviewten wir Vordenker der Innovationsbranche, unter anderem W. Brian Arthur, den Gründer des wirtschaftswissenschaftlichen Bereichs am Santa Fe Institute. Brian Arthur ist vor allem für seine Arbeit über die Entstehung und Veränderung von Hightech-Märkten bekannt geworden. Als wir am Xerox PARC (Akronym für Palo Alto Research Center) in Kalifornien ankamen, musste ich an die Veränderungen denken, die genau an diesem Ort ihren Anfang genommen hatten. Seit den 1970er Jahren galt das ursprüngliche Xerox-PARC-Team als eines der erfolgreichsten Forschungs- und Entwicklungsteams der letzten Jahrzehnte. Zu den Erfindungen, die in diesem Gebäude entstanden sind, zählt etwa die Benutzeroberfläche, die heute auf fast jedem Desktop-PC der Welt zu finden ist. Neben anderen Technologien hat dieses Team auch die Computermaus erfunden. Viele der hier entstandenen Ideen werden heute von anderen Firmen genutzt, beispielsweise Apple und Adobe. Ironischerweise konnte Xerox aus diesen bahnbrechenden Ideen kein Kapital schlagen. Stattdessen wurden die Ideen von Leuten wie Steve Jobs und anderen, die nicht durch die Leitung einer Druckerfirma abgelenkt waren, aufgegriffen und weiterentwickelt. Als wir uns mit Arthur trafen, fingen wir sofort an, über die sich wandelnden ökonomischen Grundlagen der heutigen Geschäftswelt zu sprechen:
»Um in Hightech-Märkten zu gewinnen«, sagte Arthur, »ist es notwendig, Muster zu erkennen, die diese Märkte bestimmen.« Er beschrieb zwei verschiedene Möglichkeiten der Erkenntnis: »Es gibt zwei Wege, etwas zu verstehen oder zu erkennen. Die allgemein diskutierte Erkenntnisform ist der rationale Verstand, aber es gibt noch eine tiefere Ebene. Ich nenne diese tiefere Ebene ein inneres oder intuitives Wissen.«
»Angenommen«, sagte er, »ich springe mit einem Fallschirm über dem Silicon Valley ab. Plötzlich bin ich mit einer komplizierten dynamischen Situation konfrontiert, und meine Aufgabe ist, sie zu verstehen. Was würde ich tun? Ich würde beobachten und beobachten und wieder beobachten, dann würde ich mich zurückziehen. Mit etwas Glück könnte ich dann einen inneren Ort in mir finden, an dem ich verstehe, was als Nächstes zu tun ist. Einen inneren Ort, an dem ich mich mit meinem durch die Beobachtungen entstandenen Wissen verbinden kann.« Arthur fuhr fort: »Ich würde diesen Prozess wie folgt beschreiben: Du wartest und wartest und lässt deine Erfahrung sich mit der Situation verbinden. In gewisser Weise gibt es kein Entscheiden. Das, was zu tun ist, wird offensichtlich. Du kannst es nicht beschleunigen. Viel hängt davon ab, woher du innerlich kommst und wer du bist, als Mensch. Hieraus ergeben sich viele Implikationen für das Management. Was ich meine, ist, dass das, was zählt, davon abhängt, was in dir selber lebt, woher du tief drinnen in dir selbst kommst.«
Was wir an diesem Tag hörten, stand in enger Verbindung mit dem, was wir in früheren Interviews, aber auch bei unserer Arbeit in Organisationen gefunden hatten. Führungskräfte müssen sich mit ihrem blinden Fleck auseinandersetzen, d. h. den inneren Ort, »was in dir selber lebt«, aus dem heraus sie handeln, verlagern. Arthur ergänzte:
»Stell dir vor, was passieren würde, wenn Apple sich zum Beispiel entschließen würde, einen ehemaligen CEO von Pepsi-Cola einzustellen? Diese Person würde ein bestimmtes Wissen mitbringen: Kosten runter, Qualität rauf oder wie auch immer ihr Mantra lautet. Und es würde nicht funktionieren. Aber nun versuche, dir vorzustellen, ein Steve Jobs käme – jemand, der von einem Problem zurücktreten und anders denken kann. Als Steve Jobs zu Apple zurückkam, war das Internet in seinen Anfängen. Niemand konnte absehen, was diese Entwicklung bedeuten würde. Schau ihn dir heute an: Er vollbrachte den Turnaround bei Apple. Erstklassige Wissenschaftler arbeiten genauso. Die guten, aber nicht erstklassigen Wissenschaftler können existierende Bezugssysteme nehmen und sie auf irgendeine Situation anwenden. Die erstklassigen treten einen Schritt zurück und lassen eine Idee oder einen Bezugsrahmen entstehen. Meine Erfahrung ist, dass diese Wissenschaftler nicht mehr Intelligenz besitzen als die guten Wissenschaftler, aber sie haben diese andere Fähigkeit, und das macht den ganzen Unterschied aus.«
Diese »andere Art des Wissens« zeigt sich auch bei chinesischen und japanischen Künstlern. Arthur benutze das folgende Bild:
»Diese Künstler sitzen eine ganze Woche lang auf einem Sims mit Laternen und schauen nur. Dann plötzlich sagen sie ›Oh!‹ und malen dann sehr schnell.«
Auf dem Rückweg begriffen wir, dass dieses Gespräch mit Arthur uns zwei wesentliche Erkenntnisse geliefert hatte. Die erste ist, dass es eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Formen von Erkenntnis gibt: eine »normale« Ebene des Wissens (mentale Bezugssysteme runterladen) und eine tiefere. Außerdem hatten wir von ihm gehört, dass, um diese tiefere Ebene des Wissens aktivieren zu können, man ähnlich wie bei Arthurs beispielhaften Fallschirmsprung über dem Silicon Valley durch einen dreistufigen Prozess gehen muss:
1) Beobachte in der Tiefe,
2) verbinde dich mit dem, was in dir als Wissen entsteht, und
3) handele unmittelbar aus der Anwesenheit dieser tieferen Anschauung.
Ich verband dieses Gespräch mit meiner früheren Arbeit am U, malte eine U-Form auf ein Stück Papier, zeichnete die Hauptpunkte, die sich aus dem Gespräch mit Brian Arthur ergaben, ein (Abb. 2.3) und zeigte dies Joseph.

Abb. 2.3: Drei Bewegungen des U
Wir erkannten, dass wir auf etwas sehr Bedeutsames gestoßen waren. Es folgte eine Phase intensiver Präzisierung, Verdichtung und Überarbeitung des Bezugsrahmens. Meine gemeinsame Arbeit mit Joseph hat mich vieles darüber gelehrt, was es bedeutet, als Individuum aus dieser tieferen Quelle des Wissens heraus zu arbeiten. Seine Lebensgeschichte, die er in seinem Buch Synchronizität schildert, veranschaulicht auf eindrucksvolle Weise, wie der Einzelne diese tiefere Quelle der Kreativität erschließen kann. Die sich nun anschließende Frage lautete: Was muss eine Gruppe, eine Organisation oder eine Institution tun, um auf einer ähnlichen Ebene zu handeln (vgl. Scharmer et al. 2002)? Die Suche nach der Antwort wurde unsere Mission (Senge et al. 2004).