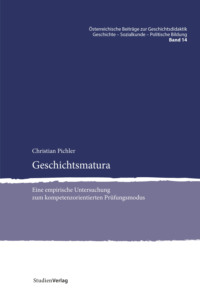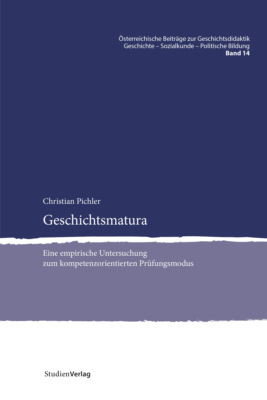Kitabı oku: «Geschichtsmatura», sayfa 11
5.2 Ausgewählte Beispiele empirischer Kompetenzmessversuche
Borries hat bereits 1973 erste Versuche unternommen, auf der Basis der Erkenntnislogik die Tauglichkeit von Aufgabenstellungen zur Überprüfung von Methodenkompetenz zu untersuchen.582 Da die Fachdidaktik der 1970er Jahre wissensorientierte Testverfahren dominiert haben, ist diesen Befunden wenig Beachtung geschenkt worden. Daher hat Borries, den damaligen Trends folgend, 1974 mit quantitativen Verfahren (Multiple-Choice-Tests) Fähigkeiten historischen Denkens zu erkunden versucht. Der Befund ist negativ ausgefallen und hat gezeigt, dass Aufschlüsse über Kompetenzen mit geschlossenen Verfahren nicht zu gewinnen sind. Demgegenüber brachten triangulative Vorgehensweisen (geschlossene Fragen in Kombination mit offenen Formaten und Nach-Interviews), Portfolioanalysen, Untersuchungen von Essays, Referaten, Rezensionen, Projektberichten und die Beobachtung von Rollen- oder Planspielen (auch Theateraufführungen) sowie die langfristige analytische Begleitung individueller und gruppenspezifischer Arbeiten oder geschichtskultureller Aktivitäten Ergebnisse, die Fähigkeiten sichtbar gemacht hatten. Ihre Durchführung war aufwändig.583 Borries hat aus seinen frühen Forschungen drei Schlussfolgerungen gezogen: (1) Es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen dem Risiko, Lernziele in Aufgabenstellungen vorwegzunehmen und der Gefahr, die Aufgaben zu wenig präzise zu formulieren, will man das direkte Hinführen zum Lernziel vermeiden. (2) Es ist nicht möglich, Multiperspektivität, Multikausalität und Multidimensionalität durch Wissensfragen aufzuhellen. (3) Quantitative Verfahren könnten nur zur Feststellung basaler Fähigkeiten herangezogen werden. Komplexere Vorgänge sind ausschließlich mit qualitativen Methoden erforschbar. Folglich erweisen sich Kurzessays als probate Methode, um Kompetenzen sichtbar zu machen und sie valide, reliabel, objektiv und testökonomisch zu messen. Aber auch bei Essays ist nicht auszuschließen, dass persönliche Denkleistungen durch gelernte Konventionen substituiert werden, was ein potenzielles Graduierungsergebnis verfälschen würde. Dieses Risiko kann durch eine gut überlegte und sorgfältig gestaltete Aufgabenstellung minimiert werden, sodass eine Performanz entsteht, die Rückschlüsse auf die Kompetenzen erlaubt.584
Eine frühe Studie dieser Art stammt von Johannes Meyer-Hamme (2002).585 Sein Interesse ist es gewesen, an 840 Schülern*innen und Lehramts-Studierenden Geschichtsbewusstsein zu untersuchen.586 Das Forschungsdesign hat bei allen Probanden*innen aus Fragebögen bestanden (geschlossene Fragen und teilweise offene Fragen). Die Aufgabenstellungen hat der Studienautor so konstruiert, dass herauszufinden gewesen ist, ob es die Proband*innen vermögen, mittels Erkenntnissen aus dem Unterricht (und der abseits davon stattfindenden Bewusstseinsentwicklung) eigene Geschichtsbilder zu relativieren oder ob sie, trotz Unterrichts, dem Mainstream (politisch, religiös, historisch, gesellschaftlich) folgen. Seine Aufgaben versteht Meyer-Hamme als Konstruktionen zum Zweck des Sichtbar-Machens der mentalen Oberflächenstruktur bei der Reorganisation von Geschichtsbildern. Wie Borries, geht auch er von der Annahme aus, dass Kompetenzen nicht in aller Vielschichtigkeit messbar sind, weil sie in die mentale Tiefenstruktur reichen, die von Testaufgaben nicht erschließbar ist. Grundlegende Ausprägungen sollten jedoch einigermaßen valide beobachtbar sein. Daher definiert Meyer-Hamme fünf Kompetenzstufen587 und testet sie an seiner Zielgruppe. Er lässt die Probanden*innen zu einem bestimmten Thema (z. B. „Die Christianisierung der Germanen durch Bonifatius“) mittels eines Schulbuchvergleichs (drei Auszüge) rekonstruierend (Gemeinsamkeiten oder Widersprüchen, Absichten, Perspektiven, Methoden) und dekonstruierend (Beschreibung des Empfindens bei der Lektüre der Texte, Empathie, Sinnbildung) arbeiten. Die Produkte nennt er „Kurzessays“.588 Der Studienautor hält die Methode für geeignet, um historisches Denken aufzuschlüsseln, zu graduieren und um Kompetenzmodelle zu testen. Kritisch sieht Meyer-Hamme rückblickend das Setting. Es habe sich herausgestellt, dass die Fragebogentechnik die Probanden*innen dazu animiert, eher vorhandene Konventionen zu aktivieren als reflektierend zu arbeiten. Daher rät er Forschenden dazu, das Testverfahren weiter zu entwickeln und die Reflexion eher über historische Beispiele mittels offener Fragestellungen zu überprüfen.589
In einer weiteren Studie (2009) widmet sich Meyer-Hamme der Identitätsreflexion, den Einflüssen von Perspektivität auf den Umgang mit Geschichte (Orientierungskompetenzen) und der Wirkung von Unterricht.590 Um Verbalisierungen subjektiver und relevanter Deutungen durch Schüler*innen zu evozieren, hat der Forscher acht 18jährige Schüler*innen eines kulturell heterogenen Geschichte-Leistungskurses zweimal mittels narrativer Interviews befragt. Die Performanzen sind nach der Dokumentarischen Methode591 ausgewertet worden. In den Interviews thematisiert Meyer-Hamme Inhalte von Unterrichtsstunden, die die Schüler*innen erlebt haben, um herauszufinden, was für deren Orientierung wichtig war (Konstruktion von Identitäten) und welche Rolle dabei der Unterricht gespielt hat. Er kommt zum Schluss, dass Identitäten und die daraus resultierenden Perspektiven Sinnbildungen massiv beeinflussen. Es gelingt, einzelne Fähigkeiten und Fertigkeiten des FUER-Modells (Reflexion des Selbstverstehens) zu rekonstruieren. Standardisierbar sind die narrativen Produkte aber nur bedingt. Meyer-Hamme glaubt, dass ein mittleres Niveau (intermediär) definiert werden kann, allerdings nur auf der Grundlage von Performance-Standards.
In der Kategorie Ergebnisforschung haben Schönemann, Thünemann und Zülsdorf-Kersting anhand des Zentralabiturs im Fach Geschichte in Nordrhein-Westfalen (2008) Schüler*innen-Leistungen auf historische Kompetenzen untersucht.592 Der Studie liegen Performanzen (Abiturarbeiten) zu Grunde, die Messgrößen sind die EPA-Kriterien. Die Forscher haben mittels einer Stichprobe herauszufinden versucht, welche Leistungen Schüler*innen am Ende der Sekundarstufe II zu erbringen vermögen und worin eine mögliche Verbindung mit historischen Kompetenzen besteht. Aus den Ergebnissen haben sie Empfehlungen für die Unterrichtsarbeit und für die zentrale Aufgabenentwicklung abgeleitet.593 Die Untersuchung beginnt mit einer Analyse der autoritativen Vorgaben, die den Geschichtsunterricht in Nordrhein-Westfalen zu unterwerfen bedingen (Lehrplan, der EPA-Kriterien, Vorgaben für die Unterrichtspraxis), ehe 238 Klausurarbeiten aus 40 Gymnasien und 25 Gesamtschulen nach qualitativen Verfahren analysiert werden. Die Wissenschaftler nehmen an, dass Abiturklausuren nicht auf Eigeninitiative von Schüler*innen zustande kommen und die Aufgabenstellungen somit steuernd wirken. Daher gehen sie davon aus, dass Schüler*innen in der Bearbeitung der Aufträge primär den Erwartungen der Korrektoren zu entsprechen versuchen, was bedeutet, dass durch das Zentralabitur weniger allgemeine (Denk-)Leistungen als strategische Fähigkeiten (Streben nach Erwartungs-Entsprechung) herauszufinden sind. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass es bei einzelnen Kategorien (deklaratives Fachwissen, Sach- und Werturteile) gelingt, Hinweise auf abgestufte Leistungen zu finden, die Frage nach dem Grad des Verfügens über historische Kompetenzen jedoch nicht beantwortet werden kann, weil Aufgaben und Erwartungshorizonte kaum eigenständige Denkprozesse anleiten, sondern die Anwendung von Sachwissen einfordern.594 „Es geht weniger um das Niveau der historischen Erzählung, sondern vor allem um die inhaltliche Vollständigkeit der Darstellung.“595
Resümee: Erste Befunde zum Forschungsgegenstand Kompetenzmessung lassen kein homogenes Bild entstehen. Das Ergebnis hängt von Bedingungen und Zielen ab. Borries testet triangulativ Produkte der Unterrichtsarbeit, um Aufschlüsse über das Verfügen Methodenkompetenz zu gewinnen, was unter großem Aufwand gelingt. Meyer-Hamme zieht, ebenfalls auf der Basis von Unterricht, Stichproben zur Orientierungskompetenz und kommt zum Schluss, dass sich gewisse Fähigkeiten sich in ihrer Oberflächenstruktur sichtbar machen, beschreiben und mit Einschränkungen graduieren lassen. Demgegenüber erkennen Schönemann et all., dass die Abiturprüfung Kompetenzen nur bedingt evident werden lässt und deren Stufung nicht ermöglicht. Das bedeutet, dass in der Kompetenzforschung ein hohes Maß an Offenheit bei der Auswahl der Methode(n) angesagt ist, abhängig vom Untersuchungsgegenstand und vom Forschungsinteresse. Dieser Überzeugung folgen Doren Prinz und Holger Thünemann, wenn sie der Geschichtsdidaktik den Einsatz von Mixed-Methods empfehlen, um damit den Horizont für Zugänge zu Forschungsfragen zu weiten.596
6. Das Forschungsvorhaben
Forschungsgegenstand dieser Studie ist die mündlich zu absolvierende, kompetenzorientierte Geschichtsreifeprüfung in Österreich. Ihr Zweck ist es, historisch-politische Fähigkeiten und Fertigkeiten am Ende der Schullaufbahn sichtbar zu machen, obschon die Leistungserwartungen nicht standardisiert worden sind.
6.1 Passungsproblem: Prüfungskriterien, AFB und FUER-Kompetenzen
Es ist beschrieben worden, dass der Gesetzgeber dem Prüfungsdesign die EPA-Kriterien zugrunde gelegt hat. Sie basieren auf den Vorstellungen, Wahrnehmungen seien in einem dreistufigen Verfahren erschließbar und in Erkenntnis transferieren.597 Gautschi bezeichnet diese Denkvorgänge als „[…] geistige Bewegung zwischen Sachanalyse, Sachurteilen und Werturteilen“,598 in der sich historisches Lernen manifestiert und er hält es für wahrscheinlich, dass sich in diesem Prozess Rüsens Paradigma einer Bewusstseinsänderung durch Zeiterfahrung vollziehen kann.599 Evident werde die Entwicklung von Sinnbildung in der Narration, denn das Erzählen erweise sich als die „[…] spezifische Form des Erklärens historischer Erkenntnis“.600 Es ist von zentraler Bedeutung für den Erfolg des Prozesses. Die EPA trage dem Kompetenzparadigma Rechnung, weil den Verfahrensschritten Kompetenzen zuordenbar sei: (1) der Sachanalyse die Sachkompetenz, (2) dem Sachurteil die Methodenkompetenz, (3) dem Werturteil die Urteilskompetenz.601 Mit Hilfe des Konzepts des „Anforderungsbereichs“ (AFB), der durch Operatoren zu bewältigen ist, werden fachliche Fähigkeiten und Fertigkeiten und in Form einer Erzählung sichtbar gemacht. Die Einschätzung Gautschis, das AFB-Verfahren eigne sich zur Kompetenzanalyse, basiert auf der Vorstellung, dass der Unterricht gemäß diesen Prinzipien methodisch aufbereitet wird. Für die österreichische Schulrealität ergibt sich daraus ein Theorieproblem, denn der Unterricht soll nach FUER gestaltet werden. Da EPA nicht auf FUER rekurriert und durch das Prüfungsgeschehen FUER-Kompetenzen evident werden sollen, muss daher vorab die Frage geklärt werden, welche Teilkompetenzen anhand der Vorgaben für das Aufgabendesign sichtbar gemacht werden können. Es gilt daher in einem ersten Schritt einen Theorie-Vergleich durchzuführen, um Kongruenzen und Divergenzen zwischen dem AFB-System und den FUER-Vorstellungen zu klären, mit dem Ziel, Kompatibilitäten zwischen beiden Modellen zu identifizieren.
Der AFB I („Reproduktion“) hat bei der EPA Sachanalyse zum Thema. Die dafür nötigen Fähigkeiten und Fertigkeiten werden mit dem Begriff „Sachkompetenz“ versehen. Darunter wird Wissen gemäß den geschichtswissenschaftlichen Sektoren verstanden. „Es muss unterschiedliche Dimensionen der historischen Fachwissenschaft, wie z. B. der politischen Geschichte, der Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte angemessen umfassen […].“ Es verlangt „[…] umfangreiche Kenntnisse über historische Ereignisse, Personen, ideengeschichtliche Vorstellungen, Prozesse und Strukturen sowie vom Leben der Menschen […]“,602 und es soll zeigen, dass nach den Zeitebenen „Eigenwirklichkeit“ und „[…] als Vorgeschichte der Gegenwart“603 unterschieden werden kann. Für die EPA ist „Sachkompetenz“ das Verfügen über deklaratives Fachwissen in kategorialer Ausprägung und über Verfahren, dieses Wissen zu deuten.604 Die österreichischen didaktischen Empfehlungen sehen in der Bewältigung des AFB I den Nachweis der Fähigkeit zur Wiedergabe erlernten Fachwissens und damit ein „[…] rein reproduktives Nutzen von Arbeitstechniken“,605 wie etwa die Kenntnis von Quellenarten oder die Unterscheidung von Quellen und Darstellungen. Erwerb und Wiedergabe von „Verfügungswissen“606 gilt als Voraussetzung für die Durchführung der weiteren Arbeitsschritte, es ist noch keine Kompetenz, denn FUER versteht unter Sachkompetenz das Verfügen über fachspezifische Termini (Begriffskompetenz) und die Fähigkeit, ein entstehendes narratives Konstrukt zu ordnen und zu gliedern (Strukturierungskompetenz). Diese Systematisierung ist die eigentliche Fähigkeit, sie erfolgt auf der Basis inhaltsbezogener Kategorien (Wissen). Um eine Narration herzustellen, bedarf es zudem der Nutzung historischer Verfahrensscripts, der Beherrschung epistemologischer Prinzipien und des Wissens um die subjektbezogenen Konzepte von Identität und Alterität.607
Der AFB II („Reorganisation und Transfer“) meint Methodenkompetenz. Sie ist bei EPA mit einem prononciert kritischen Deutungsansatz versehen, nämlich der „[…] Befähigung zur Beurteilung der Triftigkeit verschiedener Erklärungsansätze“.608 „Die Prüflinge beherrschen Verfahren, um auf der Grundlage sicheren Fachwissens historische Verläufe und Strukturen zu analysieren und sinnbildend zu synthetisieren.“609 Die Kandidat*innen können Quellen und Darstellungen interpretieren sowie historische Sachverhalte auf ihren Problemgehalt, allfällige Mehrdeutigkeit und Kontroversität hin untersuchen, d. h. ein Sachurteil bilden.610 In der österreichischen Variante steht das autonome, methodisch korrekte Bearbeiten (Analyse) und Erläutern (Reorganisation) von historischen und politischen Inhalten anhand des vorgegebenen Materials im Zentrum der Methodenkompetenz. Dazu tritt die Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse durch Herstellen von Zusammenhängen (Transfer) in der Erzählung. Ziel ist der Nachweis einer verfahrensgeleiteten De- und Re-Konstruktion und einer schlüssig begründbaren Darstellung der Ergebnisse.611 Laut FUER soll die Methodenkompetenz Menschen befähigen, eine historische Erzählung narrativ, normativ und sachlich triftig zu gestalten. Zu diesem Zweck ist die Beherrschung der De-Konstruktion von Quellen und Darstellungen (Analyse) und der Re-Konstruktion (Narrationsbildung) nötig. Die De-Konstruktion bedarf des Verfügens über Mechanismen der Tiefenanalyse und der Triftigkeitsprüfung. Der synthetische Prozess der Konstruktion einer Erzählung benötigt Kenntnisse über Heuristik, Quellenkritik und Interpretation sowie die Fähigkeit, Texte zu verfassen. Ziel ist es, durch die Narration Sinnbildung, das Produkt eines historischen Denkvorgangs, sichtbar zu machen.612 Die Differenzen zwischen FUER und der EPA sind marginal.
Der AFB III („Reflexion und Problemlösung“) meint bei EPA Urteilskompetenz. „Die Prüflinge kommen zu einem durch Argumente begründeten Urteil (Sach- und Werturteil)“.613 Es beruht auf mentalen Prozessen, in denen „[…] eigene Wertmaßstäbe reflektiert“614 werden und weist somit auf die handlungsbedingenden Folgen hin, die aus der Auseinandersetzung mit den AFB I und II erwachsen.615 Die didaktischen Empfehlungen für die österreichische Prüfung sehen die mentalen Prozesse weiter, wenn es heißt, es gehe um „[…] einen reflexiven Umgang mit neuen Zusammenhängen bzw. Problemkonstellationen, […], also um die Fähigkeit eigenes Selbst- und Weltverständnis reflektieren zu können“.616 Ziel ist nicht nur das plausible Begründen von Standpunkten, sondern auch das eigenständige Bilden und Kommunizieren von Hypothesen. Mit der Fähigkeit zur Interpretation, Bewertung und Reflexion sollen Kandidat*innen nachweisen, dass sie persönliche Positionen definieren, einnehmen und argumentieren können und gegebenenfalls daraus Handlungen ableiten. Auch die Fähigkeit, offene Fragen zu erkennen und zu formulieren (Fragekompetenz) findet hier ihren Raum.617 In Österreich folgt man FUER, das in der Urteilsfähigkeit nur eine Dimension der wesentlich breiter gedachten Orientierungskompetenz sieht. Das Erlernen der Fähigkeit zu reflektieren ist die Voraussetzung für die Nutzung dieser Kompetenz im Alltag. Ohne die Bereitschaft, die eigenen Vorstellungen aufgrund neuer Erkenntnisse zu ändern (Re-Organisierung des Geschichtsbewusstseins), gelingt Orientierung nicht. Die Fähigkeit, Welt- und Fremdverstehen und Selbstverstehen reflektieren zu können, bildet neuen Sinn und zeugt von einem reflektierten Geschichtsbewusstsein.618
Differenzen zwischen der EPA, der Erwartung der österreichischen Fachdidaktik an die Aufgabenstellung und dem FUER-Modell gibt es im Verständnis der Funktion des AFB I und der Sachkompetenz. Die EPA legt den Fokus auf fundierte geschichtswissenschaftliche Kenntnisse (Epochen, Räume, Dimensionen), die Fähigkeit der Unterscheidung von Quellen und Darstellungen sowie der Differenzierung der Bewertung der Ereignisse nach der Wirkung in ihrer Zeit und als Vorgeschichte für Nachfolgendes.619 Diese Parameter darstellen zu können wird als Sachkompetenz verstanden. Demgegenüber sieht die österreichische Geschichtsdidaktik – FUER folgend – in der Bewältigung des AFB I keine Kompetenz, sondern eine Reihe von Operationen, die dem Aufbau von Verfügungswissen (deklaratives und prozedurales Wissen) dienen. Die „Wiedergabe von Sachwissen (u. a. auswendig gelerntes Fachwissen oder die herausgearbeiteten Inhalte von Darstellungen) […]“620 ist das Ziel. Deklaratives Fachwissen ist ohne deutende Komponente zu reproduzieren und prozedurales Wissen (Verfahren) zu beherrschen. Laut FUER bildet das eine Voraussetzung für den Nachweis von Sachkompetenz. Übereinstimmung herrscht in der Sicht auf den AFB II als jenen Bereich, der Methodenkompetenz sichtbar macht. Den Nachweis der Fähigkeit zur verfahrensgeleiteten Analyse von Quellen und Darstellungen nach erlernten Schemata und deren Interpretation (Methodenkompetenz) sowie das Vermögen, die Resultate mit den im Unterricht erworbenen fachspezifischen Sachverhalten zu verknüpfen, um die erkannten Zusammenhänge und Verläufe darzulegen (Narrationsbildung), verfolgen sowohl die EPA als auch deren österreichische Mutation mit Aufgaben zum AFB II. Ein feiner Unterschied findet sich in der Bewertung der Fähigkeit zur Sachurteilsbildung. Während die EPA explizit eine Triftigkeitsprüfung verlangt und somit Sachurteile zu Aussagen des Materials anstrebt (Sachverhalte sind einzuordnen und Zusammenhänge zu erklären), genügt der österreichischen Fachdidaktik die schlüssige Erläuterung der erhobenen Inhalte. Das kann zu einem Sachurteil führen, aber auch zum Verweilen auf der Ebene der Reproduktion. Dissens herrscht in der Bewertung des AFB III. Während die EPA eine reflektierende Urteilskompetenz nachgewiesen haben möchte, wünscht die Auslegung der österreichischen Fachdidaktik zudem die Bestätigung über das Vermögen, Hypothesen bilden zu können und Handlungsdispositionen erkennbar werden zu lassen. Zentrales Element beider Zugänge ist die Fähigkeit zur Reflexion. Gemeinsam ist beiden Varianten das Bestreben, die Domäne des Historischen erschließen zu wollen. Sie unterscheiden sich im Zugang dazu, in der Intensität und im Aufbau des Erkenntnisprozesses. Während es FUER um die Progression definierter Kompetenzbereiche geht, die in einer modellierten Zusammenschau historisches Denken und die Formung von Geschichtsbewusstsein ermöglichen, folgen die EPA-Kriterien prozesshaft den Zielsetzungen der „Jeismann-Trias“. Dabei werden die historischen Denkvorgänge in einzelne Operationen zerlegt, die wiederum Dimensionen bestimmter Kompetenzen offenlegen und von Schritt zu Schritt mentale Prozesse anstoßen, die in der reflektierten Urteilsbildung kulminieren. In der EPA werden die Jeismann-Schritte mit den Anforderungsbereichen gleichgesetzt: Analyse (AFB I), Sachurteil (AFB II) und Werturteil (AFB III). Zwar werden dadurch auch Teilkompetenzen nach FUER offengelegt, aber nicht gezielt evoziert, um das Verfügen über (FUER-)Kompetenzen zu messen. Sie müssen indirekt erschlossen werden. Der Transfer der Kandidat*innen-Aussagen von AFB auf FUER-Teilkompetenzen ist demnach die Aufgabe, sie kann über die Operatoren gelingen. Der Befund hat nolens volens fragmentarischen Charakter, denn es ist mit dem EPA-Prüfungsdesign unmöglich, alle Kompetenzbereiche des FUER-Modells sichtbar zu machen. Außerdem fehlt deren Integration.