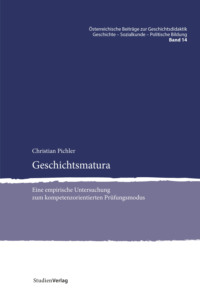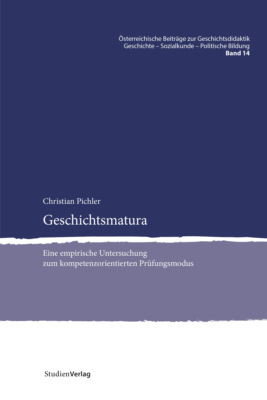Kitabı oku: «Geschichtsmatura», sayfa 7
3.2 Kompetenzgraduierung nach FUER
3.2.1 Graduierungslogik und Graduierungsparameter
Die unbefriedigenden Resultate bei der Suche nach Graduierungsparametern im Umfeld der empirischen Forschung, der Fachdidaktik Geschichte und politischen Bildung sowie der praktischen Vermittlungsarbeit führten innerhalb der Gruppe FUER zur Erkenntnis, dass die Entwicklung eines speziellen, am Kompetenz-Strukturmodell ausgerichteten Graduierungssystems unumgänglich war, wollte man den Ansprüchen des eigenen Modells genügen. Den wegweisenden Impuls dazu lieferte die konstruktivistische und entwicklungspsychologisch beeinflusste Unterscheidung von Stufen historischen Denkens bei Dagmar Klose,367 deren Modell auf ein Stufungssystem von Lawrence Kohlberg rekurriert.368 Laut Körber beschreibt Klose drei Stufen historischen Denkens: (1) „Präkonventionelles historisches Denken“ meint die „Homogenisierung von historischen und lebensweltlichen Urteilen unter Dominanz des lebensweltlichen Konzepts.“369 Körber ortet hierin das Fehlen einer Unterscheidung von Gegenwart und Vergangenheit.370 (2) „Konventionelles historisches Denken“ meint „(…) Historisierung: Orientierung im historischen Kontext“.371 Die Konvention folgt aber nicht dem Zeitbegriff, sondern genetischem Denken. Das sei als Basis historischen Denkens problematisch, denn es werde die „[…] Gültigkeit des westlich-genetischen Sinnbildungstyps als universale Konvention […]“372 voraussetzt, was (zu) wenige Sinnbildungen zulasse. (3) „Postkonventionelles historisches Denken“ sei definiert, die Kriterien für die Einstufung würden aber unklar sein und somit ist die Beschreibung nicht brauchbar. Zur Anwendung auf die Erfordernisse des Kompetenz-Strukturmodells von FUER hält Körber Kloses Modell für ungeeignet, weil es allgemein, umfassend und „grundlegend entwicklungslogisch konzipiert ist“.373 Sein Wert liegt darin, FUER gezeigt zu haben, dass Stufungen von Niveaus historischen Denkens nicht naturgegeben sind,374 sondern als kulturelle Formungen verstanden werden können.375
Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse gingen die Wissenschaftler der Gruppe FUER daran, ein eigenes Graduierungssystem zu erarbeiten. Es wurde festgelegt, dass das Konzept nicht Entwicklungen darstellen soll, sondern die „Logik der Unterscheidung von Niveaus“.376 Ihre Folgerichtigkeit und Schlüssigkeit sollte den „gemeinsamen Graduierungsparameter“ ausmachen. Man einigte sich weiters darauf, in Anlehnung an Kohlberg und Klose, fünf Niveaus zu definieren. Es wurden zwei ideelle, realiter nicht existente „Begrenzungsniveaus“ („Nullniveau“ und „Maximalniveau“), und drei „Grundniveaus“ („basales Niveau“, „intermediäres Niveau“ und „elaboriertes Niveau“) mit Zwischenniveaus beschrieben377 (Tabelle 2). FUER hat den Zugang zur Graduierung gewählt, „[…] die Niveaus der Kompetenzen nach der Art und Weise der Verfügung über gesellschaftliche Konventionen ihrer Ausprägung […]“378 zu differenzieren.
Ausgangspunkt der Niveaustufen-Beschreibung ist die Überlegung, dass Denkende prinzipiell über alle historischen Kompetenzen verfügen, deren Qualität aber unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Das „Nullniveau“ ist de facto inexistent, weil jede Form der Beschäftigung mit Vergangenem Denkprozesse auslöst und jeder mentale Vorgang über null hinausgeht. Ein „Nullniveau“ wäre nur dann „erreicht“, wenn es keinen einzigen wie immer gearteten Gedanken gibt, was selbst bei einem Kleinkind kaum der Fall ist. Die Beschreibung dieser Niveaustufe dient der Abgrenzung des folgenden basalen Niveaus nach unten.
„Basales Niveau“ wird nicht – wie bei Klose – als prä-konventionell bezeichnet, sondern FUER verwendet die Definition „a-konventionell“, weil historisch Denkende hier gesellschaftlich übliche Formen des Verfügens über Konzepte, Kategorien, Operationen und Verfahren nicht erreichen, sondern situativ bedingt eigene, spontan entwickelte und nicht an Systematiken gebundene Konzepte etc. parat haben und nutzen. Die mentalen Prozesse sind fragmentarisch ausgeprägt. Es gelingt, bei Fragen an die Vergangenheit zwar Unterscheidungen in zeitlicher Hinsicht zu treffen und Schlussfolgerungen aus der Beschäftigung mit der Vergangenheit zu ziehen, die Vorgänge geschehen aber nicht auf der Ebene allgemein anerkannter Konzepte. Denkleistungen anderer werden kaum in persönliche mentale Prozesse integriert und Kommunikation über eigenes Denken erfolgt nicht. Kennzeichen basalen Niveaus sind Spontaneität und unsystematische, nicht gefestigte Denkvorgänge ohne Rückgriff auf allgemein anerkannte Verfahren. Die Entwicklung vom basalen Niveau Richtung intermediäres erfolgt mittels aktiver Suche nach Konzepten und deren Erprobung, indem man eigene Konzepte mit denen der Gesellschaft abgleicht. Die Zwischenstufe ist getragen vom Wunsch, das gesellschaftlich übliche Verständnis zu erreichen und die Fähigkeit zu erlangen, eigenständige Einsichten in Konzepte, Begriffe und Operationen zu integrieren und zu systematisieren.379 Körber nennt das, was in dieser Intervallphase erreicht werden kann, „Niveaus partieller und unvollständiger Konventionalität“.380
Auf „intermediärem Niveau“ ist man in der Lage, anerkannte Konzepte, Kategorien und Operationen anzuwenden und das eigene historische Denken auf sie zu beziehen. Man kann persönliches Orientierungsinteresse und daraus erwachsende Fragen selbstständig bearbeiten und Aussagen sowie Deutungen nachvollziehen. Kennzeichnend für intermediäres Niveaus ist die Eigenständigkeit beim Umgang mit Verfahren. Sobald Individuen in der Lage sind, sich partiell von Konventionen zu lösen und singuläre Erkenntnisbedürfnisse, die nicht in ein bekanntes Konzept passen, autonom zu befriedigen, wird der Weg zur nächsten Stufe eingeschlagen. In dieser Intervallphase erkennt man die Konventionalität eigener Begriffe, Konzepte, Kategorien und Operationen und sucht bereits nach persönlich konstruierten Alternativen, kann sie aber noch nicht in allen Bereichen selbstständig entwickeln, verändern bzw. fundiert kritisieren. Man hat die „Niveaus partieller Konventionsreflexion“381 erreicht, eine Zwischenstufe auf dem Weg zu elaborierten Niveaus. Das Individuum „[…] wird mit seinem Denken dadurch passiv wie aktiv anschlussfähig.“382 Idealtypische Konventionen werden in dieser Phase zumindest partiell überschritten.
Haben historisch Denkende schließlich „elaboriertes Niveau“ erreicht, verfügen sie über die gesellschaftlich üblichen Formen von Konzepten, Kategorien, Operationen und Verfahren, sind bereit, sie anzuwenden und haben erkannt, dass sie keine feststehenden Regeln, sondern Übereinkommen sind, deren Limitationen man begründet verändern kann. Kennzeichen dieser Niveaustufe ist die Fähigkeit zu kritisieren, abzuwandeln, neu zu formieren, sich zu distanzieren und über sie und ihre Funktion nachzudenken. Dazu tritt das Vermögen zur Entwicklung und Anwendung eigenständiger Verfahren, die Kommunikation und der Diskurs darüber.
Das „Maximalniveau“ ist, ähnlich dem Nullniveau, eine Begrenzung, die es in der Realität nicht gibt. Es ist insofern illusionär, als es das Verfügen über historische Kompetenzen beschreibt, „[…] die ein idealer historisch Denkender aufweist“.383 Es meint die vollständige Ausbildung historischen Denkens, die umfassende Lebens- und Orientierungserfahrung. De Facto handelt es sich dabei um ein utopisches theoretisches Limit. „Ein unteres ‚Null‘-Niveau oder gar ein oberstes Niveau, bei dessen Erreichen keine Fortentwicklung mehr möglich wäre, lassen sich wohl nur theoretisch denken, aber empirisch nicht finden.“384 (Tabelle 1).
Es ist darauf hinzuweisen, dass nach den Vorstellungen von FUER die entscheidenden Adaptionen zwischen den Niveau-Stufen während des Unterrichts erfolgen, also den Lernprozess markieren385 und dass die Graduierung nicht Standardsetzung bedeutet. Es gehe um die diagnostische Erfassung von Unterrichtsentwicklungen, damit es gelingt, den Kompetenzaufbau qualitativ gesichert zu gestalten. Graduierung ist als Hilfsmittel für die Planung von Unterricht zu verstehen, denn die Niveaubeschreibungen liefern Lehrer*innen Kriterien, aber keine umfassende Darlegung zu erreichender „Zustände historischen Denkens“.386 Allfällige Standardisierungen auf der Basis des Struktur-Modells müssten erst eingehend fachlich und bildungspolitisch diskutiert werden.387 Daher sind die dargestellten Kompetenzniveaus keine Input-Regelungen, sondern „Minimalkriterien im Sinne der Output-Orientierung“.388 Der Begriff „Konventionen“ meint „gesellschaftlich übliche(n) mentale(n) Instrumente(n) zur Erfassung und Deutung sowie Kommunikation von Phänomenen der geschichtlichen Welt mit je spezifischen Stärken und Schwächen, Reichweiten und Grenzen.“389 Deutlich sollte werden, dass kompetenzorientierte Aufgaben nicht nach dem Schema „erfüllbar“ versus „nicht erfüllbar“ zu konstruieren sind, sondern dass eine „Erfüllung auf verschiedene Weise“ möglich sein muss. Die Art der Lösung ist der Indikator des Kompetenzniveaus. FUER erwartet im Falle des Gelingens einer Reflexion darüber die Entwicklung praktikabler didaktischer Konzepte, Ansätze einer Individualdiagnostik und das Ermöglichen professioneller Systemevaluation. Daher versteht FUER die Niveaubeschreibungen nicht als Endpunkt der Kompetenzentwicklung, sondern als Türöffner für den Weg der Kompetenzorientierung in die Unterrichtspraxis.390 Die Graduierungstheorie hat die Kompetenzbereiche, Orientierungs-, Methoden- und Sachkompetenz konkretisiert. Das wird nachfolgend dargestellt.
| Parameter | Niveaustufe I | Niveaustufe II | Niveaustufe III |
| Formale Logik der Niveau-Unterscheidung | basal | intermediär | elaboriert |
| Konkrete Logik der Niveau-Unterscheidung | a-konventionell | konventionell | trans-konventionell |
| Definition | Keine Kenntnis von Konventionen, keine Standardisierungen | Kenntnis und Nutzung der Konventionen, es gibt Standardisierungen | Hinterfragen und Überschreiten von Konventionen |
| Indikatoren | Spontanität, fehlende Systematik | Anwendung gängiger Methoden und Muster | Eigenständigkeit, Plausibilität |
| Überprüfung | keine | Standardisierte Aufgaben samt Erwartungshorizont | Nicht standardisierte Aufgaben |
Tabelle 1: Logik der Niveau-Unterscheidung (Quelle: Körber et. all.: Kompetenzen, S. 465).
3.2.2 Graduierung der Orientierungskompetenzen
Die Orientierungskompetenz weist auf den tieferen Zweck historischen Denkens hin. Sie beschreibt Fähigkeiten, Fertigkeiten und Bereitschaften, mentale Vorgänge lebensweltlich wirksam zu machen. Das manifestiert sich in der Identität des Individuums, die sich dessen Gegenwärtig-Sein verdeutlicht. Kann sich der Mensch in ein Kontinuum einordnen und den eigenen Standort bestimmen, den anderer reflektieren und kritisch nachdenken, was sein Tun in Gegenwart und Zukunft bewirkt, dann verfügt er über Orientierungskompetenz.391 Körber meint, in diesem Fall gelinge es, Erkenntnisse nutzbar zu machen und den Schritt vom „[…] case-knowledge zu operablem Wissen“392 zu tun. In der Logik des Kompetenz-Strukturmodells ist „Orientierung“ zwar das finale Produkt mentaler Prozesse historischen Denkens, das bedeutet aber nicht, dass diese Kompetenz „höherwertiger“ ist, zumal Orientierung bei jeder Anwendung jeder Art von Kompetenz auf jeder Stufe der Entwicklung erfolgt. Der Graduierungsparameter ist daher, „[…] in welcher Art und mit welchem Reflexionsgrad derartige Bezüge hergestellt werden“.393 Orientierungskompetenz verlangt nicht die permanente Revision eigener Geschichtsbilder, aber eine reflektierend-kritische Haltung samt der Bereitschaft, bei plausiblen neuen Einsichten, Änderungen vorzunehmen. Auch eine begründete Nicht-Änderung ist Ausdruck hoher Kompetenz.394 Es werden vier Teilkompetenzen unterschieden:
Re-Organisation des Geschichtsbewusstseins:
Dabei handelt es sich um die „Kompetenz zum Umbau des Geschichtsbewusstseins“.395 Sie kann sowohl Folge der Bearbeitung historischer Fragen (methodengeleitete Erkenntnis) als auch einer Metareflexion (z. B. Diskussion) sein. Beide Vorgänge können zu Ergänzungen, Erweiterungen und Differenzierungen des Geschichtsbewusstseins führen. Ihre Anwendung, dürfte eine Zunahme der Fähigkeit des selbstständigen Umgangs mit historischen Fragestellungen und zur Analyse lebensweltlicher Erfahrungen bewirken. Entscheidend für den Grad der Kompetenzentwicklung ist die Bereitschaft zu Veränderung und die Beherrschung von Mechanismen der Umstrukturierung eigener Geschichtsvorstellungen.396
Das „Nullniveau“ beschreibt die völlige Unfähigkeit und die fehlende Bereitschaft, das Geschichtsbewusstsein zu revidieren. Das kommt de facto nicht vor, denn bei jedem Denkvorgang über Vergangenes oder Geschichte gibt es automatisch Abläufe des Ineinandergreifens von Denkprozessen mit eigenen Erfahrungen. So entstehen „subjektive Geschichten“,397 die bereits über dem „Null-Niveau“ angesiedelt sind. Auf „basalem Niveau“ besitzt man die Erkenntnis, dass historisches Denken Auswirkungen hat, wobei Denkprozesse weitgehend folgenlos bleiben. Gesellschaftlich anerkannte (Denk-)Verfahren werden nicht in Anspruch genommen, die mentalen Prozesse verlaufen unsystematisch und spontan, situativ, vielfach zufällig. Aber es ist die grundsätzliche Fähigkeit und Bereitschaft erkennbar, Erkenntnisse aus historischem Denken mit dem eigenen Repertoire an Prinzipien, Kategorien, Konzepten und Verfahrens-Scripts in Beziehung zu setzen, also Geschichtsbewusstsein zu verändern. Auf „intermediärem Niveau“ suchen Denkende aktiv nach anerkannten Verfahren und sind bereit, sich diese anzueignen, sie zu erschließen und nicht-konventionelle Vorstellungen durch konventionelle zu ersetzen, sowie darüber zu kommunizieren. Eine Revision des Geschichtsbewusstseins erfolgt nach konventionellem Muster (z. B. durch Lesen von Fachliteratur, Nutzung von Expertenwissen, anerkannten Institutionen etc.). Auf diesem Niveau sind Menschen in der Lage, historische Fragen zu beantworten, sich in der Vergangenheit zurecht zu finden und Orientierung für Gegenwart und Zukunft zu lukrieren. „Elaboriertes Niveau“ weist die Fähigkeit nach, auf der Basis bestehender Erkenntnisse, Geschichtsbewusstsein selbstständig um neue Dimensionen zu erweitern, die eingeübten Formen des Lernens zu überschreiten und so in einen Bewusstseinszustand zu geraten, in dem gesellschaftliche Konventionen das Denken nicht mehr dominieren. Deren Überschreiten hat um der Erkenntnis willen zu geschehen. Zudem bedarf es der Bereitschaft, sein Geschichtsbewusstsein auch auf die Gefahr hin zu verändern, dass das Ergebnis der Forschungen keine Anerkennung findet. Körber weist darauf hin, dass dieser Grad der Fähigkeit Geschichtsbilder zu re-organisieren hauptsächlich in der Geschichtswissenschaft und bei geschichtskulturellen Be- und Verarbeitungsformen historischer Fragen vorgefunden wird. Elaboriert ist der Umgang mit einem historischen Thema auch dann, wenn daraus Fragestellungen erwachsen, aus denen „[…]eigenständige, neue, die gesellschaftliche Diskussion erweiternde Konzepte und Kategorien entstehen und für das eigene (wie das gesellschaftliche) Handeln Bedeutung erlangen können […]“.398 Das betrifft auch den Umgang mit Geschichtspolitik, Erinnerungskultur, Vergangenheitspolitik etc.399
Revision des Welt- und Fremdverstehens:
Die Teilkompetenz „Welt- und Fremdverstehen“ beschreibt die Fähigkeit und Bereitschaft, konkrete Vorstellungen über Vergangenheit, Zusammenhänge in der Vergangenheit und zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu überprüfen und die daraus erwachsenen Geschichtsbilder eventuell zu revidieren. Dazu ist es nötig zu erkennen, welche Operationen zu eigenen Urteilen geführt haben und wie die Beziehung zwischen altem und revidiertem Geschichtsbild aussieht. Auch in diesem Fall bestimmt nicht eine vermeintliche Qualität des Geschichtsbildes das Niveau, sondern die Bereitschaft, die Revisionsnotwendigkeit von Vorstellungen aufgrund neuer Erkenntnisse als Haltung sich zu eigen zu machen. Das gelingt, wenn der Denkende um die Historizität der bis dahin dominanten Geschichtsauffassung weiß. Die Konfrontation mit eigenen Werten und Normen, persönlichen Vorstellungen über Vergangenheit und Gegenwart, eigenen Handlungsweisen und mit dem Verständnis für deren Geworden-Sein im Zuge der Sozialisation ist die Voraussetzung dafür, eine Haltung prinzipieller Revisionsbereitschaft für Geschichtsauffassungen aufzubauen.400 So könne man „[…]zu einem eigenen Verhältnis zwischen Anerkennung des Vergangenen und sicherem gegenwärtigen Urteilsvermögen gelangen“.401
Auf „Nullniveau“ findet keine Veränderung des Urteils über Welt und Menschen durch neue Erkenntnisse, keine Differenzierung und somit kein (historisches) Denken statt. Auf „basalem Niveau“ gibt es kleinere Änderungen, etwa durch additive Erweiterung des Wissens, verbunden mit raschen Urteilen.402 Es entsteht zwar ein „[…] Spannungsverhältnis von alten und neuen Informationen […]“,403 aber es gibt keine Auseinandersetzung damit. „Intermediäres Niveau“ ist erreicht, sobald konventionelle Instrumente der Urteilsfindung genutzt und die Ergebnisse von Denkvorgängen dazu verwendet werden, plausible Deutungen zu formulieren. Auf diesem Niveau haben Denkende die Fähigkeit, sich Denkmuster anzueignen, zu verstehen, kritisch zu prüfen und mit deren Hilfe Urteile zu bilden. Auf „elaboriertem Niveau“ gelingt es, die konventionellen Instrumente und Muster zu reflektieren und zu differenzieren und über sie hinauszugehen, also „[…] eigenständige differenzierte Deutungen in das eigene Geschichtsverständnis […]“ einzubauen. Es ist nicht der Inhalt oder der Umfang des Wissens entscheidend, „[…], sondern die Art und Weise, zu einem neuen Weltbild zu gelangen.“,404 also das selbstständige Entwickeln von plausiblen Deutungen.405
Revision und Reflexion historischer Identität:
Die Anwendung dieser mentalen Operation ist ein Akt der Identitätsbildung, der wirkmächtig wird, sobald es, laut Paul Ricoer,406 gelingt, einen narrativen Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Identitätskonstruktionen herzustellen. Konkret bedeutet das die Reflexion des eigenen Standpunktes bei Vorgängen der Re-Konstruktion und die kritische Würdigung der vorhandenen Angebote im Falle von De-Konstruktion. Beide Wege können zu einer partiellen Revision eigener Identität führen.407
Auf „Nullniveau“ sieht man sich nicht zeitlich verortet, es fehlt jeglicher Bezug zur genuin historischen Kategorie Zeit, sodass die Konfrontation mit Geschichte folgenlos bleibt. „Basales Niveau“ ist erreicht, wenn man spontan, unsystematisch, partiell reagiert, sobald man mit einer historischen Narration in Beziehung tritt. Es gibt keine Anwendung von Konventionen, eine eventuelle Zuordnung zu einer „Wir-Gruppe“ wird als gegeben angenommen. Auf „intermediärem Niveau“ wird die Zuordnung zur „Wir-Gruppe“ zwar weiterhin als feststehend empfunden, ein Wechsel aufgrund historischer Narrationen kommt jedoch in Betracht, sofern diese alternative, aber fest gefügte Modelle anbieten. Diese Niveaustufe beschreibt die Fähigkeit, eine Gruppe zu tauschen, nicht aber beide miteinander zu etwas Neuem zu verknüpfen. Auf „Elaboriertem Niveau“ vermag man konventionelle Formen auf Sinnhaftigkeit und Plausibilität hin zu überprüfen, Differenzen und Widersprüche zu erkennen und zu benennen und gegebenenfalls neue Formen der Identitätskonstruktion zu bilden.408
Historische Reflexions- und Handlungskompetenz:
Da der Umgang mit Geschichte nichts Passives sein soll, meint die Teilkompetenz die Möglichkeiten der Reflexion des gegenwärtigen Handelns, dessen Ausrichtung auf die Zukunft und gegebenenfalls die Revision des Handlungs-Repertoires bzw. der Dispositionen. Das betrifft das Zugreifen-Können auf historische Handlungsvorbilder und die Begründung des eigenen Tuns mit Hilfe historischer Deutungs- und (oder) Sinnmuster. Wesentlich ist das Bewusst-Werden von Bedingungen, Intentionen und Strategien und die Einsicht, dass Handlungsdispositionen (und das Handlungsrepertoire) veränderbar sind.409
Im Fall des „Nullniveaus“ gibt es weder eine Handlungsdisposition noch ein Handlungsrepertoire. Auf „basalem Niveau“ wird zwar agiert, man sucht aber bloß nach Rechtfertigungen für sein Tun. „Intermediäres Niveau“ ist erreicht, wenn das Individuum die „[…] Eignung von Geschichte als handlungsleitendem Erfahrungsraum mit Hilfe gesellschaftlich anerkannter Argumente […]“410 wahrnimmt und mit gesellschaftlich üblichen Methoden („Fachwissen“) nach Vorbildern Ausschau hält. „Elaboriertes Niveau“ weiß um gesellschaftliche Begründungen für historische Fundierung des Handelns. Denkende Individuen vermögen es, die Argumente hinsichtlich ihrer Konsistenz, ihrer Plausibilität und ihres Interessenausrichtung kritisch zu überprüfen. Schreiber unterstreicht, dass die Graduierung der Orientierungskompetenz das Überschreiten der Wissensdimension über Vergangenes durch historisches Denken und ihre Identitäts- und Handlungsrelevanz für das Individuum deutlich macht.411