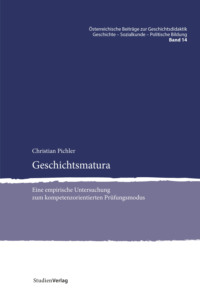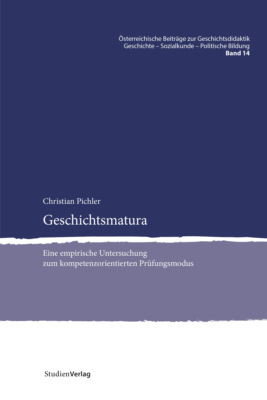Kitabı oku: «Geschichtsmatura», sayfa 8
3.2.3 Graduierung der Sachkompetenzen
Unter Sachkompetenzen versteht FUER „Begriffskompetenz“ (Begriffskonzepte und deren sprachliche Bezeichnung) und „Strukturierungskompetenz“. Letztere umfasst epistemologische Prinzipien (Retro-Perspektivität, Partikularität, Konstruktivität), subjektbezogene Konzepte (Alterität, Identität), inhaltsbezogene Kategorien (Zeit und aus Nachbarwissenschaften entlehnte Kategorien) und methodische Verfahrens-Scripts (Heuristik, Re- und De-Konstruktion).412
Historische Begriffskompetenz:
Das Konzept Begriffskompetenz umfasst den Begriffsinhalt (Intension) und den Bezug zur außersprachlichen Realität (Extension). Die Kompetenz beschreibt die Fähigkeit und Fertigkeit im Umgang mit der historischen Logik zur Bildung, Ausdifferenzierung und Verwendung historischer Begriffe (Definition, Bezeichnung und semantische Netze) sowie die prozedurale Komponente, die Fähigkeit und Fertigkeit die Kategorie „Zeit“ auf historische Begriffe anzuwenden.413
Auf „Nullniveau“ fehlt jede Form von Ausprägung der Kompetenz. Das Individuum verfügt nicht über historische Termini. Stattdessen gebraucht es lebensweltliche Begriffe zur Bezeichnung historischer Phänomene, es mangelt an der Bereitschaft, sich diese Kenntnisse anzueignen und sie zu reflektieren. „Basales Niveau“ ist erreicht, wenn die entsprechenden Regeln (noch) nicht bewusst sind, sodass der Umgang mit Konventionen unmöglich ist, trotzdem aber sporadisches, unsystematisches und ansatzweises Verwenden historischer Begriffe auftritt. Es gibt demnach eine vage Kenntnis einzelner, individuell bekannter oder gruppenspezifischer Termini, ein ansatzweises Erkennen der Begriffskonzepte und ein situativ bedingtes Vermögen, Begriffe intensional und extensional zu gebrauchen. Auf „intermediärem Niveau“ können Konventionen adäquat, routiniert und selbstständig genutzt werden und es wird allmählich eine Überschreitung der Konventionen sichtbar. Wenn es bewusst geworden ist, dass Konventionen Werkzeugcharakter aufweisen und Konstrukte sind, die mittels Reflexion revidiert werden können und dass sie nach individueller Entscheidung zu nutzen sind (sofern die Triftigkeit für den eigenen Gebrauch geprüft worden ist), hat man „elaboriertes Niveau“ erreicht. Das „Maximalniveau“ ist auch in diesem Fall theoretischer Natur und ein fiktiver Abgrenzungswert.414
Historische Strukturierungskompetenz:
Die Graduierung der Strukturierungskompetenz nimmt die Fähigkeiten und Fertigkeiten des Verfügens über möglichst ausdifferenzierte Strukturierungslogiken, die Herausbildung der Fähigkeit zur domänenspezifischen Wendung nicht fachlicher Strukturierungssysteme und die Bereitschaft, die Strukturierung einerseits auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen vorzunehmen, andererseits kritisch zu reflektieren, in den Blick.415
Auf „Nullniveau“ fehlt jede Form der Ausprägung der Kompetenz. Es gibt kein Verfügen über Strukturierungswissen und keine Fähigkeit, alltagweltliche Strukturierungssysteme historisch zu wenden. Im „basalem Niveaubereich“ gibt es zwar die Kenntnis über einfache, domänenspezifische Strukturierungselemente, aber nur eine limitierte Fähigkeit, sie untereinander zu vernetzen. Es bedarf der Anleitung dazu. Eigene Strukturierungsvorgänge sind eher nachahmend. Ist ein Bewusstsein über die Bedeutung domänenspezifischer Strukturierungselemente entstanden und wird das Wissen darüber schematisch und routiniert angewendet, ist „intermediäres Niveau“ erreicht. Konventionen werden zwar als absolut angesehen, der Transfer auf andere Räume, Kulturen und Epochen ist aber möglich, wenn auch wenig reflektiert ausgebildet. Das „elaborierte Niveau“ ist durch vernetzte Anwendung von Strukturierungen und durch den Einsatz alternativer Elemente gekennzeichnet. Aus der Reflexion konventioneller Strukturierungen entsteht das Bewusstsein, dass deren Trennschärfe gering ist, dass sie hinterfragt und verändert werden können und daher als Hilfsmittel und Werkzeuge anzusehen sind. Das „Maximalniveau“ meint die umfassende domänenspezifische Strukturierungsfähigkeit auf allen Abstraktionsebenen, ein Ideal.416
3.2.4 Graduierung der Methodenkompetenzen
Teilkompetenz Re-Konstruktion:
Die Gruppe FUER stellt die Graduierung der Methodenkompetenz wegen der hohen Zahl denkbarer Verfahren exemplarisch anhand der Basisoperation Re-Konstruktion dar. Sie wurde deshalb gewählt, weil die dafür benötigten Fähigkeiten den Prozess der Erstellung einer historischen Aussage („Narration“) steuern. Zur Entwicklung einer Erzählung bedarf es dreier Komponenten: Fragestellung, Interpretation und Kontextualisierung. Initiiert wird der Prozess durch eine Fragestellung, die die Erschließung des Vergangenen mittels Quellen unter Bezugnahme auf Forschungsergebnisse (Darstellungen) einleitet und in die Konstruktion einer Geschichte mündet. Die Erzählung muss triftig sein, ergo empirisch abgesichert, normativ akzeptabel und plausibel. Die Graduierung hat das Zusammenwirken der Elemente im Prozess zu berücksichtigen.417
Auf „Nullniveau“ befindet sich ein Individuum, wenn ihm nicht bewusst ist, dass Quellen Informationen über Vergangenes liefern, aber keine Fähigkeit oder Bereitschaft besteht, anhand der Relikte Fragen an die Vergangenheit zu richten und mit Hilfe der Erkenntnisse sinnbildende Erzählungen zu konstruieren. Es gelingt nicht, Geschichte zur eigenen Orientierung zu verwenden. Das „basale Niveau“ ist erreicht, wenn einzelne Aussagen von Quellen erkannt und genutzt werden. Es wird nicht zwischen Informationen aus Quellen und Fachliteratur bzw. Produkten der Geschichtskultur unterschieden. Fragen an das Material werden unspezifisch gestellt, kaum reflektiert und sind nicht zwingend an ein Orientierungsbedürfnis gebunden. Daher haben sie auch nicht notwendigerweise das Ziel, eine verfahrensgeleitete Bearbeitung des Materials anzuleiten, der Orientierungsnutzen für die Gegenwart ist limitiert. Auf „intermediärem Niveau“ befindet sich das Individuum, sobald es über einen konsistenten Quellenbegriff verfügt und die Quellen, unter Berücksichtigung ihrer gattungsspezifischen Merkmale, inhaltlich selbstständig auswerten kann. Dazu bedarf es der Fähigkeit, Fragen erkenntnisleitend zu stellen und sich über deren Perspektivität sowie die Partikularität der erwarteten Ergebnisse im Klaren zu sein. Aus ihr erwächst die Fertigkeit, Inhalte analytisch zu erheben und sie mit Hilfe der Ergebnisse der Forschung zur Konstruktion einer Narration heranzuziehen. Es wird das Bewusstsein evident, dass historische Erzählungen Konstrukte sind. „Elaboriertes Niveau“ ist erreicht, sobald der konventionelle Quellenbegriff relativiert, der Nutzen und der Charakter der Quelle selbstständig eingeschätzt und das Material autonom erschlossen werden kann. Nötig ist die Fähigkeit, Fragen so zu stellen, dass das Erkenntnisinteresse eine Reflexion eigener Identität und persönlichen Weltverständnisses ermöglicht. Es erwächst die Einsicht, dass unterschiedliche Kontextualisierungen erfolgen können, die differente Narrationen zur Folge haben. Wesentlich sind Bezüge zum Orientierungsbedürfnis und Triftigkeit.418
Kontextualisierungs- („Narrations“-) Kompetenz:
Das Vermögen, Geschichte sinnbildend zu erzählen, wird von FUER nicht als eigener Kompetenzbereich gesehen, sondern als eine Fähigkeit und Fertigkeit der Re-Konstruktionskompetenz. Laut FUER berührt das alle Kompetenzbereiche. Im Fokus der Kontextualisierungsfähigkeit steht das Vermögen, für die Konstruktion eigener historischer Erzählungen den Forschungsstand und die Ergebnisse von wissenschaftlicher Material-Analysen kritisch reflektierend zu berücksichtigen und das Resultat mit den Ergebnissen eigener De-Konstruktionsvorgänge sinnbildend zu einer historischen Erzählung zu verbinden. Für deren Erstellung sind die Wahl der Gattung, die Berücksichtigung der epistemologischen Prinzipien und die Triftigkeit der Erzählung von Bedeutung.419
Auf „Nullniveau“ befindet sich die Fähigkeit der Kontextualisierung bzw. Narrationsbildung, wenn kein Bewusstsein über die Notwendigkeit der Einbeziehung von Aussagen von Quellen und Darstellungen in die eigene Erzählung vorhanden ist. Historische Aussagen sind Zufallsprodukte ohne Orientierungsbedürfnis und leitende Fragestellung. „Basales Niveau“ ist erreicht, wenn Informationen aus Quellen oder Darstellungen willkürlich für die eigene Erzählung herangezogen werden, wobei zwischen den beiden Kategorien nicht unterschieden wird und die Auswahl der Inhalte eher zufällig erfolgt. Die Narration hat fragmentarischen Charakter und ist ansatzweise plausibel. Auf „intermediärem Niveau“ entsteht ein denkmögliches Produkt der Sinnbildung, wenn es unter einer Fragestellung steht, einem Orientierungsbedürfnis folgt, eine Gattung nutzt und sich das Individuum der Partialität und Perspektivität des verwendeten Materials bewusst ist. Fachbegriffe werden korrekt verwendet, eine Geschichte wird schlüssig erzählt. „Elaboriertes Niveau“ ist erreicht, sobald die Theorie Einfluss auf die Konstruktion der Erzählung nimmt und es gelingt, die Triftigkeit der Narration, gemessen an der Fragestellung und der Intention, nachzuweisen. Außerdem müssen Bereitschaft und Fähigkeit gegeben sein, Ergebnisse und Konsequenzen zu diskutieren sowie alternative Perspektiven und daraus erwachsene Erzählungen kritisch zu reflektieren. Es gibt die Einsicht, dass Vergangenes bei unterschiedlicher Kontextualisierung differierende triftige Narrationen zur Folge haben kann, weil es einen ursächlichen Konnex zwischen Fragestellung und Art der Kontextualisierung gibt. Ein „Maximalniveau“ wurde nicht beschrieben.420
3.2.5 Kritik an der Graduierungstheorie von FUER
Im Zentrum der fachlichen Kritik steht das von FUER selbst eingeräumte Fehlen einer Systematisierung der Lernprogression. Heil würdigt den ausdifferenzierten Graduierungsparameter (Komplexität, Reflektiertheit, Reflexivität, Bewusstseinsgrad, Abstraktion, Selbstständigkeit, Transferweite, Validität, Schematisierung) und die Niveau-Beschreibungen als „richtungsweisend“. Sie seien allgemein ausgeführt und determinierten daher nicht Performanzen. Es sei sowohl eine formale als auch eine konkrete Logik dargestellt, samt Indikatoren für das Erreichen der Niveaus und Möglichkeiten einer kriteriengeleiteten Überprüfung (Operatoren). Die allgemeinen erkenntnistheoretischen Stufungsbegriffe (a-konventionell, konventionell, trans-konventionell) erscheinen ihm sinnvoll historisch konkretisiert worden zu sein. Daher biete es „[…] Kompetenzbeschreibungen, die den sachlogischen Aufbau und damit die sukzessive Entwicklung der Kompetenz deutlich machen“.421 Für standardisierbar hält er das System nicht.422 Pandel betrachtet das Feststellen von Kompetenzprogression anhand von anthropologischen Konzepten mit Skepsis. Das Geschichtsbewusstsein sei ein „[…] hoch komplexes kulturelles Konstrukt aus verschiedenen Dimensionen, die eine jeweils eigene Genese haben“,423 sodass seine Entfaltung nicht planbar ist. Außerdem könne die psychologische Entwicklung von Menschen bis zu vier Jahren differieren. Thünemann sieht die ungeklärte Frage der Kompetenzmessung als eines der vier Grundprobleme der gesamten Kompetenzdebatte an.424 Sie sei ohne die Modellierung von Wissensformen und die Lösung des Problems der Integration von Wissen in das System der Kompetenzorientierung nicht machbar. Er hält den Vorschlag von FUER, sich an Konventionen zu orientieren, in offenen Gesellschaften für problematisch.425 In radice abgelehnt wird das systematisierte Graduieren von Kompetenzen von Markus Daumüller.426 Aus seiner Sicht besteht die fundamentale Schwäche der Kompetenztheorie von FUER in der Herleitung des theoretischen Rahmens aus der Pädagogik und einer bildungspolitischen Ordnungsidee samt deren Vorstellung von Lernen. FUER ignoriere die Individualität der Persönlichkeit und damit des jeweiligen Geschichtsbewusstseins zugunsten der Herstellung einer gesellschaftlich „erwünschte (n) Mündigkeit“.427 Es gehe FUER „[…] weniger um Bildung, sondern um den Duktus von Wissenschaft, dem Bildung einfach unterstellt wird. […], ein Konzept der Planbarkeit von Bewusstseinsvorgängen und Planen wird daher unwillkürlich zum Zweck des Denkens.“428 Aus der grundsätzlichen Ablehnung des Modells ergibt sich auch die Zurückweisung der Graduierungstheorie.
4. Die kompetenzorientierte Reifeprüfung in Österreich, ein eklektizistisches Modell der Kompetenzüberprüfung?
Die abschließende Prüfung des allgemein- und berufsbildenden Schulwesens in Österreich heißt seit 2012 offiziell: „Teilstandardisierte, kompetenzorientierte Reifeprüfung“.429 Seit 1853 gilt die Matura als Berechtigungsprüfung zur Aufnahme von Studien an Akademien, Hochschulen und Universitäten. Sie attestiert den Absolvent*innen Hochschulreife, i. e. Studierfähigkeit. Aufgrund der juridischen Wirkung, aber auch wegen der Tradition und des ritualisierten Ablaufs, genießt das Examen ein hohes Ansehen in der Gesellschaft und steht in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Änderungen der Reifeprüfung sind bildungspolitisch sensible Materien.
4.1 Zur Geschichte der österreichischen Maturaprüfung
Ausgangspunkt des säkularen Bildungswesens in Österreich waren die Reformen des Ministeriums Thun-Hohenstein zur Mitte des 19. Jahrhunderts.430 Das Gymnasium war vor 1848 eine sechsjährige, meist kirchliche Bildungseinrichtung, organisiert nach dem Klassenlehrerprinzip, die mit einem Jahreszeugnis abgeschlossen wurden. Ein zentrales Anliegen der Bildungsreform 1848–1853 war es, ein zeitgemäßes staatliches Gymnasium, konzipiert auf der Grundlage des Humboldt’schen Bildungsideals, zu schaffen. An die Stelle der Klassenlehrer sollten Fachlehrer treten, die den Fächerkanon der Universitäten repräsentierten und universitär ausgebildet wurden, um die Schüler(-innen) auf ein Studium vorzubereiten. Der Unterricht wurde seit 1853 in der Muttersprache – zuvor war es Latein gewesen – erteilt und wies eine philosophische, literarische und historische Akzentuierung auf.431 Naturwissenschaften spielten zunächst keine Rolle, sie wurden in Realschulen ausgelagert, die ab 1862 sukzessive zu Realgymnasien mutierten. Die Befugnis zur Erteilung der Hochschulreife erhielten sie allerdings erst 1908. Für angehende Gymnasiallehrer wurde 1853 eine Lehramtsprüfung und das Probejahr eingeführt, für die Schüler die kommissionelle Maturitätsprüfung, die sowohl als Abschlussprüfung als auch als Berechtigungsprüfung (Studium) konzipiert wurde. Inhalts- und die Wissenszentrierung dominierten die Prüfungsgebiete. Zielgruppe der auf lange Dauer angelegten Reform war das aufstrebende Bürgertum der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, für das das Gymnasium mit Matura ein nach ethischen Gesichtspunkten (Neo-Humanismus) konzipiertes Bildungsfundament errichtete und dessen sozialen und politischen Aufstieg förderte. Kinder aus dem Bauern- oder Arbeitermilieu war es zunächst verschlossen, sieht man von kirchlichen Schulen ab, deren Ziel die Rekrutierung geistlichen Nachwuchses aus allen sozialen Schichten war.432 Die gymnasiale Matura symbolisiert über ein Jahrhundert ein attraktives Ingrediens höherer Bildung, ihr Produkt war der „Bildungsbürger“. Konzeption und rechtliche Auswirkungen haben sich als äußerst stabiles Element innerhalb des Schulsystems erwiesen. Ausgehend von den Gymnasien entfaltete die Matura eine Strahlkraft in alle Bildungsbereiche und wirkte als Vorbild für Abschlussprüfungen aller Typen des höheren Schulwesens und darüber hinaus (Abendmatura, Berufsmatura, Lehre mit Matura). Angelegt war sie auf eine strenge Überprüfung umfassender Wissens-Canones und auf Selektion, um die Besten zum Studium zuzulassen.433 Systemisch gesehen, erwies sich die Matura als Erfolgsmodell, was u. a. ihre erstaunliche Stabilität belegt. Erst 1974 wurde sie durch eine Novelle des Schulunterrichtsgesetzes (SchUG) neu geregelt.434 Zwar blieb sie im Wesentlichen in zwei Teile (schriftliche Klausuren und mündliche Prüfungen), gegliedert. Die mündlichen Prüfungsfächer waren aber von nun an aus drei Gruppen (Sprachen, Geistes- und Naturwissenschaften) zu wählen. Den Kandidat*innen wurden zwei voneinander unabhängige Wissensfragen zur Beantwortung vorgelegt. Standards für die Formulierung der Fragen gab es nicht. Sie mussten bloß dem Erfordernis genügen, den Stoffgebieten der Oberstufe zu entstammen, die wiederum den Lehrplänen zu entsprechen hatten. Formuliert wurden sie, wie 1853 verordnet, von den Lehrpersonen. Die Prüfung in einem Fach wie Geschichte dauerte zwischen zehn und 15 Minuten. Der*die klassenführende Lehrer*in der 8. Klasse war zugleich prüfendes Organ, stellte nach dem Prüfungsvorgang in einer Konferenz allen Lehrer*innen der 8. Klasse einen Benotungsantrag, der in Rechtskraft erwuchs, wenn er angenommen wurde.435 Dem Trend zur Individualisierung des Unterrichts Rechnung tragend, wurde die Matura 1986 modifiziert, indem Elemente der Individualisierung in das Prüfungsverfahren integriert wurden. Movens der Reform war die bildungspolitische Intention, die Prüfung um Aspekte selbstständiger Schüler*innen-Lernarbeit und Berücksichtigung persönlicher Interessen zu erweitern. Daher wurde die mündliche Prüfung in zwei Komplexe geteilt: Der eine hatte wissensorientierte „Kernbereiche“ (Stoffgebiete aus der Oberstufe) zum Thema. Über die ausgewählte Frage (zwei waren dem*der Kandidaten*in vorzulegen) war in ein fünf bis sieben Minuten dauerndes Prüfungsgespräch einzutreten (dialogischer Charakter). Der andere Komplex entstammte einem „Spezialgebiet“, das die Kandidat*innen im Vorfeld der Reifeprüfung selbstständig zu erarbeiten hatten. Hieraus formulierte P eine Frage, über die gesprochen zu werden hatte. Beide Fragen mussten unabhängig voneinander positiv bewältigt werden. Eine zusätzliches Individualisierungselement erwuchs aus der Reform des Unterrichts. Mit der Verpflichtung der Schüler*innen, einen „vertiefenden Wahlpflichtgegenstand“436 (WPG) zu besuchen, hatten sie eine Vorentscheidung bezüglich ihrer Reifeprüfung zu treffen, denn die Anmeldung zu einem WPG verpflichtete sie zur Absolvierung der Reifeprüfung in diesem Fach. Der Gesetzgeber ging von der Überlegung aus, dass die Bekundung eines besonderen fachlichen Interesses im Zuge der Oberstufenschullaufbahn (Wahl eines WPG) in der abschließenden Prüfung sichtbar gemacht zu werden hatte. Daher war, nebst der fachlichen Hauptprüfung, eine („Kern“-)Frage aus dem WPG zu beantworten (Wahlmöglichkeit aus zwei Fragen). Die Prüfenden beider Prüfungsteile mussten in der Folge auf einen gemeinsamen Notenvorschlag der Konferenz vorlegen. Schließlich wurden auch freiwillige Formen der Individualisierung geschaffen. Eine davon war die Möglichkeit der Abfassung einer „Fachbereichsarbeit“. Sie hatte nach wissenschaftlichen Methoden angefertigt und von einer Lehrperson betreut zu werden. Das Thema der Arbeit war zwar frei wählbar, musste aber einem Fach zugeordnet sein. Das Format galt als Element der Begabtenförderung. Eine dritte Möglichkeit selbstständiger Schwerpunktsetzung war das Absolvieren einer fächerübergreifenden Prüfung. Dazu wurden Themen formuliert, die eine Schnittmenge zweier Unterrichtsfächer aufwiesen. Die Inhalte waren durch die Schüler*innen selbstständig zu erarbeiten und zu lernen. Aus den Themenfeldern wurde von zwei Prüfenden je eine Frage gestellt, um die Fächerkombination zu repräsentieren.437 Ungeachtet der Bemühungen um Individualisierung und Spezialisierung blieb nach der Reform von 1986 die Wissens- und Inhaltsorientierung der Reifeprüfung dominierend und die Maturareform geriet in die Kritik. Einwände wurden gegen die Fachbereichsarbeit formuliert. Man beanstandete sowohl die punktuell als übertrieben empfundene Betreuung einzelner Kandidat*innen durch Lehrpersonen, die zur Abfassung von Arbeiten führte, die an universitäre Diplomarbeiten gemahnten, aber auch die gute Bewertung qualitativ und quantitativ unzureichender Produkte. An der Erarbeitung der Spezialgebiete wurde die immer wieder feststellbare oberflächliche Vorbereitung mittels neuer Medien (z. B. Wikipedia-Ausdrucke als Lerngrundlage) bemängelt, da sie dem Gedanken einer auf Fachliteratur gestützten Spezialisierung zuwiderlief. Und die fächerübergreifende Prüfung schien den Charakter eines zweckarmen Kunstproduktes aufzuweisen, da das Vorhaben der Etablierung eines fächerübergreifenden Unterrichts aus Kostengründen nicht realisiert worden war. Improvisationen prägte die Erarbeitung der Prüfungsgebiete. Die Matura galt daher als reparaturbedürftig.438