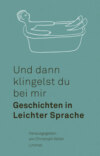Kitabı oku: «Fälle und Lösungen zum Eingriffsrecht in Nordrhein-Westfalen», sayfa 4
Konnexitätsgrundsatz
Zum Teil wird die Auffassung vertreten, dass die Vollstreckung nur dann rechtmäßig sei, wenn auch die Grundverfügung selbst rechtmäßig ist (Grundsatz der Konnexität von Grundverfügung und Zwangsanwendung).79 Andererseits wird eine strikte Trennung zwischen Primärebene (Grundverfügung zur Gefahrenabwehr) und Sekundärebene (zwangsweise Durchsetzung) vorgenommen. Dieser Auffassung folgend ist eine Vollstreckungsmaßnahme auch dann rechtmäßig, wenn sich die sofort vollziehbare Grundverfügung (nachträglich) als rechtswidrig erweist.80 Hierfür spricht einerseits der Wortlaut von § 50 Abs. 1 PolG NRW. Der Gesetzgeber hat eine solche Voraussetzung in Abs. 1 im Gegensatz zu § 50 Abs. 2 PolG NRW nicht normiert. Dort wird als Vollstreckungsvoraussetzung (im Gegensatz zum Sofortvollzug nach § 50 Abs. 2 PolG NRW) nur gefordert, dass „ein Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung hat“, die Grundverfügung also sofort vollziehbar ist.
Wenn in einer Klausur die Rechtmäßigkeit der Grundmaßnahme vorab geprüft wurde und als rechtmäßig begutachtet wurde, ist auf die Frage der Konnexität bei der nachfolgenden Prüfung der Zwangsmaßnahme nicht einzugehen. Kommt man dagegen zu dem Ergebnis, dass die Grundmaßnahme rechtswidrig war, ist bei der Zwangsprüfung auf den Konnexitätsgrundsatz einzugehen. Gleichwohl kann (trotz rechtswidriger Grundmaßnahme) die Zwangsmaßnahme rechtmäßig sein. Wird in einer Klausur ausschließlich nach der Rechtmäßigkeit der Zwangsmaßnahme gefragt (ohne dass die Rechtmäßigkeit der Grundverfügung vorab zu prüfen ist), ist auf die Frage der Konnexität einzugehen.
Zulässigkeit des Zwangsmittels (§ 51 PolG NRW)
Zwangsmittel sind in § 51 Abs. 1 PolG NRW genannt. Falls unmittelbarer Zwang angewendet wird, ist die genaue Form des unmittelbaren Zwanges darzulegen (gegen Sachen oder Personen; mit Hilfsmitteln, Waffen usw.). Probleme kann die Abgrenzung zwischen Ersatzvornahme und unmittelbarem Zwang gegen Sachen bereiten, etwa im Falle des Aufbrechens einer Tür. Die Abgrenzung bereitet Schwierigkeiten, weil sich die Ersatzvornahme bei Einwirkung auf eine Sache ihrem äußeren Erscheinungsbild nach häufig nicht vom unmittelbaren Zwang unterscheidet. Bei der Abgrenzung zwischen Ersatzvornahme und unmittelbarem Zwang gegen Sachen ist nach hier vertretener Ansicht danach abzustellen, ob der Gefahrenabwehrzweck durch die Zwangsmaßnahme unmittelbar erreicht wird (dann Ersatzvornahme) oder die Einwirkung auf eine Sache den Erfolg nur mittelbar (im Sinne einer Beugefunktion) herbeiführen soll (dann unmittelbarer Zwang gegen Sachen).81 Danach liegt im Falle des Eintretens einer Tür unmittelbarer Zwang gegen Sachen vor. Denn Gefahrenabwehrzweck ist hier die Abwehr einer Gefahr in der Wohnung. Dieser Zweck wird durch das Einschlagen der Tür nicht erreicht. Das Einschlagen der Tür ermöglicht erst die eigentlich intendierten Gefahrenabwehrmaßnahmen. Zudem kann von einer Ersatzvornahme nur dann ausgegangen werden, wenn das polizeiliche Tätigwerden mit der vom Pflichtigen vorzunehmenden Handlung identisch ist. Ist dies nicht der Fall, sind die Vorschriften über den unmittelbaren Zwang einschlägig.82 Im Falle des Eintretens einer Tür sind diese Handlungen nicht identisch, wenn dem Pflichtigen zuvor aufgegeben wurde, die Tür zu öffnen. Zwar ließe sich argumentieren, dass eine polizeiliche Gebotsverfügung, die einen Wohnungsinhaber zum Öffnen der Tür verpflichtet, die Art und Weise des Türöffnens regelmäßig nicht vorgibt. Gegen eine solche Sichtweise spricht jedoch, dass vom Pflichtigen grundsätzlich nicht das Aufbrechen seiner eigenen Tür verlangt werden darf, weil eine solche Verfügung unverhältnismäßig wäre. Die Polizei nimmt mithin keine dem Wohnungsinhaber obliegende Handlung vor. Insofern ist im Fall des Eintretens einer Wohnungstür von unmittelbarem Zwang auszugehen.83
Art und Weise der Zwangsanwendung
Jede Art von Zwang ist vor Anwendung grundsätzlich anzudrohen (§ 56 PolG NRW). Zwangsgeld und Ersatzvornahme sind möglichst schriftlich anzudrohen (§ 56 Abs. 1 Satz 1 PolG NRW). Die Androhung beim unmittelbaren Zwang (§ 61 Abs. 1 Satz 1 PolG NRW ist lex specialis zu § 56 PolG NRW) kann hingegen in jeder geeigneten Form erfolgen, z. B. auch mittels „Warnschuss“). Wann von der Androhung abgesehen werden kann, regeln § 56 Abs. 1 Satz 3 PolG NRW und § 61 Abs. 1 Satz 2 PolG NRW. Danach ist eine Androhung entbehrlich, wenn „die Umstände sie nicht zulassen, insbesondere wenn die sofortige Anwendung des Zwangsmittels zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr notwendig ist“.
Bei Anlass: Besondere Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen
In Betracht kommen Fesselung nach § 62 PolG NRW (unmittelbarer Zwang durch Hilfsmittel körperlicher Gewalt) und Schusswaffengebrauch gem. §§ 63 ff. PolG NRW (unmittelbarer Zwang durch Waffeneinsatz).
Die Anwendung unmittelbaren Zwanges ist in ganz besonderem Maße vom verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geprägt; der Schusswaffengebrauch ist dabei das letzte und äußerste Mittel des unmittelbaren Zwanges. Für den Schusswaffengebrauch gelten gegenüber sonstigen Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs erhöhte Anforderungen (§§ 63 ff. PolG NRW).84
Ermessen und Übermaßverbot
Ermessen und Verhältnismäßigkeit sind nach den allgemeinen Vorschriften zu prüfen. Während die Prüfung des Ermessens in Klausuren regelmäßig sehr knapp erfolgen kann („Ermessensfehler sind nicht ersichtlich.“), muss die Verhältnismäßigkeit von polizeilichen Zwangsmaßnahmen meist ausführlicher geprüft werden, insbesondere bei der grundrechtsintensiven Anwendung unmittelbaren Zwanges. Es ist zu klären, ob das Zwangsmittel das mildeste zur Verfügung stehende wirksame Mittel war. Dabei gilt grundsätzlich, dass das Zwangsgeld das mildeste Zwangsmittel ist, gefolgt von der Ersatzvornahme und dem unmittelbaren Zwang. Wurde unmittelbarer Zwang angewandt, muss bei der Erforderlichkeit nicht mehr geprüft werden, ob andere mildere Zwangsmittel hätten angewandt werden können. Denn das wurde vorab schon mit § 55 Abs. 1 PolG NRW geprüft. Somit ist nur bei der Ersatzvornahme zu prüfen, ob alternativ ein Zwangsgeld in Betracht gekommen wäre. Überdies ist zu prüfen, ob innerhalb des konkreten Zwangsmitteleinsatzes eine mildere Maßnahme in Betracht gekommen wäre. Ausführungen hierzu sind regelmäßig bei der Anwendung von unmittelbarem Zwang erforderlich.
III. Prüfung einer gefahrenabwehrenden Zwangsmaßnahme im Sofortvollzug 85
I. Ermächtigungsgrundlage
Nach dem Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes bedarf es bei einem Grundrechtseingriff einer Ermächtigungsgrundlage, welche auf ein verfassungsmäßiges Gesetz zurückzuführen ist.
1. Grundrechtseingriff
2. Zielrichtung
3. Ermächtigungsgrundlage
II. Formelle Rechtmäßigkeit der Vollstreckungsmaßnahmen
1. Zuständigkeit
2. Verfahren
– Anhörung entfällt (Ersatzvornahme/unmittelbarer Zwang sind Realakte)
– bei a. A. Anhörung entbehrlich, § 28 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG
III. Materielle Rechtmäßigkeit der Vollstreckungsmaßnahme
1. Zulässigkeit des Zwangs (§ 50 Abs. 2 PolG NRW)
a) gegenwärtige Gefahr
b) Notwendigkeit des Sofortvollzugs
c) Handeln innerhalb der Befugnisse
– Inzidentprüfung der fiktiven Grundverfügung (hypothetischer VA)
aa) Rechtsgrundlage
bb) Materielle Rechtmäßigkeit
2. Zulässigkeit des Zwangsmittels (§ 51 PolG NRW)
a) Ersatzvornahme (§ 52 PolG NRW)
b) Unmittelbarer Zwang (§§ 55, 58 PolG NRW)
3. Art und Weise der Zwangsanwendung
a) Androhung (§§ 51 Abs. 2, 56, 61 PolG NRW)
b) Bei Zwangsgeld: Festsetzung, § 53 Abs. 1 und 2 PolG NRW
4. Bei Anlass: Besondere Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen
a) Fesselung (§ 62 PolG NRW)
b) Schusswaffengebrauch (§§ 63–65 PolG NRW)
5. Ermessen
6. Übermaßverbot
a) Geeignetheit
b) Erforderlichkeit
c) Verhältnismäßigkeit
IV. Ergebnis
Erläuterungen zur Prüfung einer (gefahrenabwehrenden) Zwangsmaßnahme im Sofortvollzug
zu I. Ermächtigungsgrundlage
In Betracht kommt § 50 Abs. 2 PolG NRW (Sofortvollzug).
zu II. Formelle Rechtmäßigkeit
Bei Prüfung der sachlichen Zuständigkeit gilt der Grundsatz, dass diejenige Behörde für die Anwendung von Zwangsmitteln zuständig ist, die die zu vollstreckende Grundverfügung erlassen hat (§ 50 Abs. 2 PolG NRW, § 56 VwVG analog). Nachdem im Sofortvollzug eine solche fehlt, ist auf die hypothetische Grundverfügung abzustellen und die sachliche Zuständigkeit der Polizei zu deren Erlass kurz festzustellen.
Dabei sollte die hypothetische Grundverfügung stets exakt benannt werden (z. B. „Unterlassen Sie den Angriff“).
zu III. Materielle Rechtmäßigkeit
Neben dem Fehlen einer Grundverfügung setzt ein Vorgehen im Wege des Sofortvollzugs nach § 50 Abs. 2 PolG NRW voraus, dass dieses zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr notwendig ist und die Polizei hierbei innerhalb ihrer Befugnisse handelt.
Zur Abwendung einer gegenwärtigen Gefahr (womit die besondere Eilbedürftigkeit beim Handeln mittels Sofortvollzugs beschrieben wird) muss der Sofortvollzug – also die Zwangsanwendung ohne vorausgehenden Verwaltungsakt – notwendig sein. Eine solche Notwendigkeit liegt vor, wenn der Zeitraum zwischen der Feststellung der gegenwärtigen Gefahr und dem voraussichtlichen Schadenseintritt so gering ist, dass die Durchführung des gestreckten Verfahrens den Erfolg des Zwangsmittels unmöglich machen oder wesentlich beeinträchtigen würde.86 Die Notwendigkeit ergibt sich somit regelmäßig daraus, dass bis zur möglichen Ausführung der Abwehrmaßnahme ein gestrecktes Verfahren nicht abgewartet werden kann, da der Schaden kurzfristig einzutreten droht.87
Die Polizei muss „innerhalb ihrer Befugnisse“ handeln. Im Gegensatz zum gestreckten Verfahren ist der Konnexitätsgrundsatz hier also gesetzlich angeordnet. Eine Vollstreckung im Wege des sofortigen Vollzugs ist deshalb nur dann rechtmäßig, wenn eine entsprechende Grundverfügung – würde sie tatsächlich ergehen – auch rechtmäßig wäre. Es müssen also stets die Voraussetzungen für eine mittels Sofortvollzugs durchgesetzte „fiktive Grundverfügung“ (hypothetischer Verwaltungsakt) vorliegen.
Anders als teilweise vorgeschlagen88 ist dabei ausschließlich zur materiellen Rechtmäßigkeit der gedachten Grundverfügung Stellung zu nehmen. Auf deren formelle Rechtmäßigkeit ist nicht einzugehen.
Denn die Zuständigkeit der Polizei zum Erlass der fiktiven Grundverfügung wurde bereits bei der Zuständigkeit zur Zwangsanwendung bejaht. Ausführungen zu etwaigen allgemeinen Form- und Verfahrensvorschriften (z. B. Anhörung oder ein etwaiges Schriftformerfordernis) sind indes bei der Prüfung einer Verfügung, die nicht ergangen ist, überflüssig und ergeben keinen Sinn.89
Da die Grundverfügung tatsächlich nicht ausgesprochen wurde, also nur „gedacht“ ist, ist bei der Prüfung in der Klausur der Konjunktiv zu verwenden. Eine häufige Fehlerquelle liegt darin, dass bei der Inzidentprüfung der fiktiven Grundmaßnahme „der Überblick verloren geht“ und im Rahmen der Verhältnismäßigkeit nicht mehr allein auf die Grundmaßnahme abgestellt wird, sondern auch auf die Zwangsmaßnahme. Anzuraten ist daher eine klare, detaillierte Klausurgliederung unter Verwendung eindeutiger Überschriften.
IV. Prüfung einer strafprozessualen Zwangsmaßnahme („gestrecktes Verfahren“) 90
Prüfung der Grundmaßnahme ist erfolgt
I. Ermächtigungsgrundlage
Nach dem Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes bedarf es bei einem Grundrechtseingriff einer Ermächtigungsgrundlage, welche auf ein verfassungsmäßiges Gesetz zurückzuführen ist.
1. Grundrechtseingriff
2. Zielrichtung
3. Ermächtigungsgrundlage (aus Grundmaßnahme, z. B. § 81a StPO i. V. m. §§ 57 ff. PolG NRW
II. Formelle Rechtmäßigkeit
Zuständigkeit (Verweis zur Grundmaßnahme)
III. Materielle Rechtmäßigkeit
1. Zulässigkeit des Zwangs
a) Die Eingriffsermächtigung der Grundmaßnahme enthält auch die Befugnis zum Zwang und der Anwendung des unmittelbaren Zwanges, wenn die durchzusetzende StPO-Maßnahme rechtmäßig ist
b) Rechtmäßigkeit der Grundmaßnahme
c) Grundmaßnahmen – Maßnahme wird nicht befolgt, da Adressat sich weigert
2. Zulässigkeit des Zwangsmittels
– Es kommt nur die Anwendung unmittelbaren Zwanges in Betracht
3. Art und Weise der Zwangsanwendung, §§ 57 ff. PolG NRW
– Androhung (§§ 57 Abs. 1 i. V. m. 61 PolG NRW)
4. Bei Anlass: Besondere Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen
a) Fesselung (§§ 57 Abs. 1 i. V. m. 62 PolG NRW)
b) Schusswaffengebrauch (§§ 57 Abs. 1 i. V. m. 63 ff. PolG NRW)
5. Ermessen
6. Übermaßverbot
a) Geeignetheit
b) Erforderlichkeit
c) Verhältnismäßigkeit
IV. Ergebnis
V. Prüfung einer strafprozessualen Zwangsmaßnahme („Sofortvollzug“)
Die Prüfung der Rechtmäßigkeit einer strafprozessualen Zwangsmaßnahme im Sofortvollzug ist vorzunehmen wie Prüfung im gestreckten Verfahren, indes mit dem Unterschied, dass hier eine fiktive strafprozessuale Grundmaßnahme zu prüfen ist.
Erläuterungen zur Prüfung einer strafprozessualen Zwangsmaßnahme
zu I. Ermächtigungsgrundlage
Im Strafprozessrecht ergibt sich nach h. M. das Recht zur Vollstreckung der Eingriffsmaßnahme aus der jeweiligen StPO-Befugnisnorm selbst.91 Dass z. B. bei Maßnahmen nach der StPO überhaupt auch Zwang zur Durchsetzung in Betracht kommt, ergibt sich vor allem aus praktischen Erwägungen. Nach überwiegender Auffassung schließen die Ermächtigungsnormen der StPO daher auch die Befugnis ein, (unmittelbaren) Zwang zur Durchsetzung bzw. Ermöglichung der Maßnahme einzusetzen (z. B. bei der Entnahme von Blutproben, §§ 81a StPO).92 Diese „großzügige“ Interpretation der StPO hat vor allem historische Gründe. Die StPO ist ein vorkonstitutionelles Gesetz aus dem Jahr 1877 und kann folglich nicht den Stand heutiger Vollstreckungsgesetze aufweisen.93 Bei repressiven Befugnissen gilt noch heute sinngemäß der Rechtszustand, wie er bereits in § 89 der Einleitung zum Preußischen Allgemeinen Landrecht formuliert war: Wem die Gesetze ein Recht geben, dem bewilligen sie auch die Mittel, ohne welche dasselbe nicht ausgeübt werden kann“.94
zu II. Formelle Rechtmäßigkeit
Die sachliche Zuständigkeit der Polizei für die Zwangsmaßnahme ergibt sich aus deren Zuständigkeit für die (ggf. fiktive) StPO-Grundmaßnahme nach § 163 Abs. 1 Satz 1 StPO (i. V. m. § 1 Abs. 4 PolG NRW95). Die instanzielle Zuständigkeit folgt aus § 11 Abs. 1 Nr. 2 POG NRW, die örtliche aus § 7 POG NRW.
zu III. Materielle Rechtmäßigkeit
Zulässigkeit des Zwangs
Die StPO enthält keine expliziten Befugnisse zur Zulässigkeit der Zwangsanwendung. Aus einer Interpretation der jeweils durchzusetzenden strafprozessualen Grundmaßnahme ergibt sich aber der Grundsatz, dass dieser die ungeschriebene Ermächtigung immanent ist, die aus ihr folgenden Duldungspflichten mittels unmittelbaren Zwangs durchzusetzen; vorausgesetzt, die StPO-Grundverfügung war rechtmäßig.96 Die Zulässigkeit der Zwangsanwendung wird auch aus einem Umkehrschluss aus § 81c Abs. 6 StPO hergeleitet: Wenn eine Zwangsanwendung im Einzelfall schon gegen Zeugen möglich ist, so muss diese auch bei einem Tatverdächtigen oder Beschuldigten möglich sein.97
Zulässigkeit des Zwangsmittels
Polizeiliche Strafverfolgungsmaßnahmen erlegen dem Betroffenen ausschließlich Duldungspflichten auf. Handlungspflichten begründen polizeiliche Strafverfolgungsmaßnahmen nicht, da niemand an seiner eigenen Strafverfolgung mitzuwirken braucht. Somit kommt als Zwangsmittel ausschließlich unmittelbarer Zwang in Betracht. Auch aus gesetzessystematischen Gründen kommt eine Ersatzvornahme (§ 52 PolG NRW) respektive Zwangsgeld (§ 53 PolG NRW) nicht in Betracht, wie sich (indirekt) aus § 57 Abs. 1 PolG NRW ergibt („… gelten für die Art und Weise der Anwendung die §§ 58–66 …“).
Art und Weise der Zwangsanwendung, §§ 57 ff. PolG NRW
Über die Art und Weise der Anwendung von unmittelbarem Zwang enthält die StPO (mit Ausnahme von § 119 Abs. 5 StPO: Fesselung in der Untersuchungshaft) keine Regelungen. Über die Brückennorm des § 57 Abs. 1 PolG NRW gelten die §§ 58–66 PolG NRW.
Anhang: Klausurbearbeitung: Tipps und Hinweise
1. Allgemeines zur Klausurtechnik
Die Mühen, die das Erlernen des umfangreichen Prüfungsstoffs machen, zahlen sich nicht aus, wenn das Handwerkszeug, das Erlernte in überzeugender Form zu Papier zu bringen, fehlt.98 Insofern werden nachfolgend einige Hinweise gegeben, deren Beachtung für das Gelingen einer Klausur von Bedeutung ist. Grundsätzlich gilt, dass lösungstechnische Empfehlungen zur Anfertigung von Klausuren nur allgemeine Hinweise sein können. Sie gelten für eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Fälle, keineswegs für alle. Entscheidend sind stets die fallspezifische Problematik bzw. die exakte fallgerechte Bearbeitung des jeweils konkret gegebenen Einzelsachverhalts.99 Insoweit sind die hier dargelegten „Tipps“ keineswegs als abschließend zu verstehen und bilden auch kein „Patentrezept“. Die hier dargelegten Hinweise sind aber weitgehend anerkannt, stellen also im Großen und Ganzen den („kleinsten“) gemeinsamen Nenner dar.100
Verstanden als Stil juristischer Texte hat der Stil des Juristen drei Grundsätze:101
(1) Inhalt vor Schönheit
(2) Klarheit vor Schönheit
(3) Schönheit vor Schund.
Denken Sie an den Leser (Korrektor):102 Man muss also nicht nur selbst wissen, was man meint, sondern sich auch immer fragen, ob ein anderer weiß, was gemeint ist. Die Lesbarkeit der Klausur wird durch eine klare und übersichtliche Diktion erhöht (keine Schachtelsätze);103 allgemein gilt:
– Die Regeln der Grammatik und der Rechtschreibung sind sorgfältig zu beachten104
– Keine Erörterungen im Ich-Stil
Formulieren Sie kurz und prägnant; überflüssig sind etwa folgende Wendungen: „Nun ist zu prüfen, ob …“, „laut Sachverhalt“. Das gilt auch für Füllwörter, wie „zunächst einmal“, ,,schlussendlich“, ,,im Endeffekt“ usw.
– Vermeiden Sie Bekräftigungen bzw. inhaltsleere Verstärkungen („zweifelsohne“, „eindeutig“ usw.), sie können den Anschein erwecken, man wolle sich den Aufwand einer schlüssigen Argumentation ersparen. Ist der Punkt tatsächlich unproblematisch, sind Verstärkungen überflüssig. Ist er dies nicht, wird diese Bekräftigung nicht über das Fehlen einer Argumentation hinwegtäuschen. Schlimmstenfalls wirken sie unsachlich.
– Verwenden Sie nur allgemein übliche Abkürzungen. Ein vermehrter Gebrauch „untypischer Abkürzungen“ beeinträchtigt den Lesefluss und damit die Lesbarkeit ihrer Klausur
– Sie dürfen den Sachverhalt auslegen, aber nicht ausweiten („Tatbestandsquetsche“)
– Vermeiden Sie jegliche Emotionalisierungen („Das kann ja wohl nicht richtig sein…“)
– Hinweise auf Rechtsprechung sind regelmäßig entbehrlich. Bewertet werden Systematik und eigenständige Begründungsarbeit
– Vermeiden Sie anmaßenden Stil („der Ton macht die Musik“), etwa „Die Meinung des BGH ist unhaltbar … „
– Fremdwörter können das Textverständnis erschweren und sind zu vermeiden. Die Gerichts- bzw. Amtssprache ist deutsch (§ 184 GVG, § 23 Abs. 1 VwVfG NRW), es sei denn sie sind treffender oder eleganter
– Streichungen sollten so eindeutig sein, dass der Leser sofort erkennen kann, ob ein Satz oder Absatz nun noch zur Bearbeitung gehört oder nicht
– für Definitionen gilt: Haben Sie einen Begriff schon einmal definiert, bedarf es bei der erneuten Erwähnung des Begriffs in der Regel keiner nochmaligen Definition. Ein Verweis nach oben genügt.
Insgesamt ist auf schlüssige Gedankenfolge und einen logischen Aufbau zu achten. Nutzen Sie den strukturierten Rahmen des Öffentlichen Rechts (Lösungsschemata). Behandeln Sie Probleme erst dann, wenn ihre Lösung zur Bearbeitung ansteht. So fordert der Platzverweis gem. § 34 Abs. 1 Satz 1 PolG NRW das Vorliegen einer konkreten Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung. Nur diese ist zu prüfen, nicht auch gesteigerte Gefahrengrade (z. B. gegenwärtige Gefahr), auch wenn diese vorliegen. Keine Lösung von Rechtsproblemen auf Vorrat.
Die erfolgreiche Klausurbearbeitung folgt ebenso wie die Lösung einer Hausarbeit, Seminararbeit, Bachelorarbeit usw. bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Die Beherrschung lässt sich durch permanente Übung erlernen. Letztlich gilt natürlich, dass das Klausurschreiben nur der Studierende selbst üben kann. Dass dabei der Grundsatz „Je öfter, desto besser“ gilt, dürfte kaum überraschen.105