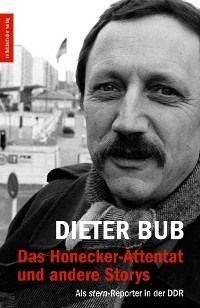Kitabı oku: «Das Honecker-Attentat und andere Storys», sayfa 2
Die Bestimmungen
Einweisung des Neuen durch die drei vom Außenministerium, der eine, der kleine Wilhelm von beinahe weltmännischer Freundlichkeit, der andere: Dr. Otto in Mausgrau, mit durchbrochenen braunen Schuhen, Abneigung im Gesicht, die dritte, Frau Ernst, kühl distanziert.
„Willkommen in der DDR!“
Sie erklären die Vorschriften, die von akkreditierten Journalisten zu beachten und strikt zu befolgen sind. Danach sind für alle Themen rechtzeitig Anträge auf Genehmigung einzureichen, die erst nach positivem Bescheid realisiert werden dürfen.
„Aber …“
Private Kontakte zu Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik zum Zwecke der Recherche sind untersagt.
„Aber …“
Die Mitnahme von Anhaltern ist verboten.
„Aber …“
Das beabsichtigte Verlassen der Hauptstadt der DDR in das übrige Territorium der DDR ist, auch für private Fahrten, Besichtigungen, Ausflüge etc. mindestens 24 Stunden zuvor schriftlich anzumelden.
„Aber …“
Die Einfuhr und die Ausfuhr von Gütern unterliegen den allgemeinen Vorschriften. Der Umtausch von D-Mark in Mark der DDR erfolgt über ein Konto bei der Staatsbank.
Müller hört zu. Müller macht den Eindruck eines aufmerksamen Zuhörers. Müller schweigt, beredt. Was Wilhelm routiniert vorträgt, ist für Müller neu. Ihm ist, als werde ihm gerade eine Zwangsjacke angelegt.
Wo befindet er sich?
Im Außenministerium eines deutschen Staates, gegenüber dem Berliner Dom, einem Zeichen preußischen Revanchismus’, das wie das Schloss verschwinden sollte, aber nicht gesprengt werden konnte. Die Berliner nennen das hässlich plattengeschuppte Gebäude „Winzerstube“, nach dem Mann, der das Land auf dem begrenzten Parkett der Bruderstaaten vertreten darf. Hier sitzt Müller, in einer Hauptstadt, die Teilstadt ist, nicht Hauptstadt ist, mit ihm am Tisch das Trio seiner Staatsaufseher.
Sie werden keine Freude an ihm haben.
„Ihr habt sie nicht alle“, schaut er sie belanglos an. „Das ist euer Ernst? Ihr wollt mich kastrieren und ihr erwartet meine Zustimmung zu dieser Operation?“
Müller weiß, sie drohen mit Sanktionen und haben Erfolg.
Viele bleiben in der Stadt, nehmen offizielle Termine wahr, erfüllen ihre Funktion als politische Korrespondenten, fahren abends vom Arbeitsplatz DDR in den Westen zurück, Privilegierte. Dazu ist er nicht gekommen.
Das Trio am Tisch hat sich gut etabliert, Karriere im System, Parteihochschule mit klaren Richtlinien, Wohlverhalten, Auszeichnungen, Privilegien. Wilhelm mit Kenntnissen über den Westen – Begleiter bei den Verhandlungen zum Helsinki-Abkommen, Monate in der finnischen Hauptstadt, auf internationalem Parkett. Frau Ernst hat Moskau erlebt, zwei Semester Lomonossow. Und der Dritte, Dr. Otto, der Älteste, der Blasse in Grau, der Apparatschik, voller Galle: hier geblieben, Klassenkämpfer, Westhasser, Verbitterter.
Die neue Adresse im Osten
Die Grauen an der Grenze können ihn nicht leiden, so wenig wie alle anderen, die hier nur nach Vorlage ihrer Dokumente, ohne Kontrolle ihrer Autos, ungehindert passieren dürfen, so oft sie wollen, auch mehrmals am Tag oder in der Nacht. Es sind die Männer und Frauen mit blauen Nummernschildern an ihren Dienstwagen aus dem Westen, teure Schlitten, die sich die Grauen in ihren Uniformen niemals würden kaufen können. Sie ahnen ebenso wenig wie er, dass sie diese hässlichen Verkleidungen in zehn Jahren ausziehen und wegwerfen werden, dass sie sich dann ungehindert auf die andere Seite begeben können – ohne von ihren Kameraden erschossen zu werden; dass sie dann jeden Wagen dieser Welt erwerben werden, wenn es ihnen gelingt, einen ordentlichen Job zu bekommen.
Was die Grauen auch nicht wissen: Er kommt gerne. Manchmal redet er mit ihnen, ohne sie anzusprechen. Sie spüren seine Gedanken, erspüren sie an seiner Freundlichkeit, seinem Lächeln, mit dem er ihnen begegnet, während sie die angeordnete Miene aufsetzen und anschließend Auffälligkeiten melden müssen.
Der Unbekannte vor ihm. Zurückhaltung, ein Gefühl von Beklemmung. Mitleid mit dem Kontrolleur, eingezwängt in einer Holzschachtel, zwei Quadratmeter Lebensfläche, acht Stunden am Tag, 160 Stunden im Monat, 1.760 Stunden im Jahr – vier Wochen Ferien bereits abgerechnet. Tage und Nächte auf zwei Quadratmetern zwischen dünnen Pressspanwänden. Vor ihm Gesichter, vertraut, Gesichter aus aller Welt, Spiegel von Normalisierung und internationaler Anerkennung, wie ein paar hundert Meter entfernt, Übergang Friedrichstraße, den die Amerikaner Checkpoint Charly nennen. Dort passieren sie alle: Japaner, Franzosen, Südafrikaner, Argentinier, Chinesen – die ganze Welt. Hier, Übergang Heinrich-Heine-Straße, erscheinen die Westdeutschen.
Die Wohnung ein Gefängnis im Gefängnis, in das er sich freiwillig begeben hat. Während Hunderte ihr Leben, ihre Freiheit riskierten, um herauszukommen, wollte er herein. Er sitzt im Betonkäfig, elfter Stock, vor dem Haus ein Uniformierter, hier oben Wände und Telefon verwanzt.
Ausblicke: vom Balkon nach drüben, in den Westen, zweihundert Meter entfernt die Mauer, der antifaschistische Schutzwall, hinter dem sich die imperialistischen Feinde des Springerkonzerns in ihrem Ullstein-Hochhaus Lügen über das sozialistische Vaterland ausdenken. Auf dem Dach das Emblem des Verlags als ständiges optisches Ärgernis. Nicht weit davon entfernt der Moritzplatz mit den Ateliers der neuen Wilden, die Kreuzberger Kneipen, eine Saufrepublik fröhlicher Zecher mit immer neuen Lebensformen, Experimenten, Diskussionen, Kreativität: Dichter, Maler, ein „König von Kreuzberg“, ein Gassenhauer: „Kreuzberger Nächte sind lang …“
Und hier, fünfhundert, tausend, zweitausend Meter entfernt, im Osten. Hier sitzt er fest. Die Abende sind trostlos. Fernsehen und Gin Tonic, zwei, drei, fünf. Bevor er ins Bett geht, um in diesem überheizten Zimmer, kopfschwer und unruhig, schlafen zu können, im Bewusstsein, sie sind bei dir, belauschen dich, kennen dich, erklärt er ihnen, sie müssten sich nicht weiter um ihn sorgen, er werde sich jetzt zur Ruhe begeben und wünsche ihnen eine angenehme, von Provokationen störungsfreie Nacht. Er gibt sich heiter, locker, aufgeräumt. Dabei fühlt er sich in Wahrheit miserabel. Er bedauert sich.
Eine auffällig stille Wohnung, in die trotz der dünnen Betonfertigteilwände selten Geräusche aus der Nachbarschaft dringen. Er hat andere Erfahrungen gemacht. Bei Leipziger Messen war er mehrmals in Neubausiedlungen einquartiert worden. Untergebracht im schmalen Zimmer der Kinder, die für diese Tage der Nebeneinkünfte bei Mutti und Vati schlafen mussten. Im Sanitärteil leere Waschmittel-Pappschachteln aus dem Westen aufgestellt, erreichten ihn von dort bereits früh um sechs die ersten akustischen Morgensignale der Körperhygiene, und nicht nur von dort, sondern aus vielen anderen Reinigungskabinen des Wohnblocks. Alles gleich nebenan. Erst danach kehrte Ruhe ein. Die Mieter verlassen ihre Dienstwohnungen, um den Abend drüben, auf der anderen Seite zu genießen, im Le Boubou, bei der Dicken Wirtin am Savignyplatz, bei Lutter und Wegener, in der Parisbar, im Florian oder bei irgendeinem Italiener, egal, jede Straße bietet mehr Abwechslung als hier die gesamte „Hauptstadt der DDR“.
Auf der anderen Seite der freie Blick auf den Gendarmenmarkt, noch immer Ruinen, trostlos, das Konzerthaus und der Französische Dom. Beginn erster Rekonstruktionen am Deutschen Dom, ein Vierteljahrhundert nach dem Krieg, vom endgültigen Abriss verschont. Allmähliche Besinnung auf Kultur und Tradition. Die sozialistischen Staatslenker im Arbeiter- und Bauernstaat erheben Anspruch auf deutsche Geschichte, erklären Martin Luther, gestern noch verhasst, zum progressiven Reformator und widmen ihm einen monumentalen Spielfilm. Erich Honecker gelüstet es nach alter Pracht. Ließ der Prolet und Stalinist Walter noch Kirchen sprengen, so ordnet sein Nachfolger den Wiederaufbau der Semperoper und des Konzerthauses an, schafft Luxusherbergen und einen „Palast der Republik“. Der gelernte Dachdecker aus Saarbrücken wünscht Glanz für seine Hauptstadt.
Allein im Betongeisterhaus, gemeinsam mit den Überwachungsleuten. Selbstgespräch. Trunkene Selbstbefragung: In der Isolation. Für monatlich 800 D-Mark Miete. Ausnahmesituation. Kein Leben draußen. Der Boulevard leer.
Stadtflucht und Idylle
Brigitte B. hatte eine gute Chance, in der Hierarchie der Privilegierten aufzusteigen. Zum Abschluss ihres Studiums der Malerei und der Restaurierung war sie Meisterschülerin des Staatskünstlers Walter Womacka geworden. Sie hatte die Gelegenheit nicht genutzt. Stattdessen mit einem Stipendium Rückzug ins Private. Kein Widerspruch, keine Opposition, nur eine angenehme Lebensmöglichkeit. Landflucht. Landluft. Sommerfrische. Das Bauernhaus, die Datsche.
Nach den Erfahrungen mit ihrer vierjährigen Tochter in den staatlichen Kinderkrippen, mit genauer Regulierung, gemeinsamem Topfzwang und Mittagsschlaf, und der drohenden Schule mit den Indoktrinierungen der Staatsführung, die sozialistische Persönlichkeiten forderte, nur heraus aus der Stadt aufs Land. Hunderte waren vor ihnen nach draußen gegangen. Die Suche. Die besten Adressen auf den Dörfern waren die Landwirtschaftlichen Genossenschaften, industrielle volkseigene Großbetriebe für Pflanzen- oder Tierproduktion. Diese LPGs waren, unabhängig vom Wetter, zur Planerfüllung und Übererfüllung verpflichtet, nutzten Herrenhäuser als Lager, errichteten für Melker und Traktoristen Plattenbauten und ließen alte Bauernhäuser verkommen.
Brigitte B. und ihr Mann zogen zu Erkundungen in Richtung Norden, trafen Künstler, die dort bereits ihr Domizil gefunden hatten, erhielten den Hinweis auf die Kleveschen Häuser und fanden ein leeres Bauernhaus aus den zwanziger Jahren. Dem LPG-Vorsitzenden waren die Städter willkommen, würden sie doch das Gebäude nutzen und vor dem Verfall bewahren. Sie erhielten kostenfreies Wohnrecht unter der Bedingung, das Haus zu erhalten und Reparaturen vorzunehmen.

Brigitte B. als Titel auf der „Neuen Berliner Illustrierten“
Die Entscheidung für die Kleveschen Häuser hatte sie getroffen – es war nicht das Neubauernhaus, das erst wieder benutzbar gemacht werden musste, es war der Garten. Während ihr Mann überlegte, was zu reparieren und zu renovieren war, noch abwägte, überschlägig Kosten errechnete, war es der Blick, ihr Blick über wucherndes Unkraut, Obstbäume, Wiese, Feld bis zum Wald, ein paar hundert Meter entfernt. Sie wusste, hier wollte sie leben, nein, hier würden sie leben, aber zuallererst würde sie hier leben, mit ihrer Tochter. Alles andere würde sich finden, war nebensächlich, Improvisation.
Wilhelms Doppelleben – der Genosse im Rang eines Offiziers des Staatssicherheitsdienstes im Außenministerium der DDR – und der Kleinbürger, der zweite Wilhelm, der einfache Wilhelm, die Verwandlung nach Feierabend wenn er nach Klein-Venedig kommt. Er zieht sich um, tauscht den grauen Dienstanzug gegen Trainingshose und Trainingsjacke, rot-braun, Erinnerung an die NVA. Selbstverständlich hat er seinen Dienst an der Waffe absolviert, an der Waffe ein paar Wochen nur, die übrige Zeit in der Presse- und Propaganda-Abteilung der Armee. Der nun aus der Datsche in den Garten tritt, ist ein anderer; nicht, dass er sich entpuppt hätte, von der Raupe zum Schmetterling geworden wäre, aber verwandelt, ein netter Privatmann, so wie alle hier zu liebenswerten Privatpersonen werden. Lässige Biertrinker und Würstchengriller. Ihre überwiegend molligen Frauen, die für die Woche hochtoupierten Haare nun aufgelöst, mit bunten Blusen über ihren fülligen Brüsten, die strammen Beine bis zu den Knien in eng anliegenden Hosen. Verkleidete Rubens-Figuren. Sie sind locker, die Genossen von Klein-Venedig, ohne ihre Abzeichen, nicht zu erkennen, stünden da nicht Wernesgrüner Pils und Becherovka auf den Tischen, lägen da nicht köstliche Steaks auf dem Grill, die sonst zum größten Teil ins kapitalistische Westberlin und in die BRD geliefert werden, unter dem Ladentisch, Bückware, Beziehungen, Tauchhandel, gegenseitige Vorteilsnahme: Kinderschuhe, erzgebirgisches Spielzeug, Rinderfilet, Auspuffrohre, immer gibt es irgendwo irgendetwas.
Alltag eines Korrespondenten in Ostberlin
Müller versorgt sich in der Kaufhalle – das Brot für 51 Pfennige, zwei Sorten Joghurt, drei Sorten Käse, Butter, Milch, alles einfach und schmackhaft, subventioniert. Auch wenn er sich unauffällig kleidet, die Verkäuferinnen erkennen in ihm einen von drüben, Misstrauen gegenüber diesem Mann, der sich Besseres leisten könnte und der, offenbar auch noch schwul, einen goldenen Ring im linken Ohr trägt.
„Ist was?“, fragt er die Neugierige hinter der Kasse, die aufdringlich das Schmuckstück betrachtet.
„Nö, nö“, sagt sie. „Is nischt.“
„Is wirklich nischt?“, fragt er.
„Nö, nö“, sagt sie.
„Sie meinen den Ring im Ohr. Trag’ ich, seit ich Baby bin. Immer dringeblieben.“
„Ach so“, sagt sie.
„Quatsch“, sagt er. „Gefällt mir nur. Bin aber nicht schwul. Ich liebe Frauen.“
„Ist schon in Ordnung“, sagt sie.
„Na ja, dann. Was macht das hier?“
„Drei zweiundachtzig“, sagt sie.
‚Ich sollte was über Schwule in der DDR schreiben‘, denkt er, ‚und über die Ostfrauen, die alle irgendwie Yvonne oder Marlene heißen. Sie haben irgendetwas.‘
„Du solltest dich vor ihnen hüten“, antwortet er sich.
„Warum sollte ich mich vor ihnen hüten?“
„Frauen, die sich für dich interessieren, wollen entweder mit dir in den Westen oder sie sind vom Staatssicherheitsdienst.“ „Ich weiß. Es sind die wahren Kämpferinnen des Sozialismus.“
Er hat sie erlebt, die Karl-Marx-Liebesdienerinnen mit dem MfS-Ausweis. In den Hotels und Bars der Messestadt Leipzig, die eleganten Westfrauen aus dem Osten, perfekt gekleidet, ihr Englisch im leicht warmem mitteldeutschen Klang, sächsisch oder thüringisch. Er wusste um die Sozialismus-Mätressen aus der Kaderschmiede der Partei, die nicht nur darin geschult waren, ihren Kurzzeit-Liebhabern nach dem Orgasmus zu schmeicheln und ihnen nebenbei weiter verwertbare betriebliche und familiäre Geheimnisse zu entlocken, sondern die vor ihren Einsätzen noch in einer Schönheitsklinik der Staatssicherheit bei Halle an der Saale körperlich aufgemotzt worden waren. Zwar ideologisch perfekt, galt es, kleine körperliche Mängel zu kaschieren: Beseitigung von Krähenfüßen, Brustvergrößerungen, Nasenoperationen. So waren die Ost-Mata-Haris auf dem Leipziger Messe-Parkett, verlockende Sehenswürdigkeiten und die Westmänner, wenn auch gewarnt, leichte Beute. Ihre Zielpersonen waren die Bosse aus Führungsetagen, mittelständische Unternehmer und Politiker, die sich alle umgarnen ließen, eingesponnen im Netz der Firma, die von Dienstreisen immer wieder zurückkehrten und, um Enthüllungen zu Hause zu entgehen, Informationen preisgaben, freiwillig oder erzwungen. Sie hatten sich eingelassen.
Er ernährt sich aus der Kaufhalle. Will kosten, auskosten. Er leistet es sich, für Pfennigbeträge. Hausmannskost als exotische Speise. Schmackhaft. Ein Experiment für einen, dem jederzeit, ein paar hundert Meter entfernt, alles serviert wird, chinesisch, kroatisch, türkisch, spanisch, japanisch und italienisch, an jeder Ecke. Die Stadt, die Weststadt als eine große Fressmeile von der Albertstraße bis zum Savignyplatz. Gleich neben dem Westberliner stern-Büro sein Italiener – das Il Sorriso: Pasta, Scampi vom Grill, Mozzarella, Vino Nobile aus Montepulciano, Vitello, Sabaglione, Tiramisu, Grappa, Vernacchia, Chianti Classico, Gran Sasso Primitivo Puglia aus Vendemmia.
Hier, im Osten, ein einziger Italiener mit sächsischem Koch und sächsischer Bedienung, Pizza mit Haufenbelag, Wein aus Rumänien – das Besondere für Devisen im Interhotel, in Leipzig am Ring. Müller weiß: er hat sich diesen Aufenthalt selbst verordnet. Er will dabei nicht nur, wie er sich immer wieder versichert, zurück in die Heimat, zu den Wurzeln. Er will fort aus seinem bisherigen Leben des Überflusses und des Überdrusses, der Sattheit, Gewohnheit mit allen Bequemlichkeiten.
Harald Schmitt – der Fotograf
Auf der anderen Seite wartet Harald Schmitt. Harald, der junge Fotograf, ein Dreißigjähriger, charmant, höflich, gute Manieren. Schmitt fühlt sich „in der Hauptstadt“, wie er Ostberlin nennt, heimisch. Seit zwei Jahren lebt er hier, zufrieden, wenig beschäftigt. Nick Barkow, der bisherige Korrespondent, Müllers Vorgänger, konnte nur wenige Geschichten platzieren, nachdem vor ihm Eva Windmöller und ihr Mann Thomas Höpker die DDR als kleinbürgerliche Idylle dargestellt hatten, ein biederes Land mit biederen Menschen – die Klorollen auf der Ablage ihrer Kleinwagen unter Häkeldeckchen verborgen, dickbäuchige Handwerker der Mangelwirtschaft, gemütliche Brigaden und Kleingärtner in ihren Wochenendhäusern, die sie, nach russischem Vorbild, Datschen nennen. Beschauliches Deutschland, nicht so ganz demokratisch, wissen wir, wollen wir, drüben, in der alten Bundesrepublik eigentlich auch gar nicht wissen. Es soll nur schlimm sein dort. Keine Freiheit.
Thomas Höpker hatte die DDR als das „langweiligste Land der Welt“ bezeichnet. Welch ein Irrtum. Die DDR ist spannend, aufregend, irritierend. Ein politisches Labor für den „real existierenden Sozialismus“, eine Diktatur, die Einparteienherrschaft der SED, ein Überwachungsstaat. Unverändert. Müller ist hier aufgewachsen. Ein Wiedersehen. Aufmärsche, Paraden, Kinder mit Pionierhalstüchern, die Hand zum Gruß an der Mütze, Jugendliche in blauen Hemden, massenhaft, bestellt, aufgestellt. Es wird marschiert, Tribünen mit dem Vorsitzenden der Genossen, dem Ministerrat. Militärkapelle. Parade mit den bewaffneten Streitkräften. Schmitt fotografiert das alles. Ohne Auftrag. Ein Chronist. Harald Schmitt kennt sich mittlerweile aus. Verhaltensregeln, Vorzüge, Vorschriften, Einschränkungen. Nach zwei Jahren beherrscht er den Alltag, weist den Neuen ein. Müller ist nicht fremd. Aber es sind alte Bilder, Erlebnisse, die 23 Jahre zurückliegen.
Schmitt ist ein Bildersammler, der Menschen mag, sich ihnen freundlich nähert, sie erkennt, für sich gewinnt, sie ermuntert, einen Augenblick in ihrem Leben. LPG-Bauern am Feldrain, unbekümmert fröhliche Jugendliche auf dem Weg nach Berlin, Maler in ihrem Atelier, Autobastler mit ihrem Trabant, Diplomaten staatsmännisch und den Staatsratsvorsitzenden in Afrika. Er denunziert nicht, er findet das Besondere. Dazu die Kuriositäten und Schäden dieses unbekannten Landes: Parolen, Schaufensterauslagen, Briketts auf Bürgersteigen, verdreckte Fabriken, verfallene Häuser. Schmitt und Müller – zwei Geschichtensucher auf dem Weg.
Die Demonstration
Der Ausnahmezustand. Ostberlin als Aufmarschplatz. Aus allen Teilen der DDR kommen die Demonstranten. In Sonderzügen, in Bussen, mit Mannschaftswagen. Am Vortag verschwinden die Datschenbesitzer in ihren Sommerhäusern am Stadtrand. Die Korrespondenten gönnen sich freie Tage. Am Vortag beginnen die Absperrungen von Straßen und Plätzen, bleiben die Geschäfte leer, gehört Ostberlin den Akteuren. Müller bleibt. Er will das Spektakel erleben, ein jährlich wiederkehrendes Großschauspiel, eine Massenveranstaltung von Tausenden, angeordnet, befohlen, militärischer Mummenschanz, offizielle Bedrohung.
Gefeiert werden nicht der 1. Mai, der Tag der Arbeit und der Arbeiter, nicht der Gründungstag der Deutschen Demokratischen Republik. Es sind die Tage der Macht, die Tage der Selbstdarstellung. Die Stadt ist erfüllt vom Widerhall der Marschschritte entlang der S-Bahn-Bögen, erfüllt von Kommandos, erfüllt von Gehorsam, Disziplin, Drill, sorgsam eingeübt, alles wie am Schnürchen. Es gibt sorgsam entwickelte Pläne, Erfahrungen, immer weiter verfeinert, Strukturen. Jeder an seinem Platz. Die Tribünen werden errichtet, die Tribünen für die Staats- und Parteiführung und für die Ehrengäste. Das Fuß-Volk der Fahnenschwenker und Mitläufer ist zu festgelegten Plätzen zitiert. Spätabends rollen Panzer mit Geschützen, Lafetten mit Raketen über die Karl-Marx-Allee, die einstige Stalin-Allee. Das Gerassel der Kettenfahrzeuge. Die Straße von Menschen leer.
Müller spürt Beklemmung, hat das Gefühl, als läge über Ostberlin eine bedrohliche Spannung, als herrsche Ausnahmezustand. Es sei eine Frage der Gewöhnung, erklärt Schmitt. Alles nur großes Brimborium.
Müller schläft mit den Geräuschen des Vor-Krieges ein, erwacht früh. Wieder Befehle, Schritte von Einheiten, Kompanien? Müller, ungedient, kennt sich nicht aus, ein militärisches Greenhorn. Am Morgen das Ritual, das große Theater. Die hohen Herren nehmen mit den Repräsentanten der Brudervölker auf den Tribünen Platz, genießen das Schauspiel winken jovial von oben herab – unter ihnen das Volk, das Teilvolk, mit Fahnen, Spruchbändern, Hochrufen. Kapellen ziehen vorüber, gedrillte Kampfgruppen, Soldaten der Nationalen Volksarmee mit ihrem Kriegsgerät.
Er erinnert sich an seine Zeit, als auch er 1950 nach der Gründung der DDR mit seinen Klassenkameraden zur Demonstration beordert wurde. Lehrer Sachse hatte ihn zusammen mit ein paar anderen dazu ausgewählt, dem Präsidenten das „Immer bereit!“ der Jungen Pioniere zu entbieten. In kurzen Hosen, mit weißem Hemd und dem Halstuch, das ihm die Großmutter sorgfältig zum Knoten gebunden hatte. Anständig hatte er aussehen sollen. Auf die Tribüne waren er und die anderen von Wilhelm Pieck, dem gemütlichen alten Mann mit der Entgegnung „Seid bereit!“ und Handschlag begrüßt worden. Dazu die Ermahnung, immer fleißig zu sein.
Der junge Dieter Müller, bürgerlicher Herkunft, war wie alle in die Kinderorganisation eingetreten, auf Empfehlung des Kriegsheimkehrers, Lehrer Sachse, und seiner Großeltern. Großvater und Großmutter wussten aus Erfahrung um die Notwendigkeit der Anpassung im totalitären System. Der Mann, der ihn in seine Obhut und seine Erziehung übernommen hatte, war wohlüberlegt in die Partei eingetreten, am Revers des grauen Anzugs das Abzeichen der NSDAP, zum Gruß das „Heil Hitler!“, um ohne Schwierigkeiten in seinem Laden weiter Zigaretten und Zigarren verkaufen zu können.
Nichts hat sich geändert. Der Großvater weiß, Diktaturen erfordern Strategien. Nach seiner Zeit bei den Pionieren tritt der Enkel in die FDJ ein, ein falsches Blauhemd-Bekenntnis zum Staat, das dem Kind aus eher suspektem bürgerlichem Milieu den Zutritt zur Oberschule erleichtern soll. Der kleine Müller erzählt der Großmutter zu Hause, es sei sehr schön gewesen. Der Präsident habe ihm über den Kopf gestreichelt. Damals war er noch ein dummer Junge. Und ging es ihnen jetzt nicht schon viel besser – nach dem Krieg? Und der Frieden war damals noch nicht wieder bewaffnet …