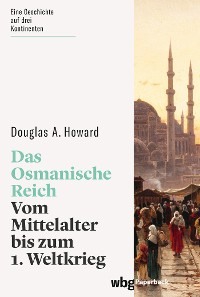Kitabı oku: «Das Osmanische Reich», sayfa 2
Elemente einer osmanischen Weltsicht
Dieses Buch erzählt die osmanische Geschichte als Geschichte dieser Weltsicht. Es sucht zu erklären, worin die osmanische Weltsicht bestand, wie sie zustande kam und wie sie sich auflöste. Sie blieb nicht unangefochten, und auch an Widerspruch fehlte es nicht. Doch die Grundbestandteile dieser Weltsicht wurden von allen Gemeinschaften der osmanischen Welt, gleich ob muslimischen, christlichen oder jüdischen, geteilt, auch wenn jede Gemeinschaft und die zu ihr gehörenden Gruppen ihre Elemente entsprechend den Traditonen der jeweiligen Gemeinschaft anders artikulierten. In diesem Buch beschreibe ich die osmanische Weltsicht als ein dreischichtiges Phänomen.
Die erste Schicht bildet die osmanische Dynastie, die Familie der Osmanensultane, ohne die es kein Osmanisches Reich gegeben hätte und keine osmanische Geschichte geben kann. Die Einwohner des Reiches teilten die Auffassung, dass an der osmanischen Dynastie etwas Besonderes war, und dies bestand nicht allein darin, dass die Familie der Osmanen die längste Zeitspanne ununterbrochener dynastischer Herrschaft in der Weltgeschichte für sich beanspruchen kann. Vielmehr besaßen die Sultane osmanischen Autoren zufolge Din ü Devlet. Din war spirituelle Energie, die Fähigkeit, die Bedingungen für die Begegnung zwischen der Menschenseele und dem Göttlichen zu regeln und festzulegen. Devlet bedeutete charismatische Herrschaft, die magische Gabe zu führen, Sieg und Wohlstand zu bringen. Verliehen wurden diese Gaben, um das materielle und geistige Wohlergehen der Völker unter der Obhut der Dynastie sicherzustellen. Osmanische ‚Politik‘ läuft größtenteils auf eine Beschreibung der Beziehungen der osmanischen Völker zu den Osmanensultanen und deren ausgedehntem Haushalt hinaus. Deren praktische Ausgestaltung variierte im Lauf der Zeit, je nachdem, wie sich das Bild der Osmanenfamilie nach außen hin wandelte, und damit veränderte sich auch die Definition von Identität, Loyalität und Zugehörigkeit.
Eine zweite Schicht der osmanischen Weltsicht ist ihr Verständnis von Wohlstand und Erfolg sowie der geeigneten Strategien, um beides zu erreichen. Das fiskalische Modell eines Imperiums ist wichtig, wie wir alle in den vergangenen zwei Jahrzehnten gelernt haben. Doch als die osmanische Dynastie ihr Reich errichtete, betrachtete sie die „Wirtschaft“ nicht als unpersönliche oder unabhängige Kategorie, sondern als Ausdruck materiellen Erfolgs, der sich aus dynastischer Macht und geistigen Bindungen gleichermaßen speiste. Instinktiv wollten die Osmanen die Leute in Ruhe ihre eigenen Entscheidungen in Wohlstandsfragen treffen lassen. Die Bedingungen des ausgehenden Agrarzeitalters, in das die Blütezeit des Osmanischen Reiches fällt, seine bestehenden Transportkapazitäten und seine Kommunikationstechnologie erzwangen eine solche „Laissez-faire“-Haltung, aber sie war auch vernünftig. Von der imperialen Rhetorik einmal abgesehen, war „Absolutismus“ nicht etwas, das die Imperien des Agrarzeitalters leicht praktizieren konnten. Die osmanische Regierung brachte durchaus hochfliegende Ideen hervor und stellte manchmal unter Strafandrohung weitreichende Forderungen. Für Sultane und Staatsmänner im Siegesrausch war es eine große Versuchung, sich zu übernehmen. Je entlegener die Provinz, desto wahrscheinlicher war es, dass Geduld und Verhandlungsbereitschaft sich auszahlten. Es waren alte Länder, wo die Menschen wussten, wie man Dinge regelte.
Die dritte Schicht der osmanischen Weltsicht ist das schon umrissene Geflecht aus spirituellen Überzeugungen. Die osmanische Literatur ist ein Mittel, um diese Überzeugungen zu verorten, und sie erhält in diesem Buch breiten Raum. Wie schon beim Betrachten der Fotografien Ara Gülers dauert es auch bei der Lektüre osmanischer Literatur nicht lange, bis man die alles durchdringende Melancholie spürt, die mit dem Verlust einhergeht, aber auch die verwunderte und heitere Hinnahme der Natürlichkeit dieses Verlusts. Hier auf diesem Erdenrund, unter den Himmelslichtern und Planeten, die über ihm im Gewölbe der sieben Himmel umliefen, bestand die Erfahrung des Menschseins in der Erfahrung von Wandel und des mit ihm einhergehenden Leids. Dieses Leid war teils das Ergebnis unerbittlicher Handlungen Gottes – Erdbeben, Seuchen, Dürre und Hungersnot, Stürme und Brandkatastrophen. Teils erwuchs es aus selbst zugefügten Wunden wie Krieg und Sklaverei, teils aus unergründlichen existenziellen Herausforderungen, unter denen die Erfahrung der Zeit zweifellos die rätselhafteste war. Und dennoch enthüllte die vergängliche Realität in all ihrer scheinbar willkürlichen Zufälligkeit für osmanische Autoren und ihre Leser letzten Endes eine vollständige Beschreibung des Göttlichen. Dinge, Erfahrungen und Ereignisse und vor allem jede Liebe und jeder Verlust – überwältigten in letzter Konsequenz die Sinne und trieben einen Menschen ins Dunkel, in die „Ruinenschänke“, wo er seine Lebensumstände bedenken und feststellen konnte, dass auch andere schon dort gelandet waren. Menschen fühlen sich in ihrem Schmerz oft getröstet, wenn ihr Leben dabei offensichtlich archetypischen Mustern folgt.
Zum Aufbau dieses Buches
Das Zeitempfinden einer Gesellschaft ist ein geeigneter Ausgangspunkt für den Einstieg in ihre Weltsicht. Daher erzählt dieses Buch die Geschichte der Osmanen in sieben chronologischen Kapiteln, entsprechend den Jahrhunderten des islamischen Kalenders, jener Zeitrechnung, die mit der Hidschra des Propheten Mohammed begann (622 n. Chr.). Zwar waren in den Ländern der osmanischen Dynastie und den von ihr beherrschten Gemeinschaften auch andere Kalender gebräuchlich, aber die Osmanen hielten sich an diesen islamischen Kalender und verwendeten ihn im gesamten Reich als Standard. Kapitel 1 beginnt mit dem Auftreten Osmans zu Beginn des achten islamischen Jahrhunderts, und Kapitel 7 endet mit dem Abgang der osmanischen Dynastie in der Mitte des vierzehnten. Somit vertritt das Buch zwei Thesen. Die eine lautet, dass das Dramatische an der Geschichte gerade in ihrer Chronologie besteht. Die Menschen wissen nie, was als Nächstes geschehen wird, sie wissen bloß, was gerade passiert ist, und auch das nur verschwommen. Da es der Historiker ist, der am Ende die Geschichte erzählt, ist die geschehende Geschichte von Natur aus anachronistisch. Dieses Paradox ist Teil des Vergnügens. Die andere These, die in der chronologischen Anordnung des Buches steckt, besagt, dass das Erleben von Zeit selbst eine Dimension der erzählten Geschichte ist. Keine Epoche ist wichtiger oder unwichtiger als eine andere. Ein kulturelles Konstrukt des Menschen, das ihm kosmologische Orientierung bietet und eine Struktur an die Hand gibt, innerhalb derer er den Sinn des Lebens begreifen kann, ist der Kalender.
Der Aufbau des Buches ist der osmanischen Weltsicht noch auf zwei weitere Arten verpflichtet, nämlich durch den Gebrauch einheimischer Ortsnamen und den Gebrauch von Eigennamen. Ortsnamen benennen das Terrain, das die osmanischen Völker ständig durchquerten, geben den Schauplatz der Handlung vor und liefern zum Teil den Kontext der Ereignisse. Mehr noch, sie lassen die Gestalt der osmanischen Gedankenwelt erkennen; es kann gar nicht genug betont werden, dass die Osmanen die regionale Vielfalt als gegeben annahmen. Sie hatten ihre Freude daran. Sie hüteten sich davor, Pauschalurteile auf der Grundlage von Verallgemeinerungen zu fällen, wie etwa „der osmanische Balkan“ – so etwas gab es nicht – oder „Anatolien“, dessen heutige Definition ebenfalls ziemlich jungen Datums ist und nach dem Ende des Imperiums entstand. Osmanische Autoren sprachen von „diesen wohlbeschützten Herrschaftsbereichen“, über die sie mit eigentümlicher Betonung des Lokalen berichteten.
Was die Eigennamen angeht, so sind viele von ihnen vielleicht nicht vertraut, doch sie sind trotzdem unverzichtbar. Dieses Buch handelt von Menschen und von den Entscheidungen, die sie trafen, von dem, was sie schrieben und sagten, wie sie mit Leid fertig wurden, welche Überraschungen sie erlebten und was sie glücklich machte. Die Osmanen liebten es, alles zu dokumentieren, weshalb die Quellen, auf denen das Buch beruht, tatsächlich Namen nennen. Natürlich kannten viele Angehörige der vergleichsweise kleinen osmanischen Herrschaftsschicht einander, besonders jene, die gemeinsam im Palast aufgewachsen waren, aber das reicht als Erklärung nicht aus, da es nicht nur die Herrschaftsschicht ist, deren Namen in den Dokumenten auftauchen. Auch einfache Leute erscheinen namentlich, Männer wie Frauen, Christen, Juden, Muslime und Fremde, in Beschwerden und Gesuchen, Gerichtsfällen, Verträgen, Tagebüchern, Geschichtswerken und ähnlichem. Vielleicht stellen diese Namen die Geduld des Uneingeweihten auf die Probe, aber wer gut vorbereitet ist, dem offenbaren osmanische Namen häufig wichtige Informationen – Geschlecht, soziale Identität, Herkunftsort –, ganz abgesehen davon, dass sie manchmal schillernd und kurzweilig sind. Wenn in diesem Buch viele dieser Namen enthalten sind, so ist das der Versuch zu wiederholen, was die historischen Aufzeichnungen der Osmanen überdeutlich machen: dass die osmanische Weltsicht am klarsten in der Achtung vor dem Einzelnen und vor den bedeutsamen wie den banalen Details seines Lebens zum Ausdruck kam.
1. Osmanische Genese, 1300–1397
Der Regen fiel heftig in diesem Frühjahr, und der Fluss Sangarios trat über die Ufer und suchte sich unter einer längst aufgegebenen Brücke hindurch sein altes Bett. Ein Sturzbach aus Matsch, Schlamm und Schutt ergoss sich über den Weg, und dort begann das Osmanische Reich, in den westlichen Grenzregionen der mongolischen Welt während der Morgenröte der Kleinen Eiszeit, im Monat März an der Wende zum achten islamischen Jahrhundert. Türkischen Hirten, die mit ihren Herden von den regengepeitschten Anhöhen flohen, gelang es, die durchbrochenen byzantinischen Verteidigungslinien am abgerutschten Flussufer zu umgehen.1 Ihre Vorhut überraschte eine byzantinische Streitmacht. Mit frischem Mut griffen die Türken an und brandschatzten. Es folgten zahlreiche weitere Raubzüge – eine wahre Flut. Von Konstantinopel rückte das reguläre Heer aus, das vom Kaiser den Befehl erhalten hatte, der türkischen Gefahr entgegenzutreten, doch auf der Ebene von Bapheus vor Nikomedia errangen die Türken einen großen Sieg.
Osmanische Sultane des achten islamischen Jahrhunderts
| Osman | gest. 1324(?) |
| Orhan | 1324–1361(?) |
| Murad I. | 1361(?)–1389 |
| Bayezid I. | 1389–1402 |
Nicht so schnell. Eine einzelne Schlacht macht noch kein Reich. Die frühesten erhaltenen türkischen Beschreibungen sind einhundert Jahre jünger, sie stammen aus einer Zeit, als die Erinnerungen an die Anfänge des Reiches bereits eng mit den Ansichten über die Art und Weise verknüpft waren, wie sich alles weiterentwickelt hatte. Und so trieb die osmanische Gründergeneration, losgelöst von der festen historischen Verankerung, in den Strudeln von Poesie und Epos aufs offene Meer hinaus. Selbst das Datum steht nicht ganz fest, was osmanischen Autoren nur recht war. Sie verlegten es gern ins Jahr 699 der Hidschra des Propheten Mohammed, als hätte das osmanische Herrscherhaus die Hoffnung auf den „Erneuerer des Zeitalters“ erfüllt, der zu Beginn eines jeden neuen Jahrhunderts erscheinen sollte. Und es war ein außerordentlicher Beginn – das islamische Jahr 700 entsprach beinahe genau dem christlichen Jahr 1300, eine bemerkenswerte Epochenüberschneidung.
Raubzüge und rauschende Fluten rühren im Türkischen von derselben verbalen Quelle her, und Tränen ebenso, nämlich von der Wurzel ak-, und viele spätere Autoren, Türken wie Griechen, kannten das Wortspiel. „Die Verstärkungen des rechten Glaubens rauschten über den Ungläubigen hinweg“, so geistreich der türkische Dichter Ahmedi,2 und der griechische Historiker Dukas schrieb: „Wenn sie die Stimme des Herolds vernehmen, der sie zum Angriff ruft – der in ihrer Sprache akin heißt –, brechen sie ungebeten herein wie ein über die Ufer tretender Fluss.“3
Die türkische Flut
Fast nichts wissen wir heute über Osman, den Gründer des Hauses Osman, den Mann, der als Erster der Osmanensultane in Erinnerung ist. „Osman Bey trat in Erscheinung“, vermerkte ein lakonischer Annalist später. Niemand weiß, wann oder wo Osman geboren wurde, und lange Zeit gab es kein einziges Artefakt, das sich zuverlässig in seine Lebenszeit hätte datieren lassen. Inzwischen sind zwei Münzen aufgetaucht, eine in einer Privatsammlung in London und eine im archäologischen Museum von Istanbul; beide tragen die Prägung Osman ibn Ertugrul.4 Selbst sein Name ist umstritten. Der griechische Historiker Pachymeres,5 dem wir die Beschreibung des Sangarios-Hochwassers verdanken und der als einziger zeitgenössischer Autor Osmans Namen erwähnt, nennt ihn gar nicht Osman, sondern Ataman. Die überraschende Vorstellung, Osman habe einen anderen Namen getragen, wird von zwei späteren Quellen gestützt, einmal dem Werk eines „Lehnstuhlgeographen“, das um 1350 auf Arabisch verfasst wurde, und zum anderen einer um 1500 geschriebenen Biographie des muslimischen Heiligen Hacı Bektaş. Ataman ist ein türkischer oder vielleicht mongolischer Name, während Osman untadelig muslimisch ist, die türkische Form des arabischen ʿUthmān – wie auch der Gefährte des Propheten Mohammed hieß, der dritte Kalif des Islam. Dies hat den Verdacht geweckt, unser Osman oder Ataman könnte von Geburt Heide gewesen sein, seinen neuen Namen Osman also später angenommen haben, als er Muslim wurde. Doch wenn dies stimmen würde, wenn Osman tatsächlich ein islamischer Konvertit war, der seinen Namen änderte, warum hätten dann seine Söhne, die ohne jeden Zweifel Muslime waren, ihre echt türkischen Namen behalten sollen?6

Abb. 1.1: Die Gräber von Osman und Orhan in Bursa auf einer Fotografie von Abdullah Frères, ca. 1880–1893
Laut dem, was Pachymeres schrieb, können wir über jenen Türken, den er Ataman nennt, mehr oder weniger nur vermuten, dass er ein Krieger war. Nach den Kriegszügen vom Sangarios (Sakarya) und dem Sieg bei Bapheus strömten ihm von fern und nah türkische Krieger zu.7 Ataman belagerte Nikaia, und obwohl er die Stadt nicht einnehmen konnte, überzog er ihre Umgebung mit Überfällen, tötete dabei viele, machte einige Gefangene und schlug den Rest in die Flucht. Mehrere andere Festungen und befestigte Städte im Sangarios-Tal nahm er jedoch ein und nutzte sie als Depots für seine Beute. Auf ähnliche Art verwüstete er das Umland von Prusa (Bursa), konnte aber auch diese Stadt nicht erobern.
Unsicher ist auch Osmans Todesdatum. Wahrscheinlich war er 1324 schon tot, dem Jahr, in dem sein Sohn Orhan eine Stiftungsurkunde beglaubigte.8 Der marokkanische Weltreisende Ibn Battuta, der die Region in den Jahren 1331–32 besuchte, schrieb, dass Osman in der Moschee von Bursa begraben sei, bei der es sich wahrscheinlich um die frühere Kirche St. Elias handelt.9 Wegen eines Erdbebens steht diese Kirche heute nicht mehr. Inzwischen liegen die sterblichen Überreste Osmans neben denen von Orhan; Vater und Sohn ruhen in einem Doppel-Mausoleum, das 1863 errichtet wurde.
Orhan
Weitaus leichter als für Osman, den Vater, lassen sich zeitgenössische Belege für Orhan, den Sohn, finden. Zwei Inschriften Orhans sind erhalten und außerdem Abschriften dreier seiner Stiftungsurkunden.10 Namentlich erscheint er in mongolischen Rechnungen11, und auch in persischen und arabischen Quellen wird er erwähnt. Ibn Battuta behauptete, Orhan begegnet zu sein, „dem größten der Könige der Turkmenen und dem reichsten an Vermögen, Land und Heeresmacht“. Orhan „kämpfte ständig mit den Ungläubigen“ und reiste regelmäßig zwischen seinen über 100 Burgen umher, überzeugte sich, dass sie in gutem Zustand waren, und blieb nie länger als einen Monat an einem Ort.12 Ibn Battutas Bild eines unablässig kämpfenden Orhan wird von griechischen Autoren nachdrücklich bekräftigt. Er und seine Männer eroberten 1326 nach langer Belagerung Prusa (Bursa), und im darauffolgenden Jahr ließ Orhan dort Münzen prägen, wie ein erhaltenes Silberstück zeigt. Im Jahr 1331 fiel Nikaia (İznik) an Orhans Truppen und 1337 Nikomedia (İznikmid, İzmit). Die Einnahme dieser drei bedeutenden griechischen Städte – Prusa, Nikaia und Nikomedia – machte Orhan zum Herrn der gesamten Region Bithynien.

Karte 1.1: Die Umgebung des Marmarameers
Orhan war aber nur einer von vielen türkischen Herrschern, denen Ibn Battuta auf seiner Reise durch Kleinasien begegnete. Turkmenische Sippen, die vor den Mongoleneinfällen flohen, bildeten die Streitmacht für so manchen ehrgeizigen Fürsten, der seit den 1290er-Jahren die Flusstäler und Küsten von Schwarzem Meer, Marmarameer und Ägäis plünderte. Außer Orhan nutzten auch mehrere von ihnen ihre bewaffneten Banden, um primitive Verwaltungsstrukturen zu schaffen. Um 1340 kontrollierten sie die meisten Überlandrouten und Karawanenstädte der Flusstäler und schalteten sich an den Küsten in den Kampf zwischen Byzanz und den italienischen Seestaaten um die Häfen und Schifffahrtswege ein. Die türkischen Fürsten dieser Grenzlande und ihre Gefolgsleute erschienen nicht nur den Griechen als roh und unbezähmbar, sondern auch den weltläufigen muslimischen Autoren aus „Rum“ oder Rom, wie man die Hochebene im Binnenland nannte, weil sie einst Teil des Römischen Reiches gewesen war. Dort hatte die islamische Kultur mehr als 200 Jahre lang unter der Herrschaft der Seldschuken-Dynastie dominiert,13 die ein kultiviertes, von persischen Einflüssen geprägtes Königreich mit dem Zentrum Konya regiert hatte. Die Neuankömmlinge waren Halbnomaden, die stolz südwestliche (also oghusische, siehe Abb. 1.3) Turksprachen pflegten. Ihre Lebensweise basierte auf Raubzügen ebenso wie auf Viehzucht und dem Verkauf der Produkte ihrer Herden.14 Ihre heiligen Männer und Derwische waren darauf erpicht, den Islam in neue Länder zu tragen. Das Erscheinen dieser Vasallen der mongolischen Herrscher des Iran (der Ilchaniden, deren Herrschaft 1336 endete) hing mit Ereignissen des vorausgehenden Jahrhunderts zusammen, die jenseits des Horizonts ihrer eigenen Erinnerungen lagen. Damals hatte das Vordringen der Mongolen auf dramatische Weise die geschäftlichen und politischen Beziehungen im gesamten südwestlichen Eurasien gesprengt.
Gewalt, Seuchen und Unheil
Im Jahr 1219 hatte die Verwüstung von Choresm durch die Mongolen eine Zwangsmigration von Völkern aus dem zentralen Eurasien ausgelöst, die sämtliche Gesellschaften westlich des Kaspischen Meeres betraf. Unter den Flüchtlingen und Migranten befanden sich Tausende Turkmenen samt ihren Familien und Herden. Ihre Stammesgesellschaften waren hochgradig mobil und für ihr militärisches Potenzial berühmt. Die Lebensläufe gleich zweier großer Heiliger, Rumi (alias Mevlana Dschalal ad-Din) und Hacı Bektaş, sind mit der mongolischen Gewalt verknüpft – dem Klimawandel und dem menschlichen Elend, die hinter ihr lagen, und dem Einbruch eines chiliastischen Glaubenseifers, der ihr vorauseilte.
Die politischen Kollateralschäden der Mongoleneinfälle hatten bis 1260 zur Entstehung dreier mächtiger Königreiche im Südwesten Eurasiens geführt. Zwei davon waren mongolisch – die Goldene Horde am Unterlauf der Wolga und in der Steppe nördlich des Schwarzen Meeres sowie die Ilchaniden im Iran, in Mesopotamien und im Kaukasus mit Täbris als Hauptstadt. Das dritte war das Sultanat der Mamluken, das nicht Mongolen, sondern Sklavenoffiziere aus dem Turkvolk der Kipçak gegründet hatten, die 1250 ihre ayyubidischen Herren stürzten und die Macht in Kairo an sich rissen. Die Mamluken beherrschten Ägypten, Arabien und die syrische Küstenebene. In diesen drei großen Königreichen und deren Dunstkreis stritten von der Donau bis zum oberen Euphrat und Tigris Dutzende slawischer, lateinischer, griechischer, armenischer und türkischer Edler und Fürsten, deren Namen längst vergessen sind, heftig und oftmals gewaltsam um die Kontrolle über die Endpunkte der großen eurasischen Handelsrouten. Diese Herren hießen auf Türkisch „Emire“, daher der Begriff „Emirate“ für ihre Kleinkönigreiche. Zu den vielen türkischen Emiren zählten Osman und Orhan, doch die stärkste Position hatte das griechische Adelsgeschlecht Michaels VIII. Palaiologos, Regent des griechischen Königreichs Nikaia, der im Jahr 1261 Konstantinopel von den lateinischen Kreuzfahrern zurückeroberte.