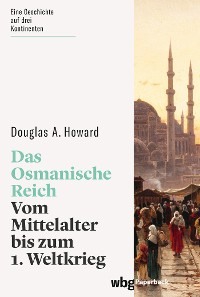Kitabı oku: «Das Osmanische Reich», sayfa 4
Eine neue Gesellschaft
Aus den Kriegen, Katastrophen, Seuchen und Wanderungen dieses bemerkenswerten Jahrhunderts entstand in den Grenzregionen allmählich eine neue Gesellschaft. Ihre verschiedenen Gemeinschaften, die Seite an Seite lebten – Griechen und Türken, Slawen und Lateiner –, verstanden oder mochten einander nicht immer. Doch wie im Fall der Legenden um das Kosovo konnten ihre wechselweise Unwissenheit und ihre manchmal bestürzende gegenseitige Bosheit nicht verhindern, dass es unweigerlich zu einer Gemeinsamkeit der Mittel und Wege kam, einer Überlappung der Identitäten, die – wenn auch uneingestanden, ja unbewusst – binnen einer Generation aus dem Unheil erwuchs.
Es ist zwar nicht falsch, solche Gemeinschaften als „christlich“ und „muslimisch“ zu bezeichnen, aber an den verschwommenen Grenzen zwischen den beiden öffnete sich eine Zwischenregion, in der christliche wie muslimische Ritter zu den plündernden Armeen zählten, Christen wie Muslimen die Gefahr der Versklavung drohte, Christen wie Muslime Krankheiten und Seuchen zum Opfer fielen und Christen wie Muslime sich ineinander verliebten, intime Beziehungen eingingen und Mischehen schlossen. Kantakuzenos rügte seine griechischen Rivalen in Konstantinopel, denn ihre Heere seien voller „Halbbarbaren“, mixobarbaroi, und am Ende des Jahrhunderts sagte Timur dasselbe über die Osmanen.35 Die beiden berühmtesten Zeitzeugen für diese verknüpften Gesellschaften, Ibn Battuta und Palamas, der eine Muslim, der andere Christ, fühlten sich jeder in der Küstenregion Kleinasiens als Außenseiter. Ibn Battuta verbrachte den Großteil seines Lebens mit Reisen von einem Ende der islamischen Welt zum anderen, und in Gesellschaft gleichgesinnter muslimischer Gelehrter fühlte er sich wohl, aber an der kleinasiatischen Küste stieß er auf überraschende Barrieren, denn er konnte kein Türkisch. Und als Erzbischof Palamas unter die griechischen Christen in Kleinasien kam, die er als sein eigenes Volk betrachten durfte, bemerkte er mit einem gewissen Kummer, aber auch mit einiger Bewunderung, dass „die Christen und die Türken sich miteinander vermischen, ihren Geschäften nachgehen, einander führen und voneinander geführt werden …“36
Es ist nicht leicht, ein vollständiges demographisches Bild dieser entstehenden Gesellschaft zu zeichnen. Beispielsweise ist es unmöglich, die Zahl der Gesamtbevölkerung in der Region zur Zeit der türkischen Eroberung oder die Größe der verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen zu ermitteln, aus denen sich die Gesamtheit zusammensetzte. Unbekannt bleiben die Zahlen der Invasoren und Einwanderer, die der Menschen, die vor den Katastrophen vorübergehend oder dauerhaft auf die Inseln der Ägäis, nach Konstantinopel oder in die slawischen Länder flüchteten, wie viele von ihnen starben, wie viele in die Sklaverei verkauft wurden, zuhause blieben oder heimkehrten, als die Gewalt abebbte.
Anfangs war der Großteil der Bevölkerung in den Ländern, über welche die osmanischen Emire herrschten, orthodoxe Christen. Es ist nicht leicht, die Lebensumstände dieser „großen Zahl von Christen unter muslimischer Herrschaft“, wie Ibn Battuta schrieb, einzuschätzen. Die orthodoxe Kirche, deren Struktur erst durch die Slaweneinfälle und dann durch die türkischen Einfälle dezimiert worden war, stand vor gewaltigen Schwierigkeiten.37 Der Klerus erlitt beträchtliche materielle Verluste und verarmte durch die Angriffe der Türken, die Flucht von Ordensgemeinschaften und deren Anführern, die Gefangennahme und Versklavung zumindest eines Teils der Bevölkerung, die Aufgabe und Beschlagnahmung von Liegenschaften und den Aderlass durch ansteckende Krankheiten. Disziplin, Moral und Reinheit der Lehre litten gleichermaßen.38 Dennoch zeigen Ausgrabungen in Sardes, einer Stadt an der viel befahrenen Flussroute über den Hermos (Gediz) von der Küste Kleinasiens ins Landesinnere, wenig Brüche in den Siedlungsspuren, vielmehr deuten sie auf eine Kontinuität zwischen der byzantinischen und der frühtürkischen Zeit, etwa in Produktion und Gebrauch glasierter Keramik.39 Zwar fand Erzbischof Palamas Nikaia während seines dortigen Zwangsaufenthaltes zum Großteil verlassen vor und stellte fest, dass der Handel nach Bursa ausgewichen war, aber trotz aller Not ging das geistliche Leben weiter. Auch in Biga „brachten sie uns zur Kirche Christi, die selbst jetzt dank seiner Macht noch besteht und ihn freimütig preist“. Außerdem traf Palamas Christen in wichtigen Positionen an, darunter Orhans Leibarzt, ein griechischer Mediziner namens Taronites.40
Ein weiteres Problem für die Kirche war der Übertritt zum Islam. Zwei Patriarchenbriefe an die Christen in Nikaia, geschrieben in den Jahren 1338–40, luden Konvertiten zur Rückkehr ein und versprachen Vergebung. Die Briefe setzten voraus, dass einige unter Zwang Muslime geworden seien, und stellten in Aussicht, sobald der Druck wegfalle, würden jene, die sich wieder der Kirche anschließen wollten, Aufnahme finden. Doch wiederholt verurteilten die Schreiben Konvertiten, weil sie ihrem christlichen Glauben nicht treu blieben. Sie behandelten die Konversion als Sünde, die Reue und Vergebung erfordere – womit sie indirekt einräumten, dass es sich in Wirklichkeit nicht um Zwangsbekehrungen gehandelt hatte.41
Es überrascht nicht, dass zu den Faktoren, die einen Glaubenswechsel begünstigten, Mischehen zählten. Herrscherliche Vorbilder für Eheschließungen zwischen Christen und Muslimen, die aus Gründen der dynastischen Politik erfolgten, waren zur Hand, wenn man wollte, doch handelte es sich nicht allein um eine Praxis im Adel. Die Kinder dieser wahrscheinlich in die Hunderte gehenden Verbindungen waren es, von denen Kantakuzenos als von mixobarbaroi sprach.42 Alle Ehefrauen Sultan Orhans waren Griechinnen – außer Theodora (der Tochter von Kantakuzenos) hatte Orhan zuvor bereits Nilüfer geheiratet, die Tochter des byzantinischen Statthalters von Yarhisar.43 Theodora blieb Christin, Nil üfer wurde Muslima.44 Aber das war nichts Neues. Seit 200 Jahren hatten die byzantinischen Kaiser Eheverbindungen mit den seldschukischen Türken geschlossen.45 Dutzendweise hatten Prinzessinnen aus den Königsfamilien des christlichen Konstantinopel, Trapezunt und Serbien mongolische und türkische Herrscher geheiratet.46 Orhans Nachfolger Murad und Bayezid heirateten muslimische wie christliche Frauen. Murad war mit Töchtern des christlichen Fürsten von Tarnovo und der muslimischen Fürsten von Kastamonu und Sinop vermählt. Murads Sohn Bayezid heiratete die römisch-katholische Tochter der Herzogin von Salona, die orthodoxe Schwester des serbischen Fürsten Stefan Lazarević und die muslimische Tochter des Fürsten von Germiyan.
Wechselseitige Abhängigkeit
Die türkische Eroberung band die Küstengebiete beiderseits der Meerengen stärker in die afroeurasische Welt ein.47 In Situationen, da die Sicherheit zusammengebrochen war, entwickelte sich aus der anfänglichen räuberischen Beziehung zwischen Plünderern und Opfern eine Wechselbeziehung, sobald die türkischen Emire die Ordnung wiederhergestellt hatten. Ibn Battuta kam sich manchmal so vor, als lebte er am Rande der zivilisierten Welt – diese Leute sprachen gar kein Arabisch! Doch dank enger Kontakte mit der seldschukischen Kultur auf der Hochebene setzte rasch ein kultureller Reifungsprozess ein. Ibn Battuta war beeindruckt von der Atmosphäre der Karawansereien – der Herbergen, die gleichzeitig als Märkte dienten. Dort begegnete er Pilgern und anderen hauptberuflichen Reisenden seines Schlages, einem Muslim aus Ägypten, einem Juden aus Spanien und anderen.48 Ausführlich schrieb er über die Männer, die in den Herbergen arbeiteten und sich um die Bedürfnisse von Reisenden und Händlern kümmerten. Sie waren Angehörige geistlicher Bruderschaften und praktizierten eine pietistische Ethik des Dienens. Ibn Battutas Bericht vermittelt auch einen Eindruck vom regen Wettbewerb zwischen den türkischen Emiren, die muslimische Gelehrte, Koranrezitatoren und andere auswärtige Künstler und Unterhalter an ihre Höfe zu locken suchten. Diese Rivalität in puncto Philanthropie und Förderung der religiösen Wissenschaften und Künste erstreckte sich auch auf große Bauvorhaben wie Moscheen, Medresen und Bäder, von den Herbergen abgesehen. Die Architekten der frühen Moscheekomplexe und anderer Bauten, welche die türkischen Eroberer errichteten, stammten oft aus Ägypten, Syrien und anderen Ländern, doch die Techniken der Werkstätten verraten, dass das kunsthandwerkliche Dekor und die Arbeitskräfte einheimisch-christlich waren.49 Die kosmopolitische Wertschätzung der Türken für Arbeit und Handel erwuchs offensichtlich aus den Werten ihrer islamischen Religion und war mit ihnen vereinbar.
Erst die Eroberungen der Mongolen ermöglichten es, dass verschiedene Landwege ins südliche und östliche Eurasien mit den traditionellen kombinierten Land- und Seewegen über Ägypten oder die Levante konkurrieren konnten. Murad schloss Handelsverträge mit Venedig und Genua, die den italienischen Kaufleuten Zugang zu den türkischen Märkten gewährten.50 Vorangetrieben wurde das kommerzielle Zusammenwachsen der Region durch die Bezahlung von Waren mit europäischen Silberbarren, die in ilchanidischen Prägestätten zu Münzen geprägt wurden und von denen manche aus frisch erschlossenen Bergwerken in südslawischen Ländern stammten.51 Die Ilchaniden betrieben über 200 Münzstätten, die Dirhems oder Asper genannte Silbermünzen prägten, wodurch die Monetarisierung des Handels und Investitionen in erweiterte lokale Handelsnetze möglich wurden.52 Zwar stand das alleinige Münzrecht den herrschenden Ilchaniden zu (es war ein wichtiger Ausweis von Souveränität), aber den türkischen Emiren in Kleinasien war es gestattet, anonym und einmalig geprägte Silbermünzen in Umlauf zu bringen; vielleicht zählte dies zu den Bestrebungen, die Loyalität dieser Vasallen zu erhalten, indem man ihnen erlaubte, von einer für beide Seiten vorteilhaften Finanzgemeinschaft zu profitieren.53 Der Sturz der Ilchaniden um die Mitte des 14. Jahrhunderts fiel mit einer Silberknappheit zusammen, die sich aus dem Unvermögen der europäischen Monarchen ergab, eine ausgeglichene Handelsbilanz aufrechtzuerhalten. Die türkischen Emire griffen zu den unterschiedlichsten Taktiken, um damit zurechtzukommen. Eine bestand in einem Wechsel zum Gold, besonders zum venezianischen Dukatenstandard oder zu heimischen Nachprägungen davon.54 Zusätzlich begannen die Fürsten ihre eigenen Münzen zu prägen, einige davon aus lokalen Silbervorkommen. Mehrere türkische Emire gaben in Machart und Aussehen ähnliche Münzen aus, kleine Silberprägungen nach dem Muster des byzantinischen Hyperperon, die in eingeschränktem lokalen Umlauf blieben.55 Die osmanische Variante dieser Münze nannte man akçe.
Zu den gehandelten Gütern zählten Getreide, Obst, Baumwolle und Wein, allesamt für den lokalen Verbrauch, außerdem Waren wie Alaun und Seide, die für die weiträumigere transatlantische Handelswirtschaft bedeutsam waren. Wichtiger als alle diese Handelsgüter aber waren Sklaven – Kriegsbeute, die bis zum Eintreffen von Lösegeld festgehalten wurde oder aber für den Markt bestimmt war.56 Die Bandbreite und Komplexität der verschiedenen Kategorien menschlicher Gefangener in dieser Welt entziehen sich dem schlichten deutschen Begriff „Sklave“.57 Griechische Quellen beklagten häufig, dass es das Schicksal christlicher Gefangener sei, von den Türken in die Sklaverei verkauft zu werden, doch die Versklavung war keineswegs eine ausschließlich türkische Angelegenheit. In der gesamten Region existierte bereits ein ausgedehnter mittelalterlicher Sklavenhandel, in dessen Verlauf versklavte tatarische Türken aus dem nördlichen Schwarzmeergebiet, die für Westeuropa und Ägypten bestimmt waren, auf den Märkten von Kreta, Naxos, Rhodos und Chios verkauft wurden.58 Venezianer, Ungarn und Slawen versklavten in ihren Kriegen auch weiterhin die türkischen Soldaten, die ihnen in die Hände fielen, und verkauften die Bevölkerung eroberter Städte in die Sklaverei.59
Was die türkischen Raubzüge bewirkten, war, dass auf den bestehenden wie auf neuen Märkten ein ergänzender Handel mit lokalen griechischen Sklaven aus den Küstenregionen Kleinasiens und der Ägäis entstand. Ibn Battuta kaufte an zwei Orten in Kleinasien Sklaven, wurde vom Emir von Aydın mit einem Sklaven – einem griechischen Zwerg – beschenkt, und zwei seiner Sklaven entliefen ihm in Magnesia. Ihm fiel die Verbindung zwischen Sklaverei und Prostitution auf.60 Und auch ein Lösegeld bedeutete nicht zwangsläufig die Freiheit. So befreite Palamas einen früheren Sklaven, einen Christen, der zwar losgekauft worden war, sich nun aber in Schuldknechtschaft bei seinem Freikäufer, einem christlichen Händler, befand.61 Die griechisch-orthodoxen Legaten, die mit dem Aushandeln eines antitürkischen Bündnisses befasst waren, machten die Freilassung jener griechischen Sklaven, die lateinischen Christen gehörten, sowie einen Stopp des Sklavenhandels zur Vorbedingung jeder byzantinisch-römischen Kirchenunion.62 Die Hinweise auf den Verkauf versklavter Gefangener sind so zahlreich, dass die Schlussfolgerung nicht ganz abwegig wäre, das Hauptmotiv sämtlicher Kriege sei für alle Seiten der Erwerb von Sklaven zu Lösegeldzwecken gewesen.
Die türkische Sprachfamilie
Die Turksprachen bilden eine Familie aus mehreren Dutzend Dialekten, die während des Mittelalters quer durch Eurasien gesprochen wurden. Ihre erste linguistische Analyse bildete das 1082 auf Arabisch vorgelegte „Kompendium der Turksprachen“ (Diwan Lugat al-Turk). Sein Autor, ein karakhanidischer Türke namens Mahmud al-Kaschgari, leitet sein Werk wie folgt ein:
Als ich sah, dass Gott der Allerhöchste die Sonne des Glücks im Wendekreis der Türken hatte aufgehen lassen …, [da sah ich ein, dass] jeder vernünftige Mann sich ihnen anschließen muss oder aber sich ihren herabregnenden Pfeilen aussetzt. Und keinen besseren Weg gibt es, sich ihnen zu nähern, als durch das Sprechen ihrer eigenen Sprache, wodurch man ihr Ohr gewinnt und ihr Herz bewegt …
Ich hörte es von einem der verlässlichen Auskunftgeber unter den Imamen von Buchara und von einem weiteren Imam aus dem Volk von Nishapur; sie beide berichteten die folgende Überlieferung, und beide wussten eine Kette von Zeugen, die zurückreichte bis zum Gesandten Gottes, möge Gott ihn segnen und ihm Frieden verleihen. Als er über die Zeichen der Stunde und die Prüfungen am Ende der Zeit sprach und das Auftreten der oğusischen Türken erwähnte, da sprach er: „Lernt die Sprache der Türken, denn ihre Herrschaft wird lang sein.“ Wenn nun aber dieser Hadith verlässlich ist und die Beweislast auf diesen beiden liegt – ja, dann ist es eine Glaubenspflicht, sie zu lernen; und wenn er nicht verlässlich ist, so verlangt es gleichwohl die Weisheit.
Ich habe ihre Städte und Steppen bereist und habe ihre Dialekte und Verse erlernt: die der Türken, der Turkmen-Oğusen, der Tschigilen, der Yaghma und der Kirgisen. Außerdem bin ich einer der Sprachgewandtesten unter ihnen und im Sprechen der Beredteste, der mit dem am weitesten zurückreichenden Stammbaum und der, der am tiefsten durchdringt, wenn man die Lanze schleudert. So habe ich den Dialekt einer jeder ihrer Gruppen perfekt erlernt und habe ihn in ein umfassendes Buch, in ein wohlgeordnetes System gebracht.a

Abb. 1.3: Englische Übertragung von Kaschgaris Karte der Turksprachen. Oben ist Osten; die Oğusen befinden sich links in der Mitte der Karte. Beim Original handelt es sich um eine kräftig kolorierte Illumination zu einer Handschrift. Diese Version der Karte entstand für die englische Übersetzung von Kaschgaris Buch, die Robert Dankoff und James B. Kelly 1982–85 in Harvard publiziert haben.
aMahmud al-Kaschgari: Compendium of the Turkic dialects, hrsg. und übers., mit einer Einleitung und Registern versehen von Robert Dankoff und James B. Kelly, Harvard: Harvard University Press, Bd. 1, S. 7
Das spirituelle Vokabular der gewaltsamen Umwälzung
In einem Jahrhundert, als Bulgaren, Byzantiner, Franken, Normannen, Alanen, Petschenegen, Serben, Genuesen und Venezianer einander allesamt mit praktisch denselben Methoden und Folgen bedrohten, waren die Türken schwerlich ein einmaliges Phänomen. Sie waren nicht die einzigen Krieger, denen es auf Raubzüge, Plünderungen und Versklavung ankam, und sie waren auch nicht die einzigen, die das Ergebnis als gottgewollt rechtfertigten. Allerdings fand diese gemeinsame Sichtweise ihren je eigenen kulturspezifischen Ausdruck.
Im lateinischen Europa beispielsweise war das Ideal des Kreuzfahrers noch sehr lebendig. Johannes Kantakuzenos erinnerte sich an das Aushandeln einer Allianz gegen die Türken mit Papst Clemens VI., der „der Ansicht war, dass es den größten Gewinn bringe, im Kampf für eine solche Sache zu sterben“.63 Und während die türkische Variante dieser landläufigen Einstellung zwar durchaus gewisse Elemente der koranischen Vorstellung vom Dschihad einschloss, ähnelte sie doch stärker dem heiligen Krieg in der Tradition der zentraleurasischen Steppe, der großen Wert auf die Dynastie legte, die durch Gottes besondere Gunst zur Eroberung der Welt bestimmt war.
Von daher war die Bevorzugung einer einzigen religiösen Überlieferung bei Mongolen und Türken nicht unvereinbar mit der Realität religiöser Unterschiede. Mit der Eroberung gingen keine Erwartungen einer Massenbekehrung einher.64 In einem Brief von 1246 überhäufte der mongolische Großkhan Güyük Papst Innozenz IV. mit Fragen: „Wie könnte jemand aus eigener Kraft gegen das Gebot Gottes erobern oder töten? […] Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang sind alle Lande mir untertan geworden. Wer könnte das gegen den Befehl Gottes vollbringen?“65 Und doch war das Mongolenreich an religiöser Vielfalt und Toleranz schwerlich zu überbieten. Güyüks Nachfolger Möngke beschied Wilhelm von Rubruk: „Wir Mongolen […] glauben, dass es nur einen Gott gibt, durch den wir leben und sterben, und vor ihm haben wir ein aufrechtes Herz. […] Aber genau wie Gott der Hand verschiedene Finger gegeben hat, so hat er den Menschen verschiedene Wege gegeben.“66 Genauso bemerkte Gregorios Palamas über Orhan: „Während es die Pflicht des Dieners oder eines jeden gewöhnlichen Menschen ist, von einem einzigen Glauben höchstens rudimentäre Kenntnisse zu besitzen, ist es für denjenigen, der viele Völker unter seiner Herrschaft hat, notwendig, von allen Glaubensrichtungen genaue Kenntnisse zu besitzen.“67
In Kleinasien drückte der Begriff gaza diesen Aspekt der gemeinsamen türkisch-mongolischen Weltsicht in einem naturalisierten islamischen Idiom aus.68 Gaza bedeutete Kriegführung zur Ausdehnung des weltlichen Reiches muslimischer Herrscher. Jemand, der gaza betrieb, war ein gazi. Durch die Teilnahme an der gaza spielten die Türken eine führende Rolle im großen Drama der Heilsgeschichte, der Ausdehnung der islamischen Souveränität. Die Gazis waren es, die jenen Krieg führten, welcher Gottes Herrschaft über die ganze Welt bekräftigte. Diese Vorstellung war bei den Türken lange Zeit populär, auch in türkischen Gesellschaften, die untereinander so verschieden waren wie das mamlukische Ägypten und das Indien der Mogul-Herrschaft.69 Djihad dagegen war ein Begriff aus dem Koran, der „Kampf“ bedeutet. Im Koran erscheint er fast durchweg in der Wendung jihad fi’s-sabil Allah, „(mühsamer) Kampf auf dem Wege Gottes“. Dschihad war geistliche Kriegführung, ein facettenreicher Kampf gegen die Feinde der Herrschaft Gottes in der Seele des Menschen wie draußen in der Welt. Ein Mensch, der sich am Dschihad beteiligte, wurde mujahid genannt.
Da sich die Bedeutungen beider Begriffe in gewissem Sinne überschnitten, bildete man aus gaza und Dschihad im alltäglichen Sprachgebrauch oft ein poetisches Paar. Sultan Orhan, der zweite Osmanensultan, nannte sich auf einer berühmten Inschrift in Bursa „Sultan der Gazis, Gazi und Sohn eines Gazi“ sowie Mujahid fi sabil Allah, „Kämpfer auf dem Wege Gottes“. Die Grabinschrift des Evrenos, eines türkischen Vasallen Orhans und später Murads, pries ihn als „König der Gazis und Mudschahid“.70 In islamischen Katechismen, die an den türkischen Höfen Kleinasiens sowohl in Übersetzungen aus dem Arabischen wie auch als türkische Originalausgaben beliebt waren, finden sich Abschnitte, die den Unterschied zwischen Gaza und Dschihad erläutern, passende Bedingungen für den Kampf festlegten und das dabei geltende Kriegsrecht ausführten.71 So wurde die Gaza ein potenzielles Mittel für den Brückenschlag von der türkischen und mongolischen Steppentradition zur islamischen Tradition, deren Ansprüche auf universale Souveränität 1258 bei der mongolischen Plünderung Bagdads zusammen mit dem letzten Kalifen aus der seit 750 regierenden Dynastie der Abbasiden praktisch zu Grabe getragen wurden.72
Obwohl Kriegführung für die türkischen Eroberer der kleinasiatischen Küstenregionen ein zentrales Anliegen war, erschöpfte sich ihr geistlicher Wortschatz keineswegs in Begriffen wie Gaza und Dschihad. Türkische Muslime hatten sehr viel weitläufigere Interessen. Ibn Battuta stieß auf einen unverwechselbar türkischen Islam, der mittels öffentlicher Wohltaten verbreitet wurde, welche die Grundlage für eine Wiederbelebung des Glaubens schufen.73 Überdies haben sich Berichte über eine bemerkenswerte Reihe muslimisch-christlicher Dialoge unter Teilnahme von Gregorios Palamas erhalten, die Frucht seiner fast einjährigen türkischen Gefangenschaft. Des Weiteren zeugt auch die religiöse Architektur der siegreichen türkischen Herrscher davon, wie sehr sie bereit waren, andere Religionen weitgehend einzubeziehen.