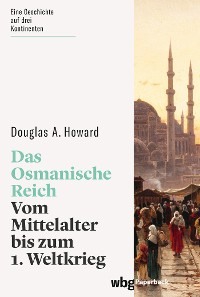Kitabı oku: «Das Osmanische Reich», sayfa 3
Der byzantinische Bürgerkrieg
Die regionalen Gegebenheiten, unter denen Orhans kleines türkisches Emirat erstmals ein wichtiger Faktor in dieser größeren Welt wurde, bestanden aus einer dynastischen Krise in Byzanz. Hinter dieser Krise steckten größere Fragen sowohl der orthodoxen Glaubenstradition als auch der internationalen Politik. In den Jahren nach der Wieder herstellung der griechischen Herrschaft über Konstantinopel setzte Michael VIII. auf langfristige Sicherheit für Byzanz, sowohl durch ein Bündnissystem mit dem Königreich Ungarn und den Türken und Mongolen der Steppe nördlich des Schwarzen Meeres als auch durch Vereinigung der orthodoxen Kirche mit Rom. In den Augen zahlreicher Orthodoxer, Kleriker wie Laien, waren Ehebündnisse mit Nachbar dynastien – sei es mit der Tochter des Königs von Ungarn oder der Tochter des Tatarenkhans – ebenso sehr Politik. Die Kirchenunion mit Rom jedoch – die 1274 auf dem Konzil von Lyon besiegelt wurde – erregte Abscheu, und Michaels Nachfolger Andronikos II. (1282–1328) ignorierte sie. Am Ende konnte die Politik Byzanz nicht retten, steuerte die Kirche jedoch in schwere Prüfungen und letztendlich in einen Wandel. Andronikos II. verwaltete das paradoxe Nebeneinander aus byzantinischem Souveränitätsverlust und sich ausbreitender orthodoxer Erneuerung in den slawischen Ländern. Diese Neubelebung zeigte sich besonders an der mystischen Bewegung der Hesychasten, die sich aus Klostergemeinschaften heraus stürmisch entwickelte. Heimat des Hesychasmus war der Berg Athos, dessen zahlreiche Klöster auf einer Halbinsel in der Ägäis lagen.
Der Konflikt wurde zum offenen Bürgerkrieg, als der damalige Kaiser 1341 starb und den neunjährigen Johannes V. als Erben hinterließ. Der Hof spaltete sich in zwei Parteien. Auf der einen Seite fanden sich als Unterstützer des Jungen seine Mutter, die Kaiserinwitwe Anna von Savoyen, der griechisch-orthodoxe Patriarch und der Großadmiral. Sie plädierten für die Vereinigung mit Rom als Mittel, das Reich durch militärischen Beistand zu stärken. Ihnen schwebte ein wiedererrichtetes Byzanz nach dem Muster der lateinischen Seehandelsstaaten vor. Unterstützt wurden sie dabei durch viele griechische Stadtbewohner.15 Auf der anderen Seite führte der Großdomestikos Johannes Kantakuzenos, ein mächtiger General und Militärberater bei Hof, die Opposition gegen die Kaiserin und ihre Partei an. Kantakuzenos hatte die Rückendeckung der meisten anderen begüterten Aristokraten in Thrakien sowie jener orthodoxen Christen aller Schichten, die gegen eine Vereinigung mit Rom waren. Entscheidend war, dass Kantakuzenos außerdem die Unterstützung des Mönches Gregorios Palamas, des Anführers der Hesychas-ten, hatte.
Die Sympathien für den Hesychasmus bildeten die geistliche Dimension des dynastischen Konflikts. Als Bewegung der persönlichen Erneuerung kreiste der Hesychasmus um das innere Gebet und verwendete das Jesusgebet, das „Gebet des Herzens“, als Meditationsübung. Diese schlichte Gebetsformel, Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner, führte zu heftigem Streit. Zwar hatte der Hesychasmus uralte Wurzeln in der griechischen Spiritualität, doch seine Einführung auf dem Berg Athos im frühen 14. Jahrhundert n. Chr. war die Geburtsstunde einer geistlichen Erneuerungsbewegung. Als türkische Raubzüge in den 1320er-Jahren ein zeitweiliges Ausweichen nach Saloniki erzwangen, kam der Hesychasmus aus seiner monastischen Ecke und wurde zur Massenbewegung. Kritiker griffen ihn als vernunftfeindlich an und spotteten über seine Vorschriften zur yogaartigen Kontrolle der Atmung, doch die Predigten und Schriften des Gregorios Palamas stellten die Bewegung auf festen theologischen Boden. Palamas deutete die Erfahrung des Gläubigen im kontemplativen Gebet als Begegnung mit Gottes Energien in Gestalt des Lichts, desselben Lichts, das Christus auf dem Berg der Verklärung umleuchtet hatte. Rabiat wurde der theologische Schlagabtausch wegen der Unterscheidung, die Palamas zwischen den Energien Gottes und dem Wesen Gottes machte; letzteres sei unzugänglich und unbegreiflich. Der entscheidende Punkt für Palamas war, dass die Theologie allein ungeeignet sei, wahre Gotteserkenntnis hervorzubringen – die Mysterien Gottes überstiegen jede rationale Beschreibung. Die einzige Hoffnung auf Erlösung sei ein Wandel der Seele durch das wahre Licht der Gnade Gottes. In den Augen vieler griechischer Aristokraten, die der wachsende Einfluss italienischen Handelsdenkens beunruhigte, war die hesychastische Spiritualität Ausdruck einer authentischen griechischen christlichen Identität.16 Obwohl es Ausnahmen gab, waren Hesychasten wie Palamas in der Regel starke Unterstützer von Kantakuzenos und widersetzten sich einer Vereinigung mit Rom aus tiefster Seele.17

Karte 1.2: Das Umland der Ägäis
Als Kantakuzenos sich im Herbst 1341 in Thrakien aufhielt, führten der Patriarch und die Kaiserin in der Hauptstadt einen Putsch durch. Sie beschlagnahmten Kantakuzenos’ Vermögen und ließen seine Mitstreiter, darunter Gregorios Palamas, einkerkern. Im Gegenzug erklärte Kantakuzenos sich zum Mitkaiser des Kinderkaisers Johannes V. und ernannte Palamas zum Erzbischof von Saloniki. Doch ein der Kaiserin wohlgesinntes „Zeloten“-Regime übernahm die Herrschaft in Saloniki und hinderte Palamas daran, sein Amt anzutreten, und der Hesychasmus wurde vorerst offiziell verurteilt. Palamas wanderte in den Kerker, und Kantakuzenos floh nach Priština, wo er fast ein Jahr unter dem kühl-berechnenden Schutz des slawischen Königs Stefan Dušan stand. Sobald Kantakuzenos abreiste, wechselte Dušan die Seiten, verlobte seinen Sohn mit der Schwester des Kinderkaisers18 und plünderte ganz Makedonien mit Ausnahme von Saloniki.
Beide byzantinischen Lager suchten Verbündete unter Adligen und Nachbarn, nicht nur bei den Slawen, sondern auch unter den italienischen Stadtstaaten, deren Kolonien in der Ägäis und den zahlreichen türkischen Emiren entlang der Ägäis- und Schwarzmeerküste. Die Kaiserin trat an Orhan heran, fädelte aber nach einer frostigen Reaktion stattdessen die Unterstützung durch Orhans südlichen Nachbarn ein. Kantakuzenos holte sich beim türkischen Emir der Troas eine Abfuhr,19 gewann aber die Rückendeckung des Emirs von Aydın, des mächtigsten aller türkischen Emirate an der Ägäis. Aydın entsandte eine Flotte und Truppen nach Thrakien und verheerte die italienischen Handelsstützpunkte auf den ägäischen Inseln. Doch im Oktober 1344 eroberten die vereinten Truppen des Papstes, Venedigs, des Königs von Zypern und der Johanniter den Hafen und die Zitadelle von Smyrna, eine Niederlage, von der sich Aydın nie wieder ganz erholte.
Nun wandte sich Kantakuzenos an Orhan. Durch Orhans Eheschließung mit Kantakuzenos’ zweiter Tochter, Theodora, besiegelten sie ein dauerhaftes Bündnis.20 2000 türkische Krieger unter Führung von Orhans Söhnen schlossen sich Kantakuzenos’ Sohn Matthaios auf einem Feldzug an, um Stefan Dušan zu vertreiben und Thrakien zu plündern. Die Palastfraktion um die Kaiserin ersuchte um einen Waffenstillstand, und 1347 zog Kantakuzenos siegreich in Konstantinopel ein. Er ließ sich vom Patriarchen krönen und gab seine dritte Tochter, Helena, dem jungen Johannes V. zur Frau, der wie geplant sein Mitregent wurde. Um seine Unterstützung zu demonstrieren, feierte und jagte Orhan gemeinsam mit Kantakuzenos am Bosporus gegenüber von Konstantinopel.21 Kantakuzenos leitete nach seiner Krönung ein Kirchenkonzil, auf dem der Hesychasmus wie erwartet für orthodox erklärt wurde. Man ernannte einen hesychastischen Patriarchen, und Gregorios Palamas konnte sich endlich als Erzbischof in Saloniki niederlassen.
Der Schwarze Tod und das Marmara-Erdbeben
Keine sechs Monate nach dem Festgelage am Bosporus erreichte der Schwarze Tod Konstantinopel. Die Pest traf das Ägäisbecken innerhalb nur einer Generation in zwei Wellen, erst 1348 und dann wieder 1361. Indem sie Eurasien auf den binnenländischen Handelswegen durchquerte, verwüstete sie das Khanat der Goldenen Horde, dann breitete sie sich von den Schwarzmeerhäfen auf der Halbinsel Krim in die Ägäis und das Mittelmeer aus und gelangte über den Kaukasus ins mongolische Täbris. Von dort aus schlug die Epidemie 1348 in Mossul und Bagdad zu. Eine armenische Quelle erwähnt sie am oberen Euphrat. Im Jahr darauf wütete sie an allen Küsten der Ägäis und des Mittelmeers sowie auf Zypern.
Ibn Battuta verlor durch die Seuche seine Mutter. Er wurde Zeuge der Gebete, des Fastens und der Prozessionen, die als Antwort auf die Epidemie im Sommer 1348 in Damaskus abgehalten wurden. „Die ganze Bevölkerung der Stadt schloss sich an“, schrieb er.
Die Juden zogen aus mit ihrem Buch des Gesetzes und die Christen mit ihrem Evangelium, bei sich ihre Frauen und Kinder; die ganze Versammlung in Tränen und demütigem Flehen begriffen, mit dem sie die Gnade Gottes kraft seiner Bücher und seiner Propheten anriefen. Sie zogen zur Moschee der Fußabdrücke und verharrten dort in Bittgebeten und Anrufungen bis beinahe Mittag, dann kehrten sie zur Stadt zurück und hielten das Freitagsgebet ab.22
„Die Verzweiflung war ganz entsetzlich“, schrieb Kantakuzenos über die Situation in Konstantinopel. Er und seine Frau sahen ihren jüngeren Sohn sterben, und „zu der Seuche gesellte sich die schwere Last der Bedrückung“. Für Kantakuzenos war die Epidemie eine Prüfung Gottes, die die Menschen zu tugendhaftem Handeln trieb. „Viele verteilten ihre Habe an die Armen, noch ehe die Seuche sie getroffen hatte. Sahen sie irgendwann erkrankte Menschen, war nicht einer unter ihnen so herzlos, dass er nicht Reue für die von ihm begangenen Sünden zeigte …“23

Abb. 1.2: Der heilige Gregorios Palamas auf einer Ikone vom Berg Athos. Mit freundlicher Genehmigung der Skite des Heiligen Isaak von Syrien
Als Kantakuzenos 1352 seinen überlebenden Sohn Matthaios zum Kaiser krönen ließ, flammte der Bürgerkrieg in Konstantinopel neu auf. Am Ostersonntag machte Stefan Dušan sich in Skopje zum „Kaiser der Serben und Römer“ und rüstete zum Krieg. Wieder einmal nahm Kantakuzenos Kontakt mit den Türken auf. Teil der neuen Abmachung war, dass Truppen unter dem Kommando von Orhans Sohn Süleyman die Festung Tzympe auf der Halbinsel Gallipoli besetzten. Die Lage verschlechterte sich, als Konstantinopel von einer galoppierenden Inflation heimgesucht wurde. Der verzweifelte Palast bat Gregorios Palamas um Vermittlung.
Palamas und sein Mönchsgefolge segelten nach Konstantinopel und fuhren im März 1354 während eines späten Wintersturms in die Dardanellen ein. Nur mühsam gelang ihrem Boot die Landung in Gallipoli. Dort fanden sie ein Bild nackten Elends vor. Am vorausgehenden Samstagabend, dem Vorabend zum Fest der Orthodoxie (dem ersten Sonntag der Fastenzeit), hatte ein Erdbeben die gesamte Gegend dem Erdboden gleichgemacht. Noch im 160 Kilometer weiter östlich gelegenen Konstantinopel spürte man starke Erschütterungen.24 Gallipoli war einschließlich seiner Stadtmauern völlig zerstört und mit Flüchtlingen aus den umliegenden Städten und Dörfern überfüllt. Das Beben machte „nicht nur Gebäude und Besitz, sondern auch Leiber und Seelen … zur Beute für die Hunde und jede Art Aasvögel … menschliche wie nicht menschliche“.25 Viele starben in der eisigen Kälte, in Schnee und Regen, „besonders Frauen und Neugeborene“. Gleich nach dem Erdbeben, so erfuhr Palamas, hatte Orhans Sohn Süleyman die Dardanellen überquert und Gallipoli besetzt. Jetzt enterten türkische Truppen Palamas’ Boot und setzten den Erzbischof und seine Mitreisenden fest.
Als Palamas fast ein Jahr später aus der Gefangenschaft freikam, hatte sich alles verändert. Süleyman hatte Gallipoli stärker als zuvor wieder erbaut. Wie Kantakuzenos gehofft hatte, hatten türkische Ritter zwar Stefan Dušan besiegt, doch gingen sie nun in ganz Thrakien auf Raubzüge und belagerten Konstantinopel. Das Zerbröckeln seiner politischen Position zwang Kantakuzenos zum Thronverzicht.
Die Türken und Europa
Mittelalterliche und moderne Beobachter haben die osmanische Einnahme von Gallipoli 1354 als den symbolischen Anfang der türkischen Expansion nach Europa betrachtet. So schilderte beispielsweise der byzantinische Autor Kritobulos die Überquerung des Hellespont (der Dardanellen) in Worten, die bewusst an Herodots berühmte Beschreibung der Invasion Griechenlands durch Xerxes anknüpften, und nannte Orhans Truppen sogar „die Perser“.a
Aber die Osmanen waren nicht die ersten Türken, die die Meerengen überquerten, und ohnehin verloren sie Gallipoli 1366 (eroberten es aber 1373 zurück). Seit mindestens drei Jahrhunderten waren Menschen aus der zentraleurasischen Steppe in die gesamte Region eingewandert. Wahrscheinlich kamen die ersten Türken von Europa nach Kleinasien statt umgekehrt.b Selbst die geographischen Begriffe sind nicht unveränderlich – in der Antike galt eine andere „Bosporus“-Meerenge, nämlich die zwischen dem Schwarzen und dem Asowschen Meer, als die Trennlinie zwischen Europa und Asien, nicht etwa die bei Byzanz gelegene.c Die Wanderungen halbnomadischer Türken und Indoeuropäer beschränkten sich keineswegs auf das byzantinische Kleinasien.d Spätestens im Jahr 1200 stellten die Türken ein bleibendes Element der Gesellschaften auch in den slawischen Königreichen und in Ungarn dar. In keiner dieser Beziehungen bildeten die Meerengen zwischen dem Schwarzen Meer und der Ägäis eine ausgeprägte Trennungslinie.
Zeitgenössische Beobachter sahen die Bedeutung der osmanischen Besetzung von Tzympe und Gallipoli anders. Sie bescherte den osmanischen Heeren eine vorgeschobene Basis auf der Bithynien gegenüberliegenden Seite der Meerengen, von der aus man Thrakien plündern oder auch Konstantinopel von der Landseite her bedrohen konnte – keine Kleinigkeit für die Osmanen, die damals nur eine dürftige Flotte besaßen.
aKritovoulos, The History of Mehmed the Conqueror, S. 21–27. [Aus Stilgründen wurden Begriffe aus der griechischen Klassik seit der römischen Kaiserzeit gern für Völker, Länder etc. in der jeweiligen Gegenwart zweckentfremdet, was zu Verwirrung führen kann (A.d.Ü.).]
bSinor, „Réfléxions sur la presence Turco-Mongole“, Neudruck in: Sinor, Studies in Medieval Inner Asia.
cO. Pritsak, „The Role of the Bosporus Kingdom“, in: Ascher / Halasi-Kun / Király (Hrsg.), Mutual Effects, S. 3–21.
dZachariadou, „The Oğuz Tribes“.
Murad Hüdavendigâr und die Eroberung Thrakiens
Zwar endete der Bürgerkrieg in Byzanz, doch so bald kehrte kein Friede ein, da Stefan Dušans instabiles slawisches Königreich bei seinem Tod in Konflikten zwischen seinen Erben und Vasallen zerfiel. Bei den daraus resultierenden anarchischen Zuständen in Thrakien spielten türkische Raubscharen sicher eine Rolle und nutzten sie aus, doch war es auch die türkische Eroberung, die nach Jahrzehnten destruktiver Gewalt die Rückkehr von Stabilität und öffentlicher Ordnung brachte.
Nicht Süleyman, der bei einem Jagdunfall ums Leben kam, schloss die osmanische Eroberung Thrakiens ab, sondern Murad, ein anderer Sohn Orhans. Er folgte auf Orhan nach einem Streit mit seinem jüngsten Bruder Halil, dessen Mutter Theodora war, die Tochter von Kantakuzenos. Griechische Piraten entführten Halil und hielten ihn in Konstantinopel fest. Man arrangierte eine Ehe zwischen Halil und der Tochter Kaiser Johannes’ V. zur Festigung der byzantinischen Verbindungen mit dem potenziellen osmanischen Erben,26 doch diese Pläne zerschlugen sich, als Murad Halil besiegte. Der Krieg zwischen den beiden osmanischen Brüdern wuchs sich zu einer großangelegten Eroberung der türkischen Emirate in den Küstenregionen Kleinasiens und am Westrand der Hochebene aus. Viele türkische Emire kapitulierten ebenso wie der christliche Stadtstaat Philadelphia.
Westlich der Meerengen bedeutete Murads Eroberung von Edrene (Adrianopel oder Edirne) am Zusammenfluss der Flüsse Tundscha und Mariza das Aus für viele slawische Fürsten. Der Todesstoß war ein türkischer Sieg an der Mariza im September 1371. Danach stand der osmanischen Herrschaft über Thrakien und Makedonien bis hin zum Südhang des Balkangebirges kein ernsthaftes Hindernis mehr entgegen. Diese Eroberungszüge, die teils Murad selbst, teils seine Vasallen durchführten, welche auch für sich genommen mächtige türkische Feldherren waren,27 dehnten die türkische Einflusssphäre nach Westen in Richtung Adria aus.
Murad erweiterte den osmanischen Einfluss sowohl durch Eroberungen als auch durch Diplomatie. Eheallianzen verbanden ihn mit dem slawischen Fürsten von Tarnovo und den türkischen Emiren von Kastamonu und Sinop. Geschickt nutzte er die Hochzeit seines Sohnes Bayezid, um seinen dazu eingeladenen türkischen Vasallen seine Macht zu demonstrieren.28 Und mit dem Fünftel, das ihm an der Kriegsbeute zustand, schuf sich Murad eine kleine Armee aus Elitesklaven, eine bestens ausgebildete Infanterie, die ihm persönlich ergeben war. Zwar hatte schon Orhan eine kleine Infanterieeinheit besessen, aber Murads stehende besoldete „neue Truppe“ (yeni çeri, daher „Janitscharen“) dürfte als Gegengewicht zu seinen türkischen Vasallen und den lästigen turkmenischen Plünderern geschaffen worden sein, denen ausgerechnet Osman und Orhan ihre Anfangserfolge verdankten.29 Quellen aus dem folgenden Jahrhundert spiegeln den Statusgewinn des osmanischen Herrschers wider. Murad sowie sein Sohn und Nachfolger Bayezid wurden fortan nicht mehr Emir genannt, sondern Sultan und Hüdavendigâr, „Großherr“.
Eine zweite Serie von Feldzügen in den 1380er-Jahren dehnte die türkische Herrschaft ins westliche Thrakien aus. Mehrere befestigte Städte Makedoniens fielen, und 1387 wurde nach vierjähriger Belagerung auch Saloniki eingenommen. Murads Armeen gingen in den südslawischen Ländern und nahe der Adriaküste auf Raubzüge. Einige slawische Erfolge gab es immerhin. Lazar, der Fürst von Kruševac, erlangte Ende 1387 kurzzeitig Niš und die Pässe, die die Straße nach Sofia sicherten, zurück. Im Jahr darauf wurden die Türken und ihre albanischen Verbündeten bei Dubrovnik geschlagen, und auch Tarnovo trotzte Murad. Dieser überschritt das Balkangebirge, erzwang die Unterwerfung von Tarnovo, Silistra und Varna am Schwarzen Meer, dazu aller Festungen bis zur Donau, und fiel plündernd in die Walachei ein. Schließlich traf Murad am 1. August 1389 auf dem „Kosovo polje“, dem Amselfeld, der Kosovo-Ebene, auf ein Bündnis slawischer Streitkräfte unter Lazar.
Kosovo
Der Ausgang der Schlacht auf dem Kosovo war ein wenig doppeldeutig. Sowohl König Lazar als auch Sultan Murad waren tot, und die osmanische Hegemonie über sämtliche südslawischen Länder hatte bereits die entscheidende Schlacht an der Mariza 18 Jahre zuvor sichergestellt. Doch unter den Südslawen wuchs die Legende vom Kosovo zu einem mittelalterlichen Sagenzyklus und nährte später den modernen Mythos von der auferstandenen serbischen Nation.30 Andererseits bildete in türkischen Berichten der heimtückische Mord an Murad den Höhepunkt der Geschichte: Ein christlicher Ritter erstach ihn nach der Schlacht mit einem Dolch, den er im Mantel versteckt hatte. Entweder hatte er sich unter den Leichen verborgen oder war, so einige andere Versionen, als Gefangener ins Zelt des Sultans geführt worden.
Türkische wie slawische Autoren kannten die Geschichten der jeweils anderen Seite. Spätere slawische Chronisten beschlossen, der Mörder habe vorgegeben, zu den Türken überlaufen zu wollen – eine Geschichte, die sie den türkischen Historikern entnommen hatten –, während der türkische Historiker Neşri seinerseits den Namen des Mörders und seinen bei Lazars letztem Abendmahl geleisteten Schwur, den Sultan zu töten, aus den slawischen Quellen einfügte.31 Eine andere finstere Einzelheit, die Schein bekehrung des Mörders zum Islam, erscheint ein Jahrhundert nach Neşri in der Anthologie des Briefwechsels der Sultane.32 Verfasser dieses Werkes war Ahmed Feridun, ein osmanischer Staatsmann unbekannter Herkunft – doch da er als Sekretär von Mehmed Sokollu, dem berühmten slawischen Großwesir der Osmanen, bekannt wurde, wäre es nicht überraschend, falls auch Feridun ein südslawischer Konvertit gewesen wäre. Viele „amtliche Dokumente“, die er in seiner Anthologie sammelte, waren tatsächlich Fälschungen, darunter auch die Kosovo-Geschichte. Sie taucht in einem Brief auf, der von Murads Sohn und Nachfolger Bayezid zu sein behauptet und berichtet, wie er auf den Thron kam.33
Auf jeden Fall brachte man Murad vom Kosovo, wo er gefallen war, heim und begrub ihn in einer neuen Moschee in der Zitadelle von Bursa, der Märtyrermoschee. Bayezid folgte seinem Vater Murad unangefochten, wohl weil er auf dem Schlachtfeld des Kosovo die Hinrichtung seines einzigen Bruders befohlen hatte.34