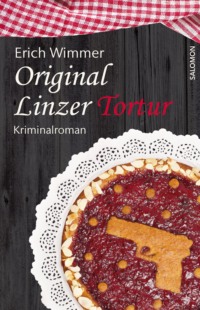Kitabı oku: «Original Linzer Tortur», sayfa 3
4
»Herzlichen Dank, gnädige Frau«, sagte Korab, nahm den Hundert-Euro-Schein mit dezenten, pinzettenartigen Fingerbewegungen in Empfang und versenkte ihn sorgsam in der gähnenden Ledergurgel seiner Geldbörse. Gleichzeitig visualisierte er seine Hauptnahrungsmittel, um fünfzig Prozent verbilligte Brote vom Vortag, deren Erwerb mit diesem Geld für die nahe Zukunft gesichert war. Für Korab wurde jede Art von Nahrung geschmacklich umso interessanter, je näher sie ihrem Ablaufdatum und damit ihrer Verramschung rückte. Außerdem ergaben sich aus der Kombination wegwerfgefährdeter Nahrungsmittel originelle Rezepte, die in keinem Kochbuch der Welt zu finden waren. Altlachs mit Joghurt, Biopilzen und glasigen Bauchspeckstreifen auf Vortagsbrot. Realistisch betrachtet waren sogar solche aus der Not geborenen Experimente reiner Luxus. Aber noch billiger war kaum möglich. Das hatte das entsetzte Gesicht des Bäckers klar zum Ausdruck gebracht, den Korab einmal gefragt hatte, ob es auch Brote vom Vortag des Vortages gäbe, mit entsprechender Vorvortagsvergünstigung. Aktuell hatte sich das Blatt vorübergehend gewendet. Hundert ganze Euro. Es war doch richtig gewesen, hier vorbeizuschauen.
»Kommen Sie weiter«, sagte die alte Dame, »und lassen Sie die Schuhe an. Das ist bei mir so üblich.«
Frau Rabentals Backsteinhäuschen stand mitten im Linzer Wasserwald und war mit diesem billigen, aber unverwüstlichen Nachkriegsrieselputz versiegelt, der Korab immer schon als Folie eines Alptraums erschienen war. Spitze Finger und Zungen, die eine betongraue Meeresoberfläche durchbrechen wollen, aber in dem Moment erstarren, wo sie die Freiheit berühren. In den Innenräumen roch es nach billigen Putzmitteln. Auf alten, aber gepflegten Truhen standen haufenweise kleine menschliche Holzfiguren mit ernsten, psychologisch vieldeutigen Gesichtern, die aber in ihrer Gesamtheit ironisch wirkten, weil sich ihre Kleinheit und ihre Ernsthaftigkeit aneinander brachen.
»Haben Sie die Nachrichten der letzten Woche verfolgt?«, kam Frau Rabental sofort zur Sache, während Korab Platz nahm in einem süßsenfbraunen Polstersessel, dessen Stoffbezug an manchen Stellen verblichen war, als hätte man ihn mit feinem Schmirgelpapier bearbeitet. Räude, schnöder Götterfunken, verballhornte Korabs inneres Amt für die Erneuerung alter Wortdenkmäler.
»Im Großen und Ganzen«, antwortete er, dachte dabei an die Gratiszeitungen, denen er notgedrungen seine Informationen verdankte, und suchte schließlich nach Schubladen für sein Gegenüber. Alte Lady. Mitte bis Ende Siebzig. Hoher, windschlüpfriger Haarhelm mit milchkaffeeweißem Grundton. Adlernase und Adlerblick, unheimlich heimlich und scharf. Kann wahrscheinlich trotz ihres Alters immer noch aus hundert Metern Höhe eine kleine Wiesenmaus orten, würde die Maus aber nach dem Sturzflug bestimmt laufen lassen und sich von Grashalmen und Kräutern ernähren.
»Gut«, sagte Frau Rabental, »dann haben Sie sicher von dem Mord am Froschberg gelesen, diesem Mord an dem pensionierten Waffengroßhändler Ernst August Wagner.«
»Hab ich«, bestätigte Korab, während er einen Bleistift und sein Sudelbuch zückte, in dem er sich die Eckdaten zu notieren gedachte. »Soweit ich das mitbekommen habe, sucht die Polizei dringend nach seiner Frau. Die ist seither verschwunden.«
»Aber Lotte Wagner hat nichts mit dem Mord zu tun!«, ereiferte sich Frau Rabental. »Rein gar nichts!«
»Woher wissen Sie das?«, fragte Korab.
»Genau darum geht es«, sagte Frau Rabental, »aber damit Sie das verstehen, muss ich ein wenig ausholen. Vor einiger Zeit habe ich diesen Brief bekommen …«
Aus einer unscheinbaren Mappe, die auf dem Wohnzimmertisch lag, nahm Frau Rabental ein einzelnes Blatt und reichte es Korab.
»Anfänglich«, fuhr sie fort, »habe ich das Ganze für eine Seniorenabzocke gehalten. Ich war sogar kurz davor, den Brief in den Müll zu werfen. Jorge, ein unbekannter Neffe aus Südamerika, schreibt ausgerechnet mir, weil ihm mein Schicksal so sehr am Herzen liegt. Mehr Klischee geht gar nicht. Aber dann habe ich aus Spaß weitergelesen und wurde stutzig. Dieser Jorge wusste Dinge über meine Schwester, die man unmöglich erfinden kann. Zum Beispiel die Nummer, die man Esther damals ins Handgelenk tätowiert hatte, und die genaue Stelle von einem Muttermal. Meine Schwester und ich, wir waren beide als Kinder zusammen mit unseren Eltern im KZ Mauthausen und Gusen. Dort wurden wir getrennt. Ich habe überlebt und glaubte, dass man alle anderen ermordet hat. In seinem Brief behauptet dieser Neffe, dass es umgekehrt genauso war. Esther sei überzeugt gewesen, dass meine Eltern und ich das Lager nicht überlebt hatten. Ihr war das auch von verschiedenen Seiten bestätigt worden, und deshalb hat sie auch keine Nachforschungen angestellt, nachdem sie bei einer Adoptivfamilie untergekommen war, die mit ihr nach Südamerika ging. Ja, und dort hat Esther ihr ganzes weiteres Leben verbracht.«
Frau Rabental gönnte sich eine kurze Nachdenkpause und sprach dann konzentriert weiter.
»Vor Kurzem ist sie gestorben, und ihr Sohn hat in ihrem Nachlass ein kleines Notizbuch gefunden, das ihr ein katholischer Priester namens Johann Gruber noch im KZ anvertraut hat. Sie wollte sich aber mit den schlimmen Erinnerungen nicht mehr auseinandersetzen. All die Jahre hat sie das Buch in irgendeiner Dachbodenkiste aufgehoben. Jetzt, nach ihrem Tod, hat ihr Sohn darin gelesen und etwas Ungeheures festgestellt: Das kleine Buch enthält detaillierte Aufzeichnungen über die Enteignung von jüdischen Familien am Ende der Dreißigerjahre in Linz. Unter anderem auch, und jetzt kommt’s, von unserer Familie. Ariel, unser Vater, hat damals in seiner Verzweiflung zusammen mit einem Anwalt Herrn Gruber aufgesucht und ihm eidesstattlich erklärt, dass er unser Mehrfamilienhaus an der Landstraße niemals freiwillig an den regimetreuen Hausmeister Porofsky abgetreten hat. Vielmehr habe man ihn unter Androhung körperlicher Gewalt – auch seiner Familie gegenüber – gezwungen, die Immobilie zu einem Spottpreis zu verscherbeln. Diese Aussage meines Vaters sowie mehrere andere, vergleichbare Fälle wurden von Dr. Gruber schriftlich festgehalten und gesammelt. Dieser katholische Priester war für viele meiner jüdischen Mitmenschen die letzte, moralisch noch integre Anlaufstelle. Zum Beweis, dass diese Geschichte echt ist, hat mein Neffe eine unseren Fall betreffende Seite dieses Dokumentes kopiert und dem Brief beigelegt.«
Frau Rabental nahm das nächste Blatt aus der Mappe und reichte es Korab.
»Wie ist dieser Neffe überhaupt auf Sie gekommen?«
»Das steht am Schluss des Briefes«, sagte Frau Rabental, »aber ich kann es Ihnen auch gerne erklären. Jorge, mein Neffe, hat einfach angefangen zu recherchieren. Er hat meinen Namen ins Internet eingegeben und ist auf die Homepage der Hauptschule gestoßen, an der ich vierzig Jahre als Werklehrerin gearbeitet habe. Dort gibt es auch ein Verzeichnis aller ehemaligen Lehrer. Von da aus war es leicht, meine Adresse herauszufinden.«
»Voraussetzung dafür war aber«, ergänzte Korab, »dass Sie immer noch Ihren Mädchennamen tragen.«
»Ganz genau«, bestätigte Frau Rabental, »ich habe nie geheiratet. Sie denken wirklich mit.«
»Ja, ab hundert Euro surfe ich mit beiden Hirnhälften gleichzeitig«, sagte Korab, »aber ich verstehe noch nicht, was Frau Wagner mit dem Ganzen zu tun hat.«
»Dann passen Sie bitte gut auf!«, forderte Frau Rabental. »Nachdem ich den Brief erhalten hatte, habe ich selbst bezüglich Dr. Johann Gruber im Internet recherchiert. Und dabei bin ich auf den sogenannten Papa-Gruber-Arbeitskreis gestoßen. Das ist eine Initiative von katholischen Laien, Kirchenhistorikern und Priestern, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Seligsprechung ihres Glaubensbruders voranzutreiben, der im KZ ermordet wurde. Und die Präsidentin dieses Vereins ist Frau Lotte Wagner. Ihr habe ich eine Kopie dieser Dokumentenseite geschickt mit der Bitte, sie möge mir sagen, ob dies tatsächlich die Schrift von Dr. Gruber sein könnte. Ich hatte ja nichts, um die Echtheit der Handschrift zu überprüfen. Und kaum hatte ich ihr geschrieben, da stand sie schon persönlich bei mir in der Tür. Sie wollte alles wissen und alles sehen. Sie hat den Brief mehrere Male gelesen und sich schon während der Lektüre kaum mehr beruhigen können. Sie war so aufgeregt, dass ich kaum vernünftig mit ihr reden konnte. Sie hat mich beschworen, meinem Neffen sofort zu schreiben und zu nötigen, er möge das Originaldokument so schnell wie möglich senden. Gleichzeitig wollte sie, dass ich niemandem auch nur ein Wort von dieser Bombe mitteile, die das Dokument ihrer Meinung nach darstellen würde. Das war ihr Sprachgebrauch. Sie hat immer wieder von einer Bombe gesprochen, die, wenn sie explodiert, einige Linzer Bürger um ihr gesamtes Vermögen bringen könnte. Die Schrift ist ohne jeden Zweifel die originale Handschrift von Papa Gruber. Das hat mir Frau Wagner anhand einiger anderer Schriftproben bestätigt. Außerdem hat sie die Kopie dem Rechtsanwalt ihres Arbeitskreises vorgelegt. Der hat gemeint, dass man mit dem Originaldokument sofort einen Antrag auf Einleitung eines Restitutionsverfahrens stellen könnte.«
»Warum wird dieser Priester überhaupt Papa Gruber genannt?«, wollte Korab wissen.
»Weil er sich im KZ so engagiert für die anderen Häftlinge eingesetzt hat«, sagte Frau Rabental. »Er hat es sogar geschafft, eine Suppe für die Gefangenen zu organisieren. Er war sehr stark im Leid und äußerst beliebt bei den anderen Insassen.«
»Und jetzt glauben Sie, dass der Brief und das Dokument etwas mit Frau Wagners Verschwinden zu tun haben?«, fragte Korab.
»Das glaube ich allerdings«, bestätigte Frau Rabental, »aber ich weiß nicht, was. Frau Wagner hat mir hoch und heilig versprochen, sich an der Finanzierung zu beteiligen. Mein Neffe Jorge hat am Ende des Briefes angedeutet, dass er Geld haben möchte, falls ich am Originaldokument interessiert bin. Ich habe aber keine monetären Reserven, nur meine kärgliche Pension. Aber mit dem Dokument könnte ich die jetzigen Besitzer, diese Porofskys, auf die Rückgabe meiner Immobilie verklagen, die mir laut Erbrecht zusteht. Und für Frau Wagner wäre das Originaldokument ein ungemein hilfreicher Baustein auf dem Weg zur Seligsprechung von Dr. Gruber. Sie hat mehrmals betont, dass dieses Projekt weit mehr ist als eine Beschäftigungstherapie. Dr. Gruber war nicht einfach nur irgendein Lehrer für sie, er war, weil sie eine Waise war, so eine Art Ersatzvater. Und diesem Vater wollte sie immer ein Denkmal setzen. Das ist seit langem der einzige Sinn und das Ziel in ihrem Leben, hat sie mir erklärt, obwohl sie es zwischendurch schon aufgegeben hatte, noch an dessen Verwirklichung zu ihren Lebzeiten zu glauben. Dieses Dokument in den richtigen Händen würde nicht nur einigen Menschen wie mir ihren Besitz zurückbringen, es würde auch die Zeit bis zur Seligsprechung Johann Grubers wesentlich verkürzen.«
»Warum würde es das?«, fragte Korab.
»Das habe ich Frau Wagner auch gefragt«, sagte Frau Rabental. »Für eine Seligsprechung braucht es ein beglaubigtes Wunder oder den Märtyrertod für den Glauben. Das blutige Ende Dr. Grubers steht ja außer Zweifel, aber leider wurde er von der Anschuldigung, er habe sich jungen Mädchen unsittlich genähert, nie rehabilitiert. Ein konkreter Beweis für seine Unschuld würde dem Seligsprechungsprozess einen ungeheuren Schub geben. Am besten wäre natürlich das Geständnis einer dieser mittlerweile uralten Frauen, dass Dr. Grubers Verfehlung nie stattgefunden hat und eine reine Erfindung war, um ihn, den regimekritischen Priester und Volksverräter, loszuwerden und wegzusperren. So haben ihn die Nazis damals bezeichnet, wegen seiner Standhaftigkeit und Liebe zu allen Menschen, auch zu uns Juden. Frau Wagner hat nur in den allerhöchsten Tönen von ihm geschwärmt. Laut ihr war Dr. Gruber ungeheuer asketisch und todesmutig. Dass er unter Lebensgefahr Beweise für Enteignungen und sonstige an unserem Volk verübte Gräuel gesammelt hat und das bei einem derart gnadenlosen Regime, so etwas ist eine äußerst tapfere, selbstlose Tat.«
»Aber wenn Frau Wagner das Dokument so sehr will«, begann Korab, »dann wird sie sich ja früher oder später ohnehin bei Ihnen melden, oder?«
»Nein«, entgegnete Frau Rabental, »sie kann sich gar nicht melden.«
»Warum?«
»Weil ich von der Polizei beobachtet werde«, antwortete Frau Rabental, »ich vermute sogar, dass mein Mobiltelefon abgehört wird. Aber ich weiß nicht, wie sie das machen.«
»Und wie kommen Sie zu dieser Vermutung?«
»Weil die Polizisten immer wieder wechseln und erstaunlich aufdringlich sind. Außerdem wissen sie Details, die ich ihnen gar nicht erzählt habe.«
»Zum Beispiel?«, fragte Korab.
»Zuerst waren es nur zwei Beamte«, antwortete Frau Rabental. »Aber dann ist noch ein dritter gekommen. Er hat mir auf den Kopf zugesagt, dass ich mich weniger um das Seelenheil Pfarrer Grubers kümmern soll, sondern mehr um mein eigenes, dem mit einer Anklage wegen Beihilfe zum Mord nicht gerade geholfen wäre.«
»Wie kommt der auf Beihilfe zum Mord?«, fragte Korab bestürzt.
»Wäre Frau Wagner wirklich die Täterin«, sagte Frau Rabental, »und ich gäbe ihr Versteck nicht preis, dann könnte das ein Richter als Beihilfe zum Mord auslegen und entsprechend bestrafen. Frau Wagner und ich haben in der Gruber-Sache öfter und ausführlich miteinander telefoniert. Das haben die Ermittler durch ein Telefonprotokoll festgestellt.«
»Und?«, fragte Korab, »Was haben Sie den Ermittlern geantwortet?«
»Die Wahrheit. Ich habe denen die gleiche Geschichte erzählt wie Ihnen. Mit dem großen Unterschied, dass die mir höchstens die Hälfte geglaubt haben. Die sind überhaupt nicht interessiert an dem Gruber-Thema. Restitutionsgeschichten sind denen schnuppe. Das ist entsetzlich, aber wahr. Die wollen nur den Mord aufklären und Frau Wagner finden, weil sie glauben, dass sie die Mörderin ist.«
»Haben die Ermittler das so formuliert?«
»So direkt nicht, nein«, relativierte Frau Rabental, »aber zwischen den Zeilen habe ich schon sehr deutlich gespürt, dass die Unschuldsvermutung für Frau Wagner nur bedingt gilt.«
»Wenn sie tatsächlich unschuldig ist«, überlegte Korab laut, »dann könnte sie sich ja stellen und der Polizei alles erklären.«
»Dann ginge es ihr wie mir«, sagte Frau Rabental, »die Polizei würde ihr nur die Hälfte glauben und sie sehr wahrscheinlich in Untersuchungshaft nehmen. Aber sie hat noch etwas Wichtiges zu erledigen und braucht dafür vor allem eines: Zeit.«
»Und wofür genau braucht sie diese Zeit?«, fragte Korab, während er unaufhörlich in sein Büchlein schrieb.
»Das hat sie nur angedeutet. Es hängt, glaube ich, mit den Umständen zusammen, wie Dr. Gruber ins KZ gekommen ist. Aber wie gesagt, darüber weiß ich nichts Näheres.«
Korab versuchte sich an einer Zusammenfassung: »Aber Sie brauchen Frau Wagner, damit die Sie finanziell unterstützt, wenn die konkrete Forderung Ihres Neffen Jorge eintrifft.«
»Ganz genau, Herr Korab«, sagte Frau Rabental sichtlich erleichtert, »also müssen Sie Frau Wagner möglichst unauffällig suchen und finden und dann als eine Art Geldbote fungieren.«
»Aber nehmen wir einmal an, ich finde Frau Wagner nicht«, entwarf Korab ein durchaus realistisches Szenario, »haben Sie dann wirklich keine Möglichkeit, das Dokument ohne fremde finanzielle Hilfe von Ihrem Neffen zu kaufen?«
»Das kommt natürlich auf den Preis an«, gestand Frau Rabental, »aber der wird mit großer Wahrscheinlichkeit außerhalb meiner Möglichkeiten liegen.«
»Und … mit Verlaub … wenn Sie angesichts der zu erwartenden Großimmobilie dieses kleine Haus hier verkaufen?«, fragte Korab. »Mehr, als dieses Haus wert ist, wird Jorge bestimmt nicht verlangen.«
»Da haben Sie recht, Herr Korab«, bestätigte Frau Rabental, »aber dieses Haus gehört mir nicht. Ich bin hier nur zur Miete.«
»Verstehe«, sagte Korab, »und die kleinen Skulpturen draußen beim Eingang? Die sind wirklich gut. Sehen aus wie frühe Arbeiten von Paul Klee. Könnten Sie die nicht verkaufen?«
»Die sind nur von mir. Die bringen kein Geld. Aber … wie kommen Sie auf diesen Zusammenhang mit Klee? Er hat mich tatsächlich inspiriert.«
Der Geist der Adlerin, gerade noch ein ferner Punkt, kam jetzt hinter den Wolken hervor und hypnotisierte die Wiesenmaus. Frau Rabental beugte ihren Vogelkörper in Korabs Richtung und unterstrich mit dieser Geste die Dringlichkeit, mit der ihr Blick eine Antwort forderte.
»Klee ist einer meiner Lieblingsmaler«, erklärte Korab.
»Warum denn das?«, fragte die alte Frau.
»Weil er unzählige Scherzkekse gemalt hat, farbenfroh und zärtlich«, antwortete Korab, »und weil er den Brücken Schuhe auf die Fundamente gezeichnet hat. Seither können sie laufen. Dank ihm haben Brücken ihre statische Schwere verloren. Und ich bin immer dankbar dafür, wenn jemand unser Leben erleichtert, indem er das scheinbar Unverrückbare verrückt.«
»Das ist eine äußerst ungewöhnliche, aber sehr treffende Einschätzung«, sagte Frau Rabental erstaunt. »Wie kommt man als feinsinniger Kleeliebhaber zum rustikalen Beruf eines Privatdetektives?«
Korab empfand diese Frage als alte Bekannte. Wann immer sie auftauchte, griff er zu seiner bewährten Standardformel. Ich habe Kunstgeschichte studiert. Später, als ich gesehen habe, dass man als Kunstvermittler von der Hand in den Mund lebt, habe ich noch den Kurs für Privatdetektive am Linzer WIFI angehängt. Schnüffeln ist mein zweites berufliches Wackelbein. Anstatt diese Antwort einfach auszusprechen, hörte er sich plötzlich etwas sagen, das ihn selbst überraschte.
»Durch Flucht vor der Erwartung anderer.«
Frau Rabental zuckte zusammen. Mit einer neuen Art von Interesse sah sie Korab in die Augen und schien sich dabei zu versichern, ob sie richtig gehört hatte. Korab spürte, dass er dieses Angeschautwerden ohne Skrupel erwidern konnte. Das war kein Taxieren und kein Vorgeplänkel zum Kampf um eine auratische Vorherrschaft. Im Gesicht der betagten Frau spiegelten sich einfach nur alte, prägende Erfahrungen, deren Echo er mit seinem letzten Satz aufgewühlt hatte.
»Und Ihnen ist diese Flucht gelungen?«, fragte Frau Rabental vorsichtig, beinahe zärtlich.
»Vielleicht … aber meiner Schwester nicht«, fügte Korab so leise hinzu, dass er selbst nicht gleich wusste, ob er diesen Satz nur gedacht oder wirklich ausgesprochen hatte.
Obwohl ihn seine plötzliche Offenheit selbst erstaunte und sogar ein wenig erschreckte, spürte Korab gleichzeitig, dass er sich dieser Frau gegenüber nicht zu verstellen brauchte. Jedes Wort, das die Wahrheit nur umspielte, war vor dem gütigen Tribunal dieser fordernden Augen fehl am Platz. Korab ließ die Bilder aufflackern. Jasmins strahlendes Gesicht und die Zuversicht, mit der sie ihn ihren großen kleinen Bruder genannt hatte. Und dann, später, irgendwann, die beiden unvergesslichsten Sätze seines Lebens, ausgesprochen von dem Beamten, der damals in der Leichenhalle auf ihn zugeeilt war, um ihn aufzuhalten: Ich an Ihrer Stelle würde sie nicht mehr anschauen. Bewahren Sie Ihre Schwester so in Erinnerung, wie sie gewesen ist.
»Sie taumeln«, flüsterte Frau Rabental, als hätte sie jeden einzelnen von Korabs Gedanken gelesen. »Aber die Kunst hält Sie in der Spur.«
Korab reagierte nicht. Seine Augen waren feuchte Kübel, versunken in der gespenstischen Zone einer ständig gegenwärtigen Vergangenheit.
»Möchten Sie eine Tasse Tee?«, fragte die alte Frau wie eine Schiffslotsin, der vor einer Tiefe schaudert, die sie vergeblich zu messen versucht. Frau Rabental deutete Korabs Schweigen als Bejahung und verschwand lautlos im Nebenraum.
Es gibt eine innere Landschaft, dachte Korab, wo Menschen wie Frau Rabental unbemerkt und unscheinbar in deiner Nähe leben, gleich im nächsten Tal. Wie viele solcher Täler gibt es in dir? Und wie viele davon erreichst du im Lauf deines Lebens? Das Tal Anita und das Tal Isonzo.
Auch dort hat mich der Zufall hingespült. Und manchmal spült er dich darüber hinaus, und du gelangst in die nächsten vertrauten Gefilde. Dann stehst du da, mit den Haaren am Kopf, wie manche Großväter so treffend formulieren, und fragst dich, ob du nicht schon einmal hier gewesen bist, in einem früheren Leben, in diesem Tal, an diesem Ort mitten im Wasserwald.
»So, bitte sehr«, sagte Frau Rabental und stellte eine kobaltblaue Teetasse vor ihrem Gast auf den Tisch.
»Haben Sie die selbst getöpfert?«, nutzte Korab die Chance und wechselte das Thema.
»Ja.«
»Ein Freund von mir macht das auch«, sagte Korab nachdenklich.
»Das kann ich mir gut vorstellen«, sagte Frau Rabental, nachdem sie wieder Platz genommen hatte, »dass Sie künstlerisch begabte und extravagante Freunde haben.«
»Extravagant ist ein ideales Wort, um ihn zu beschreiben«, bestätigte Korab. »Isonzo ist ein von der Stadt extrahierter Vagant. Er lebt zwischen Wald und Wasser im Schilf.«
»Leben Sie nicht bei ihm?«, fragte Frau Rabental.
Korab verschluckte sich an der heißen Flüssigkeit. Er setzte die Tasse ab, räusperte sich und blickte in Frau Rabentals Richtung, ohne ihr in die Augen zu schauen.
»Warum sollte ich?«, fragte Korab erstaunt.
»Weil Sie dann glücklicher wären.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Durch Ihre Stimme«, sagte die alte Frau. »Ihre Stimme leuchtet, wenn Sie um diesen Ort kreist.«
Korab griff nach einer Serviette, wischte sich über den Mund und dachte dabei an die sagenhaften Schwerter, die anfangen blau oder weiß zu schimmern, wenn sich Feinde nähern. Offensichtlich gab es dieses Phänomen auch umgekehrt. Aber er hatte noch nie davon gelesen, geschweige denn einen Menschen getroffen, dem sich das Spektrum sympathischer Sehnsüchte aus dem Klang von Unter- und Obertönen erschloss.
»Haben Sie Psychologie studiert?«, fragte Korab seine Gastgeberin.
»Ja«, antwortete Frau Rabental, »an der besten Universität, die es dafür gibt, dem KZ. Wenn Sie jahrelang jeden Tag mit Ihrer Ermordung rechnen müssen, dann entwickeln Sie Sinne, die es Ihnen erlauben, Stimmen zu lesen. Selbst als Kinder, die wir damals waren, mussten wir im Lager eine übermenschliche Aufmerksamkeit entwickeln. Und glauben Sie mir, Herr Korab, nicht was ein Mensch sagt, sondern wie er es sagt, entscheidet über Nähe und Ferne, über Sinn und Unsinn, über Leben und Tod.«
»Kann man dieses Stimmenlesen auch ohne Todesgefahr lernen?«, fragte Korab.
»Vermutlich können das alle Künstler«, antwortete Frau Rabental. »Wissen Sie, ich habe auch nicht davon geträumt, Werklehrerin zu werden. Eigentlich wollte ich Bildhauerin werden, aber mein Schicksal hatte etwas anderes mit mir vor. Und ich habe mich gefügt. Sie haben sich noch nicht gefügt. Sie sind noch auf der Suche. Und wenn Sie mir nicht helfen, weil Sie meinen Fall für aussichtslos oder finanziell unergiebig halten, dann muss ich auf die Wiedergutmachung verzichten. Ich kann mir keinen teuren Detektiv leisten. Ehrlich gesagt habe ich auch bei ein paar anderen Detekteien angefragt. Aber dort sind die Preise astronomisch.«
Genau das hatte Korab befürchtet. Dieses wasserwaldwilde Knusperhäuschen war in Wahrheit eine Zwickmühle. Genau deshalb hatte er die anderen Möglichkeiten zumindest andiskutiert. An ihn wandte sich nur eine ganz besonders gebeutelte Menschengattung, die der hilflosen Hungertuchnager. Schon an seine Wiege war das Schicksal mit der Posaune herangetreten und hatte verkündet, dass seine zukünftigen Klientinnen entweder junge Malerinnen ohne fixes Einkommen sein würden, wie in seinem letzten Fall Julia Hofer, oder alte Werklehrerinnen wie Frau Sarah Rabental, deren Pension so klein war, dass man sie sogar mit dem Elektronenmikroskop vergeblich suchte. Korab gebot sich, nicht zu seufzen.
»Ein wenig Bakschisch müssen Sie mir aber schon zahlen. Immerhin habe ich laufende Recherchekosten. Die halte ich so gering wie möglich – ebenso wie meinen Stundenlohn. Das kann ich aber nur, weil mich geniale Freunde unterstützen. Deren Geduld und Mitgefühl ist für mich heilig. So heilig, dass ich sie auf gar keinen Fall über Gebühr beanspruchen werde. Also brauche ich auch von meinen Kunden immer wieder einmal das, was Sie mir am Anfang unserer Begegnung zukommen haben lassen, echtes, gültiges Bargeld.«
»Ich verstehe Sie natürlich und danke Ihnen sehr«, sagte Frau Rabental. »Über ein kleines Grundeinkommen verfüge ich ja … und, Herr Korab, seien Sie versichert, dass ich Sie garantiert nicht vergesse, sollte ich das Haus an der Landstraße tatsächlich zurückbekommen.«