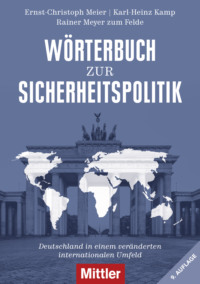Kitabı oku: «Wörterbuch zur Sicherheitspolitik», sayfa 23
Eindämmungspolitik
(engl.: containment)
Bestimmendes Element der Politik der Vereinigten Staaten von Amerika (Truman-Doktrin) gegenüber der Sowjetunion nach Zerbrechen der Kriegsallianz. Nach einem 1947 von George F. Kennan abgefassten Analysebericht über die ideologisch-imperialistische Politik Josef Stalins benannte Strategie, nach der der sowjetischen Expansion nach dem Zweiten Weltkrieg durch militärische Stärke und, an bedrohten Stellen, durch wirtschaftliche Hilfe Einhalt geboten werden sollte. Im Rahmen dieser Politik entstanden die Vertragssysteme in Europa (Nordatlantische Allianz 1949), im Nahen und Mittleren Osten (CENTO, 1955–1979) und in Südostasien (SEATO, 1954–1975). Roll Back
Eindringende Aufklärung
Eine Form der Aufklärung, die in fremdem Hoheitsgebiet bzw. im Kriege auch in feindlichem Gebiet stattfindet. Sie hat zum Ziel, geografische Bereiche abzudecken und/oder qualitative Anforderungen zu erfüllen, die mit Abstandsaufklärung nicht zu erreichen sind.
Einfrieren
(engl.: Freeze)
Konzeptioneller Schritt der Rüstungskontrolle, bei dem Umfänge von Streitkräften wie Personal, Waffen, Einrichtungen für einen bestimmten Zeitraum festgeschrieben (eingefroren) werden, um das bestehende Kräfteverhältnis für laufende oder spätere Verhandlungen zu erhalten. Memorandum
Eingreiftruppe
(engl.: Intervention Force)
Militärische Einheit, Verband oder Großverband im Allgemeinen mit hohem Ausbildungsstand in jeweils unterschiedlicher Stärke, Ausrüstung und Zusammensetzung, der national oder international gegliedert eingesetzt werden kann und der sich durch rasche Verfügbarkeit und Verlegbarkeit auszeichnet. Multinationale Großverbände; NATO Reaktionskräfte; Machtprojektion
Einheit
Die unterste militärische Gliederungsform, deren Führer Disziplinargewalt besitzt. In der Bundeswehr wird ein solcher Truppenteil entsprechend der Zugehörigkeit zur Truppengattung Kompanie, Batterie oder Staffel genannt.
Einheitliche Europäische Akte (EEA)
Grundlage für die Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaften (EG) zur Europäischen Union (EU). Am 28. Februar 1986 wurde die ~ unterzeichnet und trat zum 1. Juli 1987 in Kraft. Neben dem Kernstück der ~, dem Programm für den europäischen Binnenmarkt, wurde auch die Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ) auf eine vertragliche Grundlage gestellt. Der Europäische Rat wurde mit der ~ eine verbindliche Institution der EG, das Europäische Parlament wurde mit weitergehenden Rechten ausgestattet, insbesondere zu Fragen des Beitritts neuer Mitglieder. Europäische Union
Einheitsstaat
Staatsform, in der ein Staat durch Einteilung in Verwaltungs-, beim dezentralisierten ~ auch in eigenständige Selbstverwaltungskörperschaften, nicht aber in Eigenstaatlichkeit besitzende Gliedstaaten (»Länder«) aufgeteilt ist. Bundesstaat; Staatenbund
Einigungsvertrag
Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland (DEU) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) vom 31. August 1990. Ziel des ~ war es, möglichst rasch die Voraussetzungen einheitlicher Lebensverhältnisse in ganz Deutschland zu schaffen. Der ~ sollte den dramatischen Veränderungen seit dem Fall der Berliner Mauer in politischer, wirtschaftlicher und sozialer Sicht Rechnung tragen. Mit dem Wirksamwerden des Beitritts der DDR zum Anwendungsbereich des Grundgesetzes (GG) erlosch die DDR als Staat, und die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wurden Länder der Bundesrepublik Deutschland. Die 23 westlichen und östlichen Bezirke von Berlin bilden das Land Berlin. Berlin wurde durch Abstimmung des Deutschen Bundestages vom 20. Juni 1991 als deutsche Hauptstadt bestätigt.
Die Präambel des Grundgesetzes (GG) wurde geändert. Anstelle des Auftrages des GG, die Deutsche Einheit zu vollenden, rückt die Festschreibung: »Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk.«
Für einen Übergangszeitraum bis 31. Dezember 1995 konnte das Recht in den neuen Bundesländern in Einzelfällen vom Bundesrecht abweichen. Wesentliche sicherheitspolitische Parameter sind:
•Anerkenntnis der Unverletzbarkeit der Grenzen in Europa,
•für D keine offenen Grenzfragen mehr,
•Zwei-plus-Vier-Vertrag,
•Verbot der Stationierung von Nuklearwaffen auf dem Gebiet der neuen Bundesländer.
Einrichtung, militärische
Anlage, Einrichtung, Infrastruktur oder Objekte, die unmittelbar oder mittelbar der Auftragserfüllung der Streitkräfte dienten. ~ sind in der Regel besonders gekennzeichnet.
Einsatz
In der Bundesrepublik Deutschland das Heranziehen von Truppen zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen des vorgegebenen Auftrages.
Einsatzausbildung
Ausbildung mit dem Ziel des Herstellens der vollen Einsatzbereitschaft von Soldaten mit ihren Waffensystemen in ihrem angestammten Truppenteil oder in besonderen Formationen durch entsprechende Ausbildung.
Einsatzbereitschaft
Fähigkeit von Streitkräften, einen festgelegten Auftrag mit dem dafür erforderlichen Personal und Material über einen bestimmten Zeitraum zu erfüllen. Durchhaltefähigkeit
Einsatz der Streitkräfte im Innern
Der ~ ist verfassungsrechtlich nur ausnahmsweise und nur dann zulässig, wenn das Grundgesetz selbst dies ausdrücklich gestattet (Art. 87a Abs. 2 GG). Der verfassungsrechtliche Einsatzbegriff meint die Verwendung der Streitkräfte als Mittel der vollziehenden Gewalt. Der Verfassungsvorbehalt betrifft also eine hoheitliche Verwendung von in der Regel bewaffneten Vollzugsorganen. Nicht unter den Einsatzbegriff fallen alle Formen technischer Hilfeleistung, die im Wege der Amtshilfe gemäß Art. 35 Abs. 1 GG auch durch Streitkräfte geleistet werden können. Hierunter fallen insbesondere technisch-logistische Unterstützungsleistungen ohne Androhung und Anwendung hoheitlicher Zwangs- und Eingriffsbefugnisse. Auch die Unterstützung bei der Flüchtlingshilfe erfolgte im Rahmen von Art. 35 Abs. 1 GG. Jegliche bisherige Unterstützung der Bundeswehr bei Naturkatastrophen und besonders schweren Unglücksfällen (z. B. Hochwasser, Schneekatastrophen oder Waldbränden) wurde im Rahmen von Art. 35 Abs. 1 GG geleistet. Zusätzlich zu Unterstützungsleistungen nach Art. 35 Abs. 1 GG kann die Bundeswehr bei Naturkatastrophen und besonders schweren Unglücksfällen im Rahmen von Art. 35 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 GG auch hoheitliche Zwangs- und Eingriffsbefugnisse wahrnehmen. Das Bundesverfassungsgericht hat die allgemeinen Voraussetzungen des Art. 35 Abs. 2 und 3 GG für einen Streitkräfteeinsatz in mehreren Entscheidungen zwischen 2006 und 2013 näher ausgelegt. Von einem besonders schweren Unglücksfall darf auch dann ausgegangen werden, wenn dieser durch Menschen absichtlich herbeigeführt wird (Terroranschlag). Die Abwehrkräfte – ggf. auch die Streitkräfte – dürfen bereits (unmittelbar) vor Eintritt des Unglücksfalls eingesetzt werden, um die Gefahr abzuwenden. Der Begriff des besonders schweren Unglücksfalls ist eng auszulegen. Er umfasst nur Ereignisse von katastrophischen Dimensionen. Dann ist jedoch nicht nur der Einsatz der Streitkräfte, sondern auch Verwendung spezifisch militärischer Ausrüstung und Waffen der Streitkräfte möglich. Ausgeschlossen bleibt auch dann, dass im Fall eines menschlich herbeigeführten Unglücksfalls (Terroranschlag) Waffen gegen Unbeteiligte oder Menschenmengen (vorbehaltlich der Hürde im Notstand) eingesetzt werden.
Einsatzflottille
In der neuen Struktur der Deutschen Marine sind seit Juni 2006 die vormals vier Flottillen der Seestreitkräfte in zwei ~n zusammengefasst und durch jeweils einen einschiffbaren Einsatzstab ergänzt worden. Der Flottillenstab der ~ 1 ist in Kiel, der Flottillenstab der ~ 2 in Wilhelmshaven stationiert. Die Marinefliegergeschwader 3 und 5 sind im Zuge dieser einsatzorientierten Umgliederung als Marinefliegerkommando unmittelbar dem Flottenkommando, seit 2012 dem Marinekommando unterstellt worden.
Einsatzführungskommando der Bundeswehr (EinsFüKdoBw)
Mit der Aufstellung des Einsatzführungskommandos wurde Mitte 2001 das zentrale Element der grundlegenden Erneuerung der Bundeswehr durch den Bundesminister der Verteidigung geschaffen. Der Zuschnitt entspricht den veränderten Sicherheits- und militärpolitischen Erfordernissen.
Das ~ ist das zentrale Element der den sicherheits- und militärpolitischen Erfordernissen angepassten Einsatzführungsorganisation der Bundeswehr. Alle Einsätze und einsatzgleiche Verpflichtungen deutscher Streitkräfte – ob im nationalen oder multinationalen Rahmen – werden grundsätzlich vom ~ geplant und geführt. Es ist damit die operative Führungsebene der Bundeswehr und gibt als einzige Dienststelle nationale Weisungen an die Führer der Kontingente in den Einsatzgebieten. Diese erhalten ihre Aufträge in der Regel von multinationalen Hauptquartieren. Das EinsFüKdoBw stellt sicher, dass der Einsatz deutscher Kräfte mandatskonform erfolgt und die Rechtsnormen der Bundesrepublik Deutschland nicht verletzt. Der Befehlshaber des ~ untersteht dem Generalinspekteur der Bundeswehr.
Dem Befehlshaber ~ im Rang eines Generalleutnants bzw. Vizeadmirals werden die Einsatzkontingente der Bundeswehr truppendienstlich und für den Einsatz unterstellt. Er führt sie über Kontingentführer in den Einsatzgebieten.
Das ~ setzt in Einsatzangelegenheiten die ministeriellen Weisungen in Befehle und Weisungen an die betroffenen Bereiche der Bundeswehr um.
Einsatzführungskommando der Bundeswehr
Henning-von-Treskow-Kaserne
Postfach 600955, 14409 Potsdam
Tel.: (03327) 50-2040, Fax: (03327) 50-2049
E-Mail: einsfuekdobwpiz@bundeswehr.org
Einsatzführungssystem Luftstreitkräfte
(engl.: Air Command and Control System – ACCS)
Umfassendes und einheitliches System der Luftstreitkräfte in Europa für die operativ-taktische und taktische Ebene. ~ führt die vormals getrennten Führungseinrichtungen für Luftangriff und Luftverteidigung zusammen und besteht aus statischen Radaranlagen, Luftverteidigungsstellungen und Gefechtsführungszentralen sowie aus verlegbaren Elementen (Deployable ACCS Component). Zentrales Element des ~ ist das Combined Air Operations Center (CAOC). Diese Einrichtungen werden im Rahmen des NATO Security Investment Programs international finanziert. Das ~ wird durch nationale Vorhaben im Bereich der Informationstechnik vervollständigt und an nationale Besonderheiten angepasst. Mit dem ~ wird in der NATO ein einheitlicher Hard- und Software-Standard erreicht, der hinsichtlich der Führungsfunktion zu einer wesentlichen Verbesserung der Interoperabilität der Luftstreitkräfte beiträgt. Das ~ soll auch als Führungssystem für die Erweiterte Luftverteidigung benutzt werden.
Einsatzgebiet
Teil eines Territoriums, in dem die Bundeswehr mit ihren Streitkräften insgesamt, mit Teilen davon oder einzelnen Soldaten ihren vorgegebenen Auftrag erfüllt. Befehlshaber; Einsatzland
Einsatzgleiche Verpflichtungen
Im Sprachgebrauch des Bundesministeriums der Verteidigung wird zwischen »Einsätzen« und »einsatzgleichen Verpflichtungen« unterschieden. Unter »Einsätzen« werden zumeist von einer internationalen kollektiven Sicherheitsorganisation (VN, NATO, EU, OSZE) mandatierten und vom Deutschen Bundestag mit konstitutiver Zustimmung gebilligten bewaffneten Auslandseinsätze der Bundeswehr im Rahmen des internationalen Krisenmanagements bezeichnet. Mit dem Begriff »einsatzgleiche Verpflichtungen« sind die Bereitstellungen von Truppenteilen gemeint, die in ihrer Bedeutung mindestens gleichwertig mit den Auslandseinsätzen sind, aber nicht der Mandatierung im Einzelfall und der Billigung durch den Bundestag bedürfen, sondern sich aus Zusagen und Verpflichtungen gegenüber der NATO (z. B. deutsche Beiträge zur NATO Response Force, Enhanced Forward Presence, Taylored Forward Presence, Standing Naval Forces, Baltic Air Policing) oder zur EU (z. B. EU Battle Groups) ergeben. Grundsatzartikel »Bündnispolitik Deutschlands«
Einsatzgruppe
Auftragsgerechte Zusammenstellung verschiedener Seekriegsmittel zu einem militärischen Verband.
Einsatzgruppenversorger (EGV)
Bezeichnung für ein modernes Versorgungsschiff der Deutschen Marine, dessen Ausrüstung, Fähigkeiten und Besatzung auf die logistische, sanitätsdienstliche und operative Unterstützung einer gemischten Einsatzgruppe – wie etwa einer Standing NATO Maritime Group – in Fahrt ausgerichtet sind. Hauptaufgabe eines ~ ist die Versorgung der Einheiten auf See mit den erforderlichen Nachschubgütern (Kraftstoff, Öl, Frischwasser, Proviant, Munition, Verbrauchsgüter). Zusätzlich verfügt ein ~ an Oberdeck über Stellplätze für zwölf Standard-20-ft-Container und über zwei Hubschrauber, die speziell für den Rettungseinsatz vorgesehen sind, aber auch zur Evakuierung oder für Materialtransporte eingesetzt werden. Für die sanitätsdienstliche Versorgung eines schwimmenden Einsatzverbandes verfügt ein ~ über ein Marineeinsatzrettungszentrum (MERZ).
Einsatzkontingent
Für einen bestimmten militärischen Einsatz auftragsorientiert ausgewählte und bereitgestellte Kräfte und Mittel. Einsatzverband
Einsatzland
Territorium eines Staates, in dem ein Einsatz von Streitkräften eines oder mehrerer Entsendestaaten stattfindet.
Einsatzlazarett
In der Bundesrepublik Deutschland (DEU) medizinische Einrichtung für die stationäre und ambulante fachärztliche Versorgung Verwundeter, Verletzter und Erkrankter im Verteidigungs- und Einsatzfall im Einsatzgebiet. ~ sind grundsätzlich ortsfeste Einrichtungen für den Einsatz.
Einsatzplan
Ergebnis der Umsetzung eines nationalen Mandats in eine militärstrategische Planung, bei der die Art der verfügbaren Kräfte, der Zeitpunkt und der Ort ihrer Verfügbarkeit sowie Grundzüge des Einsatzes festgelegt werden.
Einsatzplanung
Prozess zur Planung eines Einsatzes der Bundeswehr auf militärstrategischer Ebene in Abstimmung mit weiteren Ressorts.
Einsatzraum
Teil eines Einsatzgebietes, der militärischen Kräften für die Erfüllung eines Auftrages zugewiesen ist.

Einsatzrecht
Rechtsgrundlagen für Streitkräfte in einem Einsatz. Sie beruhen auf den jeweiligen nationalen verfassungsrechtlichen Grundlagen zum Einsatz von Streitkräften und den nationalen Rechtsvorschriften. Sie sind die Grundlage militärischer Führung. Die Einsatzrichtlinien müssen grundlegenden Dokumenten entsprechen, u.a:
•der Charta der Vereinten Nationen,
•den Genfer Abkommen,
•den Zusatzprotokollen I und II,
•dem humanitären Völkerrecht,
•dem Internationalen Luft- und Seerecht sowie
•bei einem Einsatz außerhalb des eigenen Territoriums der Rechtsordnung des Einsatzlandes.
Einsatzrichtlinien
(engl.: Rules of Engagement – RoE)
Rules of Engagement
Einsatzunterstützung
Aufgabenbereiche, die der Führung von Streitkräften die personelle, sanitätsdienstliche, logistische und verwaltungsseitige Unterstützung für den Einsatz ihrer Kräfte in einem Einsatzgebiet und/oder Einsatzland sicherstellen.
Einsatzverband
Bereits bestehende oder zur Durchführung eines Einsatzes von Streitkräften gebildete Organisationseinheit in Streitkräften, die die für die Auftragserfüllung notwendigen Kräfte und Mittel vereint.
Einsatzwirksamkeit
Erfordernis, Ziele auch unter widrigen Bedingungen präzise erfassen und bekämpfen zu können. Dabei sollen eigene Verluste und zivile Opfer vermieden werden.
Einschleusung
Organisiertes, zumeist gewerbsmäßig betriebenes Verbringen von Ausländern in das Inland (z. B. nach Deutschland) unter Umgehung der gesetzlichen Einreiseschranken. Dies ist z. B. der Fall, wenn die betroffene Person nicht im Besitz der erforderlichen amtlichen Grenzübertrittspapiere (Personalausweis, Reisepass, Visum) ist.
Einschließung
Eine militärische Lage, in der eine Truppe rundum von feindlichen Truppen eingeschlossen ist.
Einwanderung
Zuwanderung von Menschen aus anderen Staaten in ein Staatsgebiet, in der Regel zum Zweck der ständigen Niederlassung oder Einbürgerung. Wanderungsbewegungen von Völkern oder Volksgruppen, Formen der Zwangswanderung oder Einreisen ohne Niederlassungsabsicht gelten nicht als ~. Armutswanderung; Asylant; Flucht; Migration
Einzelplan 14
In der Bundesrepublik Deutschland dem Bundesminister der Verteidigung zugeordneter Teil des Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr. Der ~ legt u. a. die zahlenmäßige Stärke und die Grundzüge der Organisation der Bundeswehr gemäß Grundgesetz (GG) Art. 87a Satz 1 fest.
Die Ausgaben für die Verteidigung in der Bundesrepublik Deutschland entsprechen etwa zehn Prozent des Gesamthaushalts. Davon entfallen rund 50 Prozent auf Personalausgaben.
Der ~ besteht aus Kapiteln. Jedes Kapitel wiederum ist nach einem für den gesamten Bundeshaushalt einheitlichen Gruppierungsplan in einzelne Titel aufgegliedert. Die Ausgabenseite des Haushaltes teilt sich in drei Bereiche:
•Betriebsausgaben,
dazu zählen die Personalausgaben, Ausgaben für Materialerhaltung sowie sonstige Betriebsausgaben,
•Betreiberverträge zur Weiterentwicklung der Bundeswehr,
hier sind die bisher realisierten Kooperationen mit der Industrie zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit zusammengefasst,
•Verteidigungsinvestive Ausgaben,
wie Forschung, Entwicklung und Erprobung, militärische Beschaffungen, militärische Anlagen und sonstige Investitionen.
Eiserner Vorhang
Durch Winston Churchill in Fulton (USA) am 5. März 1946 geprägte, symbolhafte Bezeichnung der hermetischen Abriegelung des von der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg beherrschten Machtbereiches, besonders gegenüber Europa. Kalter Krieg, Grundsatzartikel »Ost-West-Konflikt«
Elektromagnetischer Puls (EMP)
Wirkung vor allem von Nuklearexplosionen in großer Höhe. Die daraus entstehenden elektromagnetischen Felder können ungeschützten (ungehärteten) elektrischen und elektronischen Geräten auf große Entfernung Schäden zufügen. Dies gilt besonders für Geräte mit mikroelektronischen Bauteilen.
Elektronischer Kampf
(engl.: Electronic Warfare)
In der Bundeswehr benutzter Begriff für die elektronische Kriegführung. Bedeutet die Auseinandersetzung mit einem Gegner um die Nutzung der elektronischen Wellen bei deren Anwendung für Führung, Aufklärung und Waffeneinsatz. ~ umfasst nicht nur die Elektronischen Unterstützungsmaßnahmen (EloUM), Elektronische Schutzmaßnahmen (EloSM) und Elektronische Gegenmaßnahmen (EloGM), sondern beinhaltet auch alle Maßnahmen der Fernmelde- und Elektronischen Aufklärung (Fm/EloAufkl).
Der ~ wird gekennzeichnet durch vorwiegend unsichtbare Aktionen und Reaktionen, durch schnelle Angriffe und Abwehrmaßnahmen von Aufklärung und Wirkung.
Der ~ ist heute unverzichtbarer Kräfteverstärker der Gefechtsführung mit synergetischer Wirkung. Er ist von der ursprünglichen Rolle einer Unterstützungsmaßnahme für Führung und Waffenwirkung selbst zu einer kampfentscheidenden Waffe geworden. Damit ist ~ integraler Bestandteil moderner Operationsführung mit dem Ziel, eigene Führungs-, Ortungs- und Leitmittel zu schützen, um somit die eigene Führungs- und Wirkungsfähigkeit zu erhalten, möglichst sogar zu verstärken und gleichzeitig die des Gegners zu mindern.
Das explosionsartige Wachstum der Fernmeldeelektronik und die Anwendung modernster Mikroelektronik in Waffensystemen, die Fähigkeit, u. a. mit Satelliten Bewegungen auf dem Gefechtsfeld direkt und verzugslos in Führungsgefechtsstände zu übertragen sowie die Notwendigkeit, Luft- und Landkrieg zu koordinieren, haben aus dem einstigen »Krieg der Zauberer« (Churchill) den ~ zur vierten Dimension der Kampfführung gemacht. ~ ist damit ständige Aufgabe nicht nur im Einsatz, sondern bereits im Frieden.