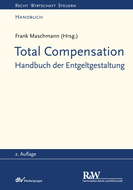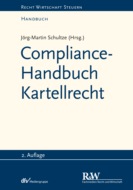Kitabı oku: «Kartellrechtliche Schadensersatzklagen», sayfa 4
Kapitel B Gründe für die Geltendmachung kartellrechtlicher Schadensersatzansprüche
Literatur: Altmeppen, Organhaftung wegen Verjährenlassens von Ansprüchen der Kapitalgesellschaft, ZIP 2019, 1253; Bayer/Scholz, Organhaftung wegen Nichtdurchsetzung von Ansprüchen der Gesellschaft, NZG 2019, 201; Beth/Pinter, Preisschirmeffekte: Wettbewerbsökonomische Implikationen für kartellrechtliche Bußgeld- und Schadensersatzverfahren, WuW 2013, 228; Coppik/Haucap, Die Behandlung von Preisschirmeffekten bei der Bestimmung von Kartellschäden und Mehrerlösen, WuW 2016, 50; Fritzsche, Die Schadensvermutung – Auslegungsfragen zum Kartellzivilrecht nach der 9. GWB-Novelle, NZKart 2017, 581; Hartmann-Rüppel/Schrader, Es regnet Preiserhöhungen – Wie Preisschirme auch Unbeteiligte schädigen können, ZWeR 2014, 300; Klumpe/Thiede, Ergänzende Überlegungen zur Lukas Rengier, Kartellschadensersatz in Deutschland, NZKart 2019, 136; Makatsch, Kartellschadensersatz – Vergleichen oder Prozessieren?, CCZ 2015, 127; Meeßen, Der Anspruch auf Schadensersatz bei Verstößen gegen das EU-Kartellrecht – Konturen eines Europäischen Kartelldeliktsrechts, 2011; Morell, Kartellschadensersatz nach „ORWI“, WuW 2013, 959; Murphy, Stahlkonzern entschädigt Bahn, in: Handelsblatt (Nr. 224) vom 20.12.2013, S. 15; Rengier, Kartellschadensersatz in Deutschland – die ersten 15 Jahre in Zahlen und Lehren für die Zukunft, WuW 2018, 613; Stancke, Zu den Pflichten und Abwägungskriterien hinsichtlich der Durchsetzung kartellrechtlicher Schadensersatzansprüche, WuW 2015, 822; Stein/Friton/Huttenlauch, Kartellrechtsverstöße als Ausschlussgründe im Vergabeverfahren, WuW 2012, 38; Thomas, Der zivilprozessuale Nachweis eines Kartellverstoßes nach vorausgegangener Verpflichtungszusagenentscheidung, ZWeR 2018, 141; Weber/Kiefner/Jobst, Künstliche Intelligenz und Unternehmensführung, NZG 2018, 1131.
Übersicht
I. Potenziell erhebliche Schädigung durch Kartelle
1. Direkte Betroffenheit
2. Indirekte Betroffenheit
3. Preisschirmeffekte
4. Zwischenergebnis
II. Rechtliche Pflichten der Geschäftsleitung geschädigter Unternehmen
1. Sorgfaltspflichten der Unternehmensleitung
2. Business Judgment Rule
3. Strengerer Maßstab bei staatsnahen Unternehmen
4. Informierte Abwägungsentscheidung maßgeblich
a) Angemessene Informationsbasis
b) Abwägung im Einzelfall
1
Angesichts der Vielzahl von Kartellen, die weltweit von Kartellbehörden aufgedeckt werden, und vor dem Hintergrund der zunehmenden kartellrechtlichen Schadensersatzklagen, stellt sich für Unternehmen immer häufiger die Frage, ob sie selbst geschädigt wurden und ob gegebenenfalls zivilrechtlich gegen Kartellanten vorgegangen werden soll. Oft handelt es sich bei der Klärung dieser Frage um ein komplexes Unterfangen. Zunächst einmal ist es häufig schwierig, das „Ob“ und die etwaige Höhe einer Schädigung zu ermitteln. Außerdem mag die Gefahr bestehen, dass durch eine Schadensersatzklage eine wichtige Lieferantenbeziehung belastet oder das Unternehmenswohl sonst wie beeinträchtigt wird.1
2
Schadensersatzbezogene Erwägungen müssen auch die Kartellanten als mögliche Anspruchsgegner vornehmen. Diese müssen insbesondere das potenzielle Schadensersatzrisiko einschätzen, um zu entscheiden, ob z.B. gegenüber betroffenen Geschäftspartnern ein konfrontatives oder kooperatives Vorgehen angezeigt ist.2
3
Klassischerweise kommen vor allem bei kollusivem Zusammenwirken mehrerer Unternehmen, z.B. im Rahmen von Preiskartellen, Schadensersatzansprüche infolge eines kartellbedingt zu viel gezahlten Kaufpreises („Overcharge“) in Betracht.3 Hierbei profitieren geschädigte Unternehmen nicht zuletzt von einer widerleglichen Vermutung, dass ein Kartell einen Schaden verursacht hat,4 von der gesamtschuldnerischen Haftung der Kartellanten für den entstandenen Schaden5 sowie von einer eher klägerfreundlichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes.6 Verschiedene einseitige Verhaltensweisen marktbeherrschender oder – im deutschen Recht bereits ausreichend – marktmächtiger Unternehmen können ebenfalls zu Schäden bei betroffenen Marktteilnehmern führen. So kann ein Ausbeutungsmissbrauch (z.B. überhöhte Lizenzgebühren für die Nutzung eines sog. „standardessenziellen Patents“7) Ansprüche der Marktgegenseite nach sich ziehen, während beim Behinderungsmissbrauch (z.B. Kopplungsstrategien beim Vertrieb oder Verweigerung des Zugangs zu erforderlichen Netzinfrastrukturen8) Schadensersatzansprüche der Mitbewerber in Betracht kommen.9
4
Insgesamt sind verschiedene Varianten möglich, in denen ein kartellrechtswidriges Verhalten zu erheblichen Schädigungen führen kann und daher eine Geltendmachung von Ersatzansprüchen – gerichtlich oder außergerichtlich – für betroffene Unternehmen erfolgversprechend erscheint (hierzu unter Rn. 5ff.). Aber nicht nur monetäre Aspekte stellen einen Grund für eine mögliche Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen dar. Sowohl die Geschäftsleitungen von Kartellanten als auch die Geschäftsleitungen von potenziell geschädigten Unternehmen müssen in ihrem Abwägungsprozess ihre eigenen (gesellschafts-)rechtlichen Pflichten berücksichtigen. Hierbei können geschädigte Unternehmen aufgrund verschiedener Faktoren sogar verpflichtet sein, Kartellschadensersatzansprüche geltend zu machen (hierzu unter Rn. 16ff.). Potenzielle Kartellanten müssen dies im Rahmen ihres Abwägungsprozesses, ob ein konfrontatives oder kooperatives Vorgehen erfolgversprechender erscheint, berücksichtigen, um die aus einem Kartellverstoß resultierenden Auswirkungen (neben den potenziellen Bußgeldern der Wettbewerbsbehörden) möglichst gering zu halten.10
1 Stancke, WuW 2015, 822. 2 Die Kartellanten müssen das potenzielle Schadensersatzrisiko zudem im Hinblick auf ein behördliches Kartellverfahren abschätzen, ggf. bereits vor Ermittlungshandlungen der Wettbewerbsbehörden. Denn hiervon ist u.a. die mögliche Zusammenarbeit mit den Wettbewerbsbehörden als sog. Kronzeuge abhängig sowie mögliche weitere Vorteile im Hinblick auf das zu erwartende Bußgeld (vgl. Art. 18 Abs. 3 der Kartellschadensersatzrichtlinie) und die Stellung in möglichen Schadensersatzprozessen (vgl. §§ 33e und 33f GWB). Bisweilen ist es auch erforderlich, frühzeitig ausreichende Rückstellungen zu bilden, vgl. hierzu auch Makatsch, CCZ 2015, 127, 129; Polley, in: Fuchs/Weitbrecht, KartellR-HdB, § 3 Rn. 85ff. 3 Vgl. auch Stancke, WuW 2015, 822f. 4 Vgl. gem. § 186 Abs. 3 S. 1 GWB für nach dem 26.12.2016 entstandene Ansprüche: § 33a Abs. 2 GWB; vgl. auch Art. 17 Abs. 2 der Kartellschadensersatzrichtlinie. Zu davor entstandenen Ansprüchen auch: BGH, 11.12.2018, KZR 26/17, ECLI: DE:BGH:2018:111218UKZR26.17.0, Rn. 55f. – Schienenkartell. 5 § 33d GWB i.V.m. §§ 830, 840 Abs. 1 sowie §§ 421 bis 425 BGB; vgl. auch Art. 11 der Kartellschadensersatzrichtlinie; BGH, 19.5.2020, KZR 70/17, ECLI:DE:BGH:2020: 190520UKZR70.17.0 – Schienenkartell III. 6 In jüngerer Zeit: EuGH, 12.12.2019, Rs. C-435/18, ECLI:EU:C:2019:1069 – Otis; EuGH, 14.3.2019, Rs. C-724/17, ECLI:EU:C:2019:204 – Skanska. 7 EuGH, 16.7.2015, Rs. C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477 – Huawei/ZTE; vgl. auch BGH, 4.1.2017, KZR 47/14, ECLI:DE:BGH:2017:240117UKZR47.14.0. 8 OLG Düsseldorf, 29.1.2014, VI-U (Kart) 7/13, ECLI:DE:OLGD:2014:0129.VI.U. KART7.13.00; OLG Düsseldorf, 30.9.2009, VI-U (Kart) 17/08, ECLI:DE:OLGD: 2009:0930.VI.U.KART17.08.00. 9 Hierzu auch Meeßen, Der Anspruch auf Schadensersatz bei Verstößen gegen das EU-Kartellrecht – Konturen eines Europäischen Kartelldeliktsrechts, S. 323ff. m.w.N. 10 Vgl. Fleischer, in: Spindler/Stilz, AktG, § 93 Rn. 91a m.w.N.; Fleischer, in: MüKo-GmbHG, § 43 Rn. 102a m.w.N.
I. Potenziell erhebliche Schädigung durch Kartelle
5
Unternehmen können durch Kartellrechtsverstöße auf vielfältige Art und Weise geschädigt werden. Hierbei geht es nicht nur um klassische Preiskartelle, sondern auch um anderes kollusives Zusammenwirken von Wettbewerbern, wie Markt- und Kundenaufteilungen, sowie Quoten- und Submissionsabsprachen.11 Daneben sind auch kartellrechtswidrige Absprachen entlang der Veräußerungskette12 oder einseitiges kartellrechtswidriges Verhalten13 relevant. Eine kartellrechtswidrige Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen muss auch nicht stets eine vollwertige Absprache zwischen Wettbewerbern darstellen, um wettbewerbsbeschränkend zu wirken.14 Es reicht, wenn Unternehmen bewusst eine praktische Zusammenarbeit an die Stelle des mit Risiken verbundenen Wettbewerbs treten lassen.15 Hierfür kann16 bereits der Austausch wettbewerblich relevanter Informationen, die Aufschluss über Marktstrategien der Wettbewerber geben und so die Ungewissheit über das künftige Marktgeschehen verringern, genügen.17 Aber auch bei einseitigem kartellrechtswidrigem Verhalten, z.B. in Form des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung, kann die Forderung einer Schadenskompensation erfolgversprechend sein. Neben Schäden durch die kartellrechtswidrige Handlung sind in diesem Fall auch Schadensersatzansprüche aufgrund entstandener Rechtsverfolgungskosten (z.B. Abwehrmaßnahmen durch Unterlassungsklagen, Beiladung zu einem kartellbehördlichen Verfahren) wahrscheinlich.18
6
Während die Forderung einer Kompensation etwaiger Rechtsverfolgungskosten oder bei kartellrechtswidrigen Verhaltensweisen direkter Vertragspartner für die Unternehmensleitung betroffener Unternehmen womöglich auf der Hand liegt, sind andere Fälle, wie die mittelbare Schädigung am Ende einer Veräußerungskette, mitunter nicht so einfach zu beurteilen.19
1. Direkte Betroffenheit
7
Eine Schädigung kann insbesondere aus einem kartellrechtswidrigen Verhalten direkter Vertragspartner folgen. Hier werden Preise oder Vertragsverhandlungen direkt beeinflusst und ein kausaler Schaden liegt meist auf der Hand,20 so dass die geschädigten Unternehmen regelmäßig gute Erfolgsaussichten haben, eine Schadenskompensation vom Vertragspartner zu erhalten. Mögliche Kartellanten sollten in diesem Fall verstärkt mit Kompensationsforderungen ihrer Geschäftspartner rechnen. Zwar ist in jedem Einzelfall zu prüfen, welche Schäden bei den betroffenen Unternehmen vorliegen können. Grundsätzlich können hierbei aber die folgenden zwei Arten von Schäden in Betracht kommen:
– Kartellaufpreisschaden, d.h. Abnahme von Gütern zu überhöhten Kartellpreisen; der Schaden liegt grundsätzlich in der Differenz zwischen dem tatsächlich gezahlten überhöhten Preis und dem hypothetischen Preis bei funktionierendem Wettbewerb („Wettbewerbspreis“), und
– entgangener Gewinn, d.h. der Schaden aus dem Absatz-/Nachfragerückgang durch vom Abnehmer vorgenommene Preiserhöhungen seiner Produkte, die aus den gestiegenen Kosten infolge der überhöhten Kartellpreise resultieren.21
8
Aufgrund der unmittelbaren Geschäftsbeziehungen bietet sich unter Umständen – entweder im Rahmen der üblichen Preisverhandlungen oder als gesonderte Vergleichsverhandlung – eine außergerichtliche Einigung an, so dass auf eine öffentlichkeitswirksame Klage als Mittel zur Geltendmachung von Schäden verzichtet werden kann.22 Nicht zuletzt dient dies auch der Aufrechterhaltung guter Geschäftsbeziehungen, da eine einvernehmliche Lösungssuche zwischen geschädigten Unternehmen und Kartellanten meist weniger kontrovers ist als eine gerichtliche Auseinandersetzung. Neben einer direkten Kompensation von Schäden kann es bei derartigen Verhandlungen auch andere Gestaltungsmöglichkeiten geben, wie z.B. Rabatte oder Vorzugspreise bei neuen Aufträgen.
2. Indirekte Betroffenheit
9
Anders ist dies mitunter bei indirekten Kartellschäden zu beurteilen, bei denen erst Unternehmen einer weiteren Marktstufe (entlang der Produktions- oder Vertriebskette) betroffen sind.23 Unternehmen, die lediglich indirekt betroffen sind, werden im Vergleich zu direkt Betroffenen regelmäßig erhöhte Prozessrisiken eingehen müssen und geringere potenzielle Schäden durchsetzen können. So ist es aus ökonomischen Gesichtspunkten durchaus vorstellbar, dass z.B. Preiserhöhungen des Lieferanten an die Abnehmer des ursprünglich direkt geschädigten Unternehmens weitergegeben werden. Hinsichtlich des Kartellaufpreisschadens muss der mittelbar Betroffene aber grundsätzlich für die gesamte Veräußerungskette bis zu seinem Erwerb des jeweiligen Produktes nach Maßgabe des § 287 ZPO einen hinreichend kausal auf dem Kartell beruhenden Schaden darlegen und dementsprechend nachweisen,24 dass
– ein Kartellverstoß einen Preisaufschlag für den unmittelbaren Abnehmer des Rechtsverletzers zur Folge hatte; und
– der unmittelbare Abnehmer seine Weiterverkaufspreise wegen der erhöhten Kartellpreise erhöht hat (und gegebenenfalls ihm folgend auch alle weiteren Abnehmer in der Veräußerungskette) und der mittelbare Abnehmer deshalb für die von ihm abgenommene Menge überhöhte Preise zahlte.25
10
Zum Nachweis eines Kartellverstoßes kann der mittelbare Abnehmer gegebenenfalls bestandskräftige Entscheidungen von Wettbewerbsbehörden nutzbar machen.26 Im Hinblick auf die tatsächliche Weitergabe des Preisaufschlags profitiert der mittelbare Abnehmer – je nach Entstehungszeitpunkt des Anspruchs – von einer gesetzlichen Vermutung, sofern er nachweisen kann, dass er kartellbetroffene Produkte oder Dienstleistungen erworben hat.27
11
Für den Nachweis der sog. Weiterwälzung des Schadens benötigt der mittelbar Betroffene dennoch nicht nur Informationen über den Markt, auf dem er selbst tätig ist, sondern auch von (allen) vorgelagerten Märkten. Hierfür kann der mittelbare Abnehmer zwar einen Auskunftsanspruch bzw. einen Anspruch auf Herausgabe von Beweismitteln nutzbar machen und den z.B. unmittelbaren Abnehmer zur Preisgabe der Informationen verpflichten.28 Indes dürfte die Wahrscheinlichkeit des Nachweises eines kausalen Schadens, trotz der genannten gesetzlichen Erleichterungen, mit jeder Absatzstufe geringer werden, da mit jeder Absatzstufe die Anzahl der Faktoren, welche die Preisbildung beeinflussen, anwächst.29 Zudem bleibt es den Kartellanten unbenommen, ihrerseits die Weiterwälzung des Preisaufschlags vom mittelbaren Abnehmer auf nachfolgende Abnehmer darzulegen, um hiermit neben der Höhe möglicher Kompensationszahlungen auch den Schadensersatzanspruch im Ganzen in Zweifel zu ziehen.30
3. Preisschirmeffekte
12
Dem Grunde nach kommen auch sog. „Preisschirmeffekte“31 in Betracht, obgleich die Erfolgsaussichten für die Durchsetzung von hierauf beruhenden Schadensersatzansprüchen bzw. die diesbezüglichen Schadensersatzrisiken für Kartellanten eher geringer sein dürften. Mit dem Begriff des Preisschirmeffekts beschreibt die ökonomische Lehre das Phänomen, dass preisliche Spielräume und Absatzchancen von Anbietern auf einem Markt umso höher ausfallen, je höher die Preise der übrigen Anbieter auf dem relevanten Markt sind. Insoweit erweitern die kartellbedingten Folgen auf dem relevanten Markt bzw. der seitens der Kartellanten „aufgespannte Preisschirm“ die (Preissetzungs-) Spielräume auch für diejenigen Unternehmen, die nicht am kartellrechtswidrigen Verhalten beteiligt waren (sog. „Kartellaußenseiter“).32
13
Nutzen Kartellaußenseiter diese Spielräume in ihren Geschäftsbeziehungen aus, z.B. bei periodischen Verhandlungen, zahlen auch ihre Abnehmer kartellbedingt erhöhte Preise. Abnehmern von Kartellaußenseitern kann daher ebenfalls ein im kartellrechtswidrigen Verhalten begründeter (und damit kausaler) Schaden entstehen – auch wenn sie sich nicht in der Veräußerungskette der Kartellanten bzw. auf einer nachgelagerten Marktstufe befinden.33
14
Für solche Preisschirmeffekte haften nicht die Geschäftspartner der betroffenen Unternehmen, die nicht am Kartell beteiligt waren, sondern die Kartellbeteiligten, weil sie den Preisschirm erzeugt haben. Schadensersatzansprüche bestehen allerdings nur dann, wenn erwiesen ist, dass ein Kartell im konkreten Fall, insbesondere aufgrund der bestehenden Marktbesonderheiten, Preisschirmeffekte zur Folge hatte und dass dies den Kartellanten nicht verborgen bleiben konnte.34
4. Zwischenergebnis
15
All diesen Fallgestaltungen ist gemein, dass erhebliche Schädigungen bei betroffenen Unternehmen auftreten können. Eine Vielzahl von Studien kommt zu einer durchschnittlichen kartellbedingten Preiserhöhung von etwa 10–20 %.35 Inwieweit dieser potenzielle Schaden von betroffenen Unternehmen tatsächlich durchgesetzt wurde, lässt sich empirisch nur schwer einschätzen. Zum einen werden viele Gerichtsverfahren nur dazu genutzt, um die Verjährung von Ansprüchen zu verhindern oder die Verhandlungsposition in bereits laufenden Vergleichsverhandlungen zu stärken. Zum anderen bedingen außergerichtliche Einigungen zwischen Kartellanten und betroffenen Unternehmen meist ein Stillschweigen über Umfang und Bedingungen des Vergleichs. Die wenigen verfügbaren öffentlichen Informationen zeigen aber dennoch, dass signifikante Schadensersatzzahlungen möglich sind.36 Maßgeblich abhängig ist die erfolgreiche Durchsetzung einer Schadenskompensation letztlich von der vorhandenen Datenlage beim geschädigten Unternehmen und inwieweit damit Preisveränderungen infolge des Kartells substantiiert werden können. Insbesondere im Falle größerer Unternehmen oder komplexerer Fälle ist es daher empfehlenswert, ökonomische Gutachten in Auftrag zu geben, um sowohl für gerichtliche Auseinandersetzungen als auch außergerichtliche Vergleichsverhandlungen eine solide Argumentationsgrundlage zu haben.37
11 Siehe Art. 101 AEUV; §§ 1, 2 GWB. 12 Vgl. OLG Düsseldorf, 13.11.2013, VI-U (Kart) 11/13, ECLI:DE:OLGD:2013:1113. VI.U.KART11.13.00. 13 Siehe Art. 102 AEUV; §§ 19ff. GWB. 14 Zum Ganzen auch Stancke, WuW 2015, 822, 823. 15 St. Rspr.; grundlegend EuGH, 14.7.1972, Rs. C-48/69, ECLI:EU:C:1972:70, Rn. 22 – Farbstoffe; in jüngerer Zeit: EuGH, 26.1.2017, Rs. C-609/13 P, ECLI:EU:C:2017:46, Rn. 70 – Badezimmerkartell; vgl. auch Hengst, in: Langen/Bunte, Kartellrecht, Bd. 2, Art. 101 AEUV Rn. 116 m.w.N.; Zimmer, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Bd. 2, § 1 GWB Rn. 35 m.w.N. 16 Vgl. zu den Anforderungen an das Vorliegen einer bloß „bezweckten“ Wettbewerbsbeschränkung: EuGH, Urt. v. 2.4.2020, C-228/18, ECLI:EU:C:2020:265, Rn. 65 – Budapest Bank. 17 EuGH, 28.5.1998, Rs. C-7/95 P, ECLI:EU:C:1998:256, Rn. 88 – John Deere; EuGH, 19.3.2015, Rs. C-286/13 P, ECLI:EU:C:2015:184, Rn. 19ff. – Dole Food. Vgl. auch Kapitel H Rn. 84ff. 18 Vgl. dazu auch Kapitel H. 19 Vgl. zur Einschätzung der Aktivlegitimation auch Kapital H Rn. 26ff. und der Schädigung Kapitel I Rn. 10ff. 20 Insoweit geht der BGH sowohl bei Preiskartellen als auch bei Quotenkartellen von einer tatsächlichen Vermutung für eine preissteigernde Wirkung eines kartellrechtswidrigen Verhaltens aus, obgleich aufgrund mangelnder Typizität die Grundsätze des Anscheinsbeweises nicht anwendbar seien: Vgl. BGH, Urt. v. 11.12.2018, KZR 26/17, ECLI:DE:BGH:2018:111218UKZR26.17.0, Rn. 55f. = NZKart 2019, 101ff. – Schienenkartell. Zudem sieht § 33a Abs. 2 GWB eine widerlegliche Vermutung für das Bestehen eines Schadens und dessen Verursachung durch einen Kartellrechtsverstoß vor; vgl. hierzu auch Fritzsche, NZKart 2017, 581ff. Mit der 10. GWB-Novelle wurde in §§ 33a Abs. 2, 33c Abs. 3 GWB n.F. sogar eine widerlegliche Vermutung bezüglich der Betroffenheit eingeführt. 21 Die Geltendmachung eines Schadens infolge des Nachfragerückgangs beim Weiterverkauf der kartellbedingt verteuerten Produkte sollte vom Anspruchsteller regelmäßig sorgfältig abgewogen werden, da der entgangene Gewinn als Kartellschaden regelmäßig die Argumentation zum Kartellaufpreisschaden konterkariert (vgl. Morell, WuW 2013, 959, 963). 22 Vergleichsverhandlungen sollten vor allem von Kartellanten frühzeitig erwogen werden, da eine Schadensersatzzahlung als mildernder Umstand bei der Bußgeldberechnung berücksichtigt werden kann (vgl. Art. 18 Abs. 3 der Kartellschadensersatzrichtlinie) und Kartellanten durch frühen Schadensausgleich auch der gesamtschuldnerischen Haftung entgehen können (vgl. § 33f GWB); vgl. ausführlich Kapitel N. 23 In der deutschen Rechtspraxis ist der Schadensersatzanspruch indirekt Betroffener spätestens seit BGH, 28.6.2011, KZR 75/10, BGHZ 190, 145, 172 anerkannt (sog. ORWI-Entscheidung); zuletzt weiter konkretisiert durch EuGH, 12.12.2019, Rs. C-435/18, ECLI:EU:C:2019:1069 – Otis; BGH, 28.1.2020, KZR 24/17, ECLI:DE:BGH: 2020:280120UKZR24.17.0, Rn. 24 – Schienenkartell II; BGH, 3.12.2019, KZR 23/17, ECLI:DE:BGH:2019:031219UKZR23.17.0, Rn. 32; BGH, 3.12.2019, KZR 25/17, ECLI:DE:BGH:2019:031219UKZR25.17.0, Rn. 41. 24 Die Darlegungslast des Geschädigten unterliegt geringeren Anforderungen als bei § 286 ZPO. Es genügt, wenn er Tatsachen vorträgt und unter Beweis stellt, die für eine Beurteilung nach § 287 ZPO ausreichende greifbare Anhaltspunkte bieten (BGH NJW-RR 2007, 569 Rn. 21). Welche Anforderungen sich daraus ergeben, hängt insbesondere auch von den Möglichkeiten ab, die dem Geschädigten zur Verfügung stehen, seinen Vortrag zu konkretisieren (BGH NJW 1998, 1633, 1634). Eine mögliche und nicht mit unverhältnismäßigem Aufwand verbundene Aufklärung darf nicht deshalb unterbleiben, weil eine Partei hierzu nicht ausreichend vorträgt (BGH NJW 1981, 1454); vgl. Bacher, in: BeckOK ZPO, Vorwerk/Wolf, 36. Ed., Stand: 1.3.2020, § 287 Rn. 14. 25 BGH, 28.6.2011, KZR 75/10, BGHZ 190, 145, 157ff. – ORWI; näher hierzu Kapitel I Rn. 302ff. 26 Insoweit besteht auch eine gesetzliche Bindungswirkung hinsichtlich der Feststellung eines Kartellverstoßes in bestandskräftigen Entscheidungen; vgl. § 33b GWB. Nicht umfasst hiervon sind z.B. Entscheidungen nach § 32b GWB, da diese keine Feststellung zu einem Kartellverstoß enthalten; vgl. auch Thomas, ZWeR 2018, 141, 145; Keßler, in: MüKo-Wettbewerbsrecht, § 32b GWB Rn. 33. 27 Vgl. für gem. § 186 Abs. 3 Satz 1 GWB nach dem 26.12.2016 entstandene Ansprüche die Vermutungswirkung des § 33c Abs. 2 GWB; vgl. auch Art. 14 Abs. 2 der Kartellschadensersatzrichtlinie. Die gesetzliche Vermutung kann vom Anspruchsgegner erschüttert werden, wenn er glaubhaft macht, dass der Preisaufschlag nicht oder nicht vollständig an den mittelbaren Abnehmer weitergegeben wurde; vgl. § 33c Abs. 3 GWB. 28 § 33g GWB. 29 Vgl. auch Bornkamm/Tolkmitt, in: Langen/Bunte, Kartellrecht, Bd. 1, § 33c GWB Rn. 30ff. 30 § 33c Abs. 1 GWB; vgl. auch BGH, 19.5.2020, KZR 8/18, ECLI:DE:BGH:2020: 190520UKZR8.18.0 – Schienenkartell IV. 31 Vgl. hierzu EuGH, 5.6.2014, Rs. C-557/12, ECLI:EU:C:2014:1317 – Kone; OLG Düsseldorf, 8.5.2019, VI-U (Kart) 11/18, ECLI:DE:OLGD:2019:0508.UKART.11.18.0A; BGH, 19.5.2020, KZR 8/18, ECLI:DE:BGH:2020:190520UKZR8.18.0 – Schienenkartell IV. Ausführlich Kapitel I Rn. 80ff., 286ff. 32 Coppik/Haucap, WuW 2016, 50, 51ff.; Beth/Pinter, WuW 2013, 228, 229. 33 Hartmann-Rüppel/Schrader, ZWeR 2014, 300, 308; Beth/Pinter, WuW 2013, 228, 232f.; vgl. auch RegE, BT-Drs. 18/10207, S. 69. 34 EuGH, 5.6.2014, Rs. C-557/12, ECLI:EU:C:2014:1317, Rn. 34 – Kone; OLG Düsseldorf, 8.5.2019, VI-U (Kart) 11/18, ECLI:DE:OLGD:2019:0508.UKART.11.18.0A; BGH, 19.5.2020, KZR 8/18, ECLI:DE:BGH:2020:190520UKZR8.18.0, Rn. 39ff. – Schienenkartell IV; Coppik/Haucap, WuW 2016, 50, 55ff. 35 Vgl. Praktischer Leitfaden, Rn. 139ff.; vgl. auch Rengier, WuW 2018, 613, 616f.; Klumpe/Thiede, NZKart 2019, 136, 137; Kapitel I Rn. 120ff. 36 Vgl. u.a. Einigung zwischen Thyssen-Krupp und Deutsche Bahn auf eine Zahlung in Höhe von ca. 150 Mio. EUR, Murphy, Handelsblatt (Nr. 224) v. 20.11.2013; Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen zahlen insgesamt ca. 6,7 Mio. EUR an Kommunen: Deutscher Städtetag, Pressemitteilung vom 13.5.2013, abrufbar unter http://www.staedtetag.de/dst/inter/presse/mitteilungen/065646/index.html (zuletzt aufgerufen am 10.6.2020). 37 Näher hierzu unten Kapitel I Rn. 257ff.