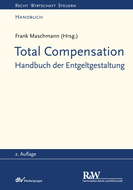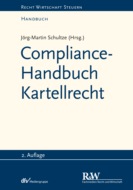Kitabı oku: «Kartellrechtliche Schadensersatzklagen», sayfa 5
II. Rechtliche Pflichten der Geschäftsleitung geschädigter Unternehmen
16
Trotz der Möglichkeit, eine signifikante Kompensationszahlung von Kartellanten zu erhalten, wird nicht jedes betroffene Unternehmen zwingend einen Schadensersatz geltend machen wollen. Insbesondere im Falle langjähriger vertrauensvoller Geschäftsbeziehungen können Hemmnisse bestehen. Der Entscheidungsprozess innerhalb der Geschäftsleitung geschädigter Unternehmen unterliegt hierbei Begrenzungen, die sich auch zu einer Pflicht hinsichtlich des „Ob“ einer Schadensersatzgeltendmachung verdichten können.38
17
Zunächst ergeben sich aus dem deutschen und europäischen Kartellrecht selbst keine Pflichten der Geschäftsleitung eines Unternehmens, Schadensersatzansprüche gegen Kartellanten durchzusetzen. Das sog. „Private Enforcement“ wird zwar im europäischen Kartellrecht immer mehr zum zweiten Standbein der Abschreckung neuer Kartellverstöße und auch in den USA sind Schadensersatzforderungen im Wege von „Class Actions“ ein maßgeblicher Faktor der Durchsetzung des Kartellrechts. Eine Rechtsverpflichtung der betroffenen Unternehmen und mithin der jeweiligen Unternehmensleitungen, einen Schadensausgleich tatsächlich zu fordern, ergibt sich hieraus allerdings nicht. Gesetzgeber und Wettbewerbsbehörden setzen lediglich gewisse Anreize. Entweder durch bloßen Hinweis auf die Möglichkeit der Schadensersatzdurchsetzung39 oder durch gesetzgeberische Maßnahmen.40 Eine rechtliche Pflicht für die Geschäftsleitung betroffener Unternehmen zur Geltendmachung kartellrechtlicher Schadensersatzansprüche kann sich aber aus anderen Gründen ergeben. Namentlich sind dies vor allem die allgemeinen Handlungspflichten der Unternehmensleitung, also z.B. die Sorgfaltspflichten eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters.41
1. Sorgfaltspflichten der Unternehmensleitung
18
Aus den allgemeinen Handlungspflichten wird sich für geschädigte Unternehmen regelmäßig kein unmittelbarer Zwang zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ergeben. Die Unternehmensleitung kann aber auch nicht ohne jegliche Prüfung auf Ansprüche der Gesellschaft verzichten oder diese verjähren lassen.42 Die Sorgfaltspflichten fordern daher gewisse Maßnahmen von der Geschäftsleitung, die vornehmlich an den Interessen der Gesellschaft auszurichten sind. Ein gewissenhaftes Vorgehen liegt aber auch im eigenen Interesse der Mitglieder der Unternehmensleitung, denn werden die Sorgfaltspflichten durch ein pflichtwidriges Tun oder Unterlassen verletzt, ist die Unternehmensleitung der Gesellschaft (und in besonderen Fällen auch Dritten) zum Ersatz des hierdurch entstandenen Schadens verpflichtet.43
19
Die genaue Ausgestaltung dieser Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Geltendmachung von kartellrechtlichen Schadensersatzansprüchen oder die Einschätzung eines Schadensersatzrisikos lässt sich vor allem aus der gesetzlichen Normierung der sog. „Business Judgment Rule“ in § 93 AktG herleiten. Die Business Judgment Rule gilt hierbei nicht nur bei Aktiengesellschaften, sondern kann für die Geschäftsleitung in allen Unternehmensformen als Maßstab dienen.44
2. Business Judgment Rule
20
Die Unternehmensleitung muss die Frage der Geltendmachung von kartellrechtlichen Schadensersatzansprüchen anhand dessen entscheiden, inwieweit dies dem Wohl des Unternehmens entspricht. Hierbei steht den Mitgliedern der Unternehmensleitung ein Ermessensspielraum im Rahmen eines informierten Abwägungsprozesses zu.45
21
§ 93 Abs. 1 Satz 2 AktG führt hierzu aus:
„Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn das Vorstandsmitglied bei einer unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Information zum Wohle der Gesellschaft zu handeln.“ (Hervorhebungen durch Verfasser)
22
Sowohl der Entscheidung, etwaige Ansprüche geltend zu machen, als auch der Entscheidung, von einer Anspruchsstellung abzusehen, muss die Geschäftsleitung geschädigter Unternehmen eine ausreichende Informationsbasis zugrunde legen; und die einzelnen Unternehmensinteressen sorgfältig abwägen.46
3. Strengerer Maßstab bei staatsnahen Unternehmen
23
Staatsnahe bzw. staatlich kontrollierte Unternehmen (aber auch staatliche Institutionen) müssen neben der Business Judgment Rule gegebenenfalls weitere Verpflichtungen beachten. Denn die haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bzw. die gesellschaftsrechtlichen Treuepflichten innerhalb öffentlich-rechtlicher Unternehmen führen mitunter zu engeren Grenzen bzw. zu strengeren Maßstäben bei der Abwägungsentscheidung, ob ein Schadensausgleich geltend gemacht wird.47 Hingegen gibt es im Zusammenhang mit kartellrechtswidrigen Verhaltensweisen von Geschäftspartnern selbst bei öffentlich-rechtlichen Unternehmen keine gesteigerte Legalitätspflicht, die unterschiedslos eine Geltendmachung von Schäden oder den Abbruch der Geschäftsbeziehungen erfordern würde. Einschränkungen ergeben sich allenfalls in Bezug auf Ausschreibungen und den Ausschluss von Kartellanten für derartige Vergabeverfahren.48
4. Informierte Abwägungsentscheidung maßgeblich
24
Jede Unternehmensleitung muss also eine informierte, vornehmlich am Unternehmenswohl orientierte Abwägungsentscheidung treffen, die im Falle staatsnaher bzw. staatlich kontrollierter Unternehmen durch engere gesetzliche Vorgaben eingeschränkt sein kann.
a) Angemessene Informationsbasis
25
Als Basis der unternehmerischen Ermessensentscheidung ist zunächst die Schaffung einer ausreichenden Tatsachengrundlage erforderlich.49 Diese dient dazu, der Unternehmensleitung eine informierte Entscheidung zu ermöglichen, die neben den verfügbaren Informationen (rechtliche und tatsächliche Rahmeninformationen)50 auch die Geschäftsbeziehungen, strategische Erwägungen und unternehmensindividuelle monetäre Aspekte berücksichtigt. Letzteres begrenzt in jedem Einzelfall auch die Detailtiefe der Informationsbeschaffung und -aufbereitung, da insoweit ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen für das jeweilige Unternehmen zu suchen ist.51 Die Informationsbasis für die Abwägungsentscheidung muss dementsprechend auch nicht zwingend umfassend ausgestaltet sein.52 Gerade vor dem Hintergrund einer effizienten Informationsbeschaffung, die sich an den Möglichkeiten des jeweiligen Unternehmens orientiert, sind die mit einer effektiven Rechtsverfolgung verbundenen substanziellen Kosten – sowohl interner Aufwand für die Informationsbeschaffung und -sicherung, entsprechende Aufwendungen für die Koordinierung, Managementressourcen, als auch Kosten für externe (ökonomische und rechtliche) Beratung – frühzeitig zu berücksichtigen. Im Wege einer antizipierten Ausübung der Business Judgment Rule kann so schon im ersten Schritt zum Wohle des jeweiligen Unternehmens der Aufwand z.B. auf diejenigen Jurisdiktionen konzentriert werden, in denen die Unternehmensleitung aufgrund der bestehenden Geschäftsbeziehungen eine besondere Exposition erkennt.
26
Im Hinblick auf die aktive Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen bietet es sich zudem für jedes Unternehmen an, einen unternehmensindividuellen Monitoring-Prozess zu implementieren.53 Hierdurch kann verhindert werden, dass Kartelle, die die gesellschaftsrechtliche Prüfungs- und Abwägungsverpflichtung auslösen können, grob fahrlässig nicht erkannt werden. Gerade für potenziell geschädigte Unternehmen ist die Identifizierung (möglicher) kartellrechtlich relevanter Verhaltensweisen unabdingbare Voraussetzung dafür, dass eine Informationssichtung und -sicherung vorgenommen werden kann, mit der die Tatsachengrundlage geschaffen wird, um der Unternehmensleitung die erforderliche Kosten-/Nutzenabwägung zu ermöglichen.
b) Abwägung im Einzelfall
27
Am Ende des Entscheidungsprozesses steht schließlich immer eine Abwägung der Unternehmensleitung, ob ein Schadensersatzanspruch geltend gemacht werden soll. Diese Abwägung muss grundsätzlich eigenständig für jeden Einzelfall vorgenommen werden. Die Unternehmensleitung hat hierbei ohne Sonderinteressen und sachfremde Einflüsse zu entscheiden, denn nur so handelt sie zum Wohle des Unternehmens.54 Die einzelfallspezifische Kosten-/Nutzenabwägung kann dabei in den folgenden Schritten erfolgen:
– Zunächst ist eine (kursorische) Prüfung der Möglichkeit eines Schadensersatzanspruchs durchzuführen;
– erst wenn diese Vorabprüfung auf einen durchsetzbaren Schadensersatzanspruch hinweist, bedarf es einer substantiierten rechtlich-ökonomischen (Einzelfall-)Prüfung der Schadensersatzansprüche, wobei insbesondere die Schadenssumme und etwaige Verjährungsthemen, aber auch Fragen des anwendbaren Rechts sowie etwaige Gerichtsstände zu berücksichtigen sind.55
28
Als wesentlicher Maßstab der Abwägung gilt schließlich, dass geschädigte Unternehmen von der Verfolgung kartellrechtlicher Schadensersatzansprüche lediglich dann absehen können bzw. werden, wenn eine Abwägung auf hinreichend gesicherter Informationsbasis ergibt, dass die Kosten und/oder Belastungen für das betroffene Unternehmen außer Verhältnis zu dem erreichbaren Nutzen stehen, insbesondere weil der Anspruch wirtschaftlich wertlos ist oder Unternehmensressourcen durch ein komplexes Verfahren unverhältnismäßig lang gebunden wären.56 Wesentliche Abwägungsgesichtspunkte sind hierbei:57
– Art der Geschäftsbeziehung zu mutmaßlichem Kartellanten (direkte Vertragsbeziehung, indirekte Geschäftsbeziehung oder lediglich mögliche Preisschirmeffekte) und daraus folgend auch die Erfolgsaussichten einer (gerichtlichen) Durchsetzung;
– Verhältnis eines möglichen Schadens zum von der Geschäftsbeziehung betroffenen Gesamtvolumen;
– Bedeutung der Geschäftsbeziehung für die Tätigkeit des Unternehmens;
– positive Kosten-/Nutzenabwägung im Hinblick z.B. auf die Beschaffung der für den Nachweis des Schadens erforderlichen Informationen und die voraussichtlichen Rechtsverfolgungskosten;
– Verjährungsgesichtspunkte.
29
Fällt die Kosten-/Nutzenabwägung hinsichtlich der potenziellen Schadensersatzforderung positiv aus, ohne dass ein gewichtiger Aspekt des Unternehmenswohls gegen eine Durchsetzung spricht, besteht für die Geschäftsleitung eines geschädigten Unternehmens grundsätzlich die Pflicht, den Ersatzanspruch geltend zu machen.58 In diesem Fall hat die Unternehmensleitung dafür Sorge zu tragen, dass das Bestehen von Ansprüchen geprüft, die wirtschaftliche Situation eines Schuldners beobachtet wird, Vorkehrungen gegen eine drohende Verjährung getroffen werden sowie außergerichtliche und, falls erforderlich, gerichtliche Durchsetzungs- und Vollstreckungsmaßnahmen konsequent betrieben werden.59
30
Für den Entscheidungsprozess der Kartellanten gilt wiederum, dass eine positive Kosten-/Nutzenabwägung bzw. Schätzung der Erfolgsaussichten potenzieller Schadensersatzforderungen regelmäßig einen hinreichenden Grund darstellen wird, für eine kooperative Vorgehensweise (insb. Vergleichsverhandlungen) zu optieren. Andere gewichtige Gründe des Unternehmenswohls können aber auch hier im Einzelfall ein anderes Ergebnis vorgeben. Im Vergleich zum Entscheidungsprozess geschädigter Unternehmen dürfte der Ermessensspielraum der Geschäftsleitung von Kartellanten aber deutlich umfangreicher ausgestaltet sein.60
38 Vgl. dazu ausführlich Stancke, WuW 2015, 822. 39 Bspw. in den Pressemitteilungen der Europäischen Kommission zu aktuellen Bußgeldentscheidungen, vgl. in jüngster Zeit: Kommission, Pressemitteilung vom 30.1.2020, IP/20/157; oder den Praktischen Leitfaden der Europäischen Kommission. 40 Insoweit kann auf die Kartellschadensersatzrichtlinie und die 9. GWB-Novelle (BT-Drs. 18/10207) verwiesen werden. 41 Vgl. hierzu auch Kapitel M Rn. 70ff. 42 Vgl. auch Bayer/Scholz, NZG 2019, 201, 203. 43 Vgl. u.a. § 93 Abs. 2 AktG, § 43 Abs. 2 GmbHG; siehe ferner jeweils m.w.N.: Fleischer, in: Spindler/Stilz, AktG, § 93 Rn. 176ff., 307ff.; Fleischer, in: MüKo-GmbHG, § 43 Rn. 214ff., 339ff.; Spindler, in: MüKo-AktG, § 93 Rn. 82. 44 Die Business Judgment Rule gilt in gleichem Maße für Kartellanten, die entscheiden müssen, ob sie eine konfrontative oder kooperative Linie gegenüber möglichen Anspruchsstellern verfolgen wollen. Die dargestellten allgemeinen Prüfungs- und Abwägungsmaßstäbe sind insoweit uneingeschränkt auch auf diesen Entscheidungsprozess übertragbar. 45 Vgl. Bayer/Scholz, NZG 2019, 201, 203f.; Stancke, WuW 2015, 822, 824; Beurskens, in: Baumbach/Hueck, GmbHG, § 43 Rn. 34–38; Rother, in: Fuchs/Weitbrecht, KartellR-HdB, § 3 Rn. 26ff.; kritisch: Altmeppen, ZIP 2019, 1253, 1253f. 46 Detailliert hierzu auch: Fleischer, in: Spindler/Stilz, AktG, § 93 Rn. 66ff.; Fleischer, in: MüKo-GmbHG, § 43 Rn. 80ff. 47 Kartellanten mit derartigen Geschäftspartnern sollten daher mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von Schadensersatzansprüchen rechnen. 48 Vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 4 GWB; Stein/Friton/Huttenlauch, WuW 2012, 38, 40ff.; in diesem Zusammenhang sollten Kartellanten frühzeitig erwägen, mit den Geschäftspartnern zu kooperieren und hierdurch auch den erforderlichen sog. Selbstreinigungsprozess (§ 125 GWB) zu fördern, da sonst erhebliche wirtschaftliche Einbußen drohen können. 49 Spindler, in: MüKo-AktG, § 93 Rn. 55–57 m.w.N. 50 Näheres zum Zugang zu Informationen Kapitel G. 51 Vgl. hierzu Spindler, in: MüKo-AktG, § 93 Rn. 55ff.; Beurskens, in: Baumbach/Hueck, GmbHG, § 43 Rn. 37; ferner jeweils m.w.N.: Fleischer, in: Spindler/Stilz, AktG, § 93 Rn. 70; Fleischer, in: MüKo-GmbHG, § 43 Rn. 84; Stancke, WuW 2015, 822, 825. 52 Vgl. auch Weber/Kiefner/Jobst, NZG 2018, 1131, 1133f., die auch zutreffend darauf hinweisen, dass mit zunehmender Digitalisierung die Anforderungen an die Informationsbeschaffung steigen können. 53 Grundsätzlich ist es im Rahmen eines Monitorings ausreichend, dass – neben der Sicherstellung, der im Unternehmen wahrgenommenen Verdachtsmomente hinsichtlich etwaiger Kartellaktivitäten von Lieferanten oder anderen Geschäftspartnern – die kartellbehördlichen Pressemitteilungen zu Verfahrenseinleitungen oder -abschlüssen in den für das jeweilige Unternehmen relevanten Produktmärkten gesichtet und die in diesen enthaltenen Informationen aufbereitet werden. Näher zum Monitoring und Kartellscreening unten Kapitel C Rn. 4ff.; vgl. auch Rother, in: Fuchs/Weitbrecht, KartellR-HdB, § 3 Rn. 28. 54 Fleischer, in: Spindler/Stilz, AktG, § 93 Rn. 66; Fleischer, in: MüKo-GmbHG, § 43 Rn. 80 mit Verweis auf BT-Drs. 15/5092, S. 11; Stancke, WuW 2015, 822, 824. 55 Vgl. hierzu auch Kapitel C Rn. 17ff. 56 Vgl. Fleischer, in: Spindler/Stilz, AktG, § 93 Rn. 88; Fleischer, in: MüKo-GmbHG, § 43 Rn. 101. 57 Hierzu auch Stancke, WuW 2015, 822, 825ff.; Bayer/Scholz, NZG 2019, 201, 203f.; Beurskens, in: Baumbach/Hueck, GmbHG, § 43 Rn. 35–38. 58 Vgl. BGH, 21.4.1997, II ZR 175/95, BGHZ 135, 244, 254ff.; BGH, 8.7.2014, II ZR 174/13, BGHZ 202, 26, 32; BGH, 18.9.2018, II ZR 152/17, BGHZ 219, 356, 363ff. hinsichtlich der Pflicht zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen pflichtwidrig handelnde Vorstandsmitglieder. 59 Stancke, WuW 2015, 822, 827; ferner jeweils m.w.N.: Fleischer, in: Spindler/Stilz, AktG, Bd. 1, § 93 Rn. 88; Fleischer, in: MüKo-GmbHG, § 43 Rn. 101. 60 Vgl. hierzu auch Fleischer, in: Spindler/Stilz, AktG, § 93 Rn. 91a; Fleischer, in: MüKo-GmbHG, § 43 Rn. 102a.
Kapitel C Prozessmanagement bei der Geltendmachung kartellrechtlicher Schadensersatzklagen
Literatur: Arrowsmith/Prieß/Friton, Self-Cleaning in Procurement Law?, Public Procurement Law Review 2009, 257; Bauermeister, Eltern haften für ihre Kinder – jetzt auch im Schadensersatzverfahren? – zugleich Anmerkung zum Urteil des EuGH in Sachen Vantaan kaupunki, NZKart 2019, 252; Bellinghausen/Grothaus, Erstes Urteil zum Lkw-Kartell – Rückenwind für Kartellgeschädigte? – Anmerkung zur Entscheidung des LG Hannover in Sachen Stadt Göttingen/MAN, NZKart 2018, 116; Beth/Pinter, Preisschirmeffekte: Wettbewerbsökonomische Implikationen für kartellrechtliche Bußgeld- und Schadensersatzverfahren, WuW 2013, 228; Beth/Reimers, Für Kartellanten wird es ungemütlicher – Im Blickpunkt: Screeningmethoden zur Aufdeckung von Kartellabsprachen, CB 2019, 17; Bien, Perspektiven für eine europäische Gruppenklage bei Kartellverstößen? – Die Opt out-Class Actions als Äquivalent der Vorteilsabschöpfung, NZKart 2013, 12; Brand, Deliktschadensersatz und Torpedo-Klagen – Ein Beitrag zum Prioritätsprinzip nach Art. 29 Abs. 1 EuGVVO am Beispiel des Kartellschadensersatzes, IPRax 2016, 314; von Brevern, Anmerkung zu LG München, Urt. v. 7.2 2020, 37 O 18934/17, WuW 2020, 217; Burgi, Ausschluss und Vergabesperre als Rechtsfolgen von Unzuverlässigkeit, NZBau 2014, 595; Dabringhausen/Fedder, Die Pflicht zur Herausgabe der Beute fördert die Rechtstreue, VergabeR 2013, 20; Davis/Garcés, Quantitative Techniques for Competition and Antitrust Analysis, 2009; Dreher/Hoffmann, Die erfolgreiche Selbstreinigung zur Wiedererlangung der kartellvergaberechtlichen Zuverlässigkeit und die vergaberechtliche Compliance – Teil 1, NZBau 2014, 67; Dreher/Hoffmann, Die erfolgreiche Selbstreinigung zur Wiedererlangung der kartellvergaberechtlichen Zuverlässigkeit und die vergaberechtliche Compliance – Teil 2, NZBau 2014, 150; Dreher/Hoffmann, Sachverhaltsaufklärung und Schadenswiedergutmachung bei der vergaberechtlichen Selbstreinigung, NZBau 2012, 265; Ebersoll/Stork, Smart Risk Assessment: Mehr Effizienz durch Screening, CCZ 2013, 129; Eckel, Kollektiver Rechtsschutz gegen kartellrechtliche Streuschäden: Das Vereinigte Königreich als Vorbild?, WuW 2015, 4; Eversberg, Prozessfinanzierung für den Versicherungsprozess, in: Veith/Gräfe (Hrsg.), Versicherungsprozess, 4. Aufl. 2020, § 3; Franz/Jüntgen, Die Pflicht von Managern zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aus Kartellverstößen, BB 2007, 1681; Frische/Schmidt, Eine neue Form der Versicherung?, NJW 1999, 2998; Grunewald, Prozessfinanzierungsvertrag mit gewerbsmäßigem Prozessfinanzierer – ein Gesellschaftsvertrag BB 2000, 729; Harms, Nochmals: Intertemporale Verjährungsfragen bei kartellrechtlichen „follow-on“ Schadenersatzansprüchen, NZKart 2014, 175, 177; Harms/Petrasincu, Die Beiziehung von Ermittlungsakten im Kartellzivilprozess – Möglichkeit zur Umgehung des Schutzes von Kronzeugenanträgen?, NZKart 2014, 304; Hartung, Noch mal: Klagen ohne Risiko – Prozessfinanzierung und Inkassodienstleistung aus einer Hand als unzulässige Rechtsdienstleistung?, BB 2017, 2825; Haus/Serafimova, Neues Schadensersatzrecht für Kartellverstöße – die EU-Richtlinie über Schadensersatzklagen, BB 2014, 2883; Henssler, Rechtsunsicherheiten beim Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen, AnwBl. 2018, 342; Henssler, Prozessfinanzierende Inkassodienstleister – Befreit von den Schranken des anwaltlichen Berufsrechts?, NJW 2019, 545; Heuking, Strafbarkeitsrisiken beim Submissionsbetrug, BB 2013, 1155; Hüschelrath, Economic Approaches to Fight Bid Rigging, JECLAP 2013, 185; Hüschelrath/Leheyda/Müller/Veith, Schadensermittlung und Schadensersatz bei Hardcore-Kartellen: Ökonomische Methoden und rechtlicher Rahmen, 2012; Hutschneider/Stieglitz, Die tatsächliche Kartellschadensanscheinsbeweisvermutung – Eine Bestandsaufnahme zu den Beweiserleichterungen im Kartellschadensersatzprozess, NZKart 2019, 363; Imhof/Karagok/Rutz, Screening for Bid-rigging – Does it Work?, CRE-SE Working Paper No. 2017-9; Inderst/Maier-Rigaud/Schwalbe, Preisschirmeffekte, WuW 2014, 1043; Jaskolla, Prozessfinanzierung gegen Erfolgsbeteiligung, 2004; Kamann/Ohlhoff/Völcker, Kartellverfahren und Kartellprozess, 2017; Kersting, Die neue Richtlinie zur privaten Rechtsdurchsetzung im Kartellrecht, WuW 2014, 564; Kersting, Kartellrechtliche Haftung des Unternehmens nach § 1 AEUV – Folgerungen aus EuGH, Urt. v. 14.3.2019, C-724/17 – Skanska, WuW 2019, 290; Klumpe, You’ll never walk alone, NZKart 2019, 405; Koch, Europäischer kollektiver Rechtsschutz vs. amerikanische „class action“: Die gebändigte Sammelklage in Europa?, WuW 2013, 1059; Kochheim, die gewerbliche Prozessfinanzierung, 2003; Krüger, Kartellregress: Der Gesamtschuldnerausgleich als Instrument der privaten Kartellrechtsdurchsetzung, 2010; Krüger, Überlegungen zur Gesamtschuld von Kartellmitgliedern im System der privaten Kartelldurchsetzung: Einer für alle, alle gegen einen? in: Oberender (Hrsg.), Private und öffentliche Kartelldurchsetzung, 2012; Kühnen, Überlegungen zur Schätzung der Kartellschadensersatzhöhe, NZKart 2019, 515; Langen/Teigelack, Amerikanische Verhältnisse im Kartellrecht oder Ende des Abtretungsmodells? – Zur gebündelten Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen de lege lata, BB 2014, 1795; Lettl, Haftungsausfüllende Kausalität für einen Schadensersatzanspruch wegen Verstoßes gegen Art. 101 AEUV, § 1 GWB, insbesondere beim sog. „umbrella pricing“, WuW 2014, 1032; Löwenkamp/Nuys, Zu Grund und Grenzen pauschalierter Kartellschadensersatzklauseln, NZKart 2017, 61; Lübbig/Mallmann, Offenlegung von Beweismitteln gemäß dem Kabinettsentwurf für das 9. GWB-Änderungsgesetz, NZKart 2016, 518; Mäger, Entkoppelt der Brexit Public und Private Enforcement im Kartellschadensersatzrecht?, NZKart 2018, 3; Makatsch, Kartellschadensersatz – Vergleichen oder Prozessieren?, CCZ 2015,127; Makatsch/Abele, Das Ende kollektiver Kartellschadensersatzklagen in Deutschland?, WuW 2014, 164; Makatsch/Abele, Kartellschadensersatz – Goodbye Deutschland?, WuW 2015, 461; Makatsch/Bäuerle, Private vs. Public Enforcement 4.0, WuW 2016, 341; Makatsch/Mir, Die neue EU-Richtlinie zu Kartellschadensersatzklagen – Angst vor der eigenen „Courage“?, EuZW 2015, 7; Makatsch, Kartellschadensersatz als Bußgeldmindernder Faktor, NZKart 2020, 103; Meller-Hannich, Sammelklagen, Gruppenklagen, Verbandsklagen – bedarf es neuer Instrumente des kollektiven Rechtsschutzes im Zivilprozess?, NJW-Beil 2018, 29; Mengden, David gegen Goliath im Kartellschadensersatzrecht – Lassen sich Musterfeststellungsklage bzw. EU-Verbandsklage als kollektive Folgeklage einsetzen?, NZKart 2018, 398; Morell, Keine Kooperation ohne Konflikt – Verstößt ein Inkassodienstleister durch das Angebot einer Prozessversicherung gegen § 4 RDG?, JZ 2019, 809; Morell, „Mietright“ und die Abtretungssammelklage, ZWeR 2020, 328; Motta, Competition Policy: Theory and Practice, 2004; Nothelfer, Empirische Screenings als innovative Methode im Rahmen der Antitrust-Compliance, CCZ 2012, 186; Oest/Hess/Janutta, Kartellschadensersatz in Deutschland und Großbritannien: Strategische Überlegungen aus Kläger- und Beklagtensicht, CCZ 2017, 273; Palatzke/Jürschik, Vergaberechtliche Selbstreinigung nach Kartellverstoß – alle Fragen geklärt oder weiterhin alles offen? – Anmerkung zum Urteil des EuGH in Sachen Vossloh Laeis/Stadtwerke München, NZKart 2019, 83; Petrasincu, Kartellschadensersatz nach dem Referentenentwurf der 9. GWB-Novelle, WuW 2016, 330; Petrasincu, Verjährung des Gesamtschuldnerregresses wegen Kartellschadensersatzansprüchen, NZKart 2014, 437; Pohlmann, Verjährung nach der EU-Richtlinie 2014/104 zum Kartellschadensersatz, WRP 2015, 546; Prieß, Warum die Schadenswiedergutmachung Teil der vergaberechtlichen Selbstreinigung ist und bleiben muss, NZBau 2012, 425; Reimers/Brack/Modest, Kartellrechtliche Compliance in Zeiten der Digitalisierung, NZKart. 2018, 453; Richter, Das Skanska-Urteil des EuGH – Einführung der Konzernhaftung im Kartellschadensersatzrecht, BB 2019, 1154; Römermann/Günther, Legal Tech als berufsrechtliche Herausforderung – Zulässige Rechtsdurchsetzung mit Prozessfinanzierung und Erfolgshonorar, NJW 2019, 551; Römermann, Legaltech: Geschäftsmodell nun doch untersagt?, AnwBl Online 2020, 273 Sack, Negative Feststellungsklagen und Torpedos, GRuR 2018, 893; Scharn/Teicke, Die Begutachtung der Selbstreinigung im neuen Wettbewerbsregister, CB 2017, 363, 364; Schreiber, The Case for Bundling Antitrust Damage Claims by Assignment, Concurrences 2014, 23; Schweitzer, Die neue Richtlinie für wettbewerbsrechtliche Schadensersatzklagen, NZKart 2014, 335; Soyez, Die Verjährung des Schadensersatzanspruchs gem. § 33 Abs. 3 Satz 1 GWB, ZWeR 2011, 407; Stadler, Abtretungsmodelle und gewerbliche Prozessfinanzierung bei Masseschäden, WuW 2018, 189; Stadler, Grenzen der Inkassozession nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz – Besprechungsaufsatz zu BGH, Urt. vom 27.11.2019, VIII ZR 285/18, JZ 2020, 321; Stancke, Zu den Pflichten und Abwägungskriterien hinsichtlich der Durchsetzung kartellrechtlicher Schadensersatzansprüche, WuW 2015, 822; Suchsland/Rossmann, Verpflichtet die Kartellschadensersatzrichtlinie zur Übernahme des europäischen Unternehmensbegriffs in das deutsche Recht?, WuW 2015, 973; Thiede, Anmerkung zu LG München, Urt. v. 7.2 2020, 37 O 18934/17, EuZW 2020, 279; Thomas/Legner, Die wirtschaftliche Einheit im Kartellzivilrecht, NZKart 2016, 155; Toelksdorf, „Sammelklagen“ von registrierten Inkassodienstleistern – eine unzulässige Erscheinungsform des kollektiven Rechtsschutzes?, ZIP 2019, 1401; Ulshöfer, Kartell- und Submissionsabsprachen von Bietern – Selbstreinigung und Schadenswiedergutmachung, VergabeR 2016, 327; Valdini, Klagen ohne Risiko – Prozessfinanzierung und Inkassodienstleistung aus einer Hand als zulässige Rechtsdienstleistung?, BB 2017, 1809; Vollrath, Das Maßnahmenpaket der Kommission zum wettbewerbsrechtlichen Schadensersatzrecht, NZKart 2013, 434; Wagener, Follow-up zu Skanska – Bisherige „Umsetzung“ durch nationale Zivilgerichte, NZKart 2019, 535; Weitbrecht, Die Umsetzung der EU-Schadensersatzrichtlinie – Eine Chance für den Rechtsstandort Deutschland, WuW 2015, 959; Weitbrecht, Kartellschadensersatz 2019, NZKart 2020, 106; Welzenbach, AGB-rechtliche Würdigung des pauschalierten Kartellschadensersatzes – Schienenkartell-Entscheidung des LG Potsdam, NZKart 2016, 356; Wurmnest, Forum Shopping bei Kartellschadensersatzklagen und die Kartellschadensersatzrichtlinie, NZKart 2017, 2.
Übersicht
I. Pflicht zur Anspruchsverfolgung
II. Identifizierung und Prävention von Kartellschadensersatzfällen
1. Monitoring der Aktivitäten der Kartellbehörden
2. Kartellscreening
3. Abwehr und Prävention von Kartellschadensrisiken
III. Interne Kriterien für die Anspruchsverfolgung
1. Einschätzung der Betroffenheit und der Schadenshöhe
a) Betroffenheit
b) Schätzung der Schadenshöhe
2. Verjährung der Ansprüche
IV. Strategie zur Anspruchsdurchsetzung
1. Vergleichsverhandlungen als Alternative zum Prozess
2. Auswahl des Beklagten
3. Auswahl des Gerichtsstands
4. Auswahl der Klageart
5. Anspruchsbündelung
a) Streitgenossenschaft
b) Sammelklagen
c) Abtretung
aa) Rechtlicher Rahmen
bb) Praktische Herangehensweise
6. Finanzierung
a) Rechtlicher Rahmen
b) Praktische Herangehensweise