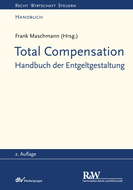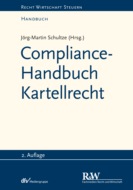Kitabı oku: «Kartellrechtliche Schadensersatzklagen», sayfa 7
III. Interne Kriterien für die Anspruchsverfolgung
1. Schadensermittlung und Schadenshöhe
a) Schadensermittlung
17
In Fällen, in denen im Kartellzeitraum direkt von einem oder mehreren Kartellbeteiligten Waren oder Dienstleistungen bezogen wurden, auf die sich die Kartellabsprache bezieht, ist die Wahrscheinlichkeit eines erlittenen Schadens groß.44 Es ist empfehlenswert, bei Bekanntwerden eines Kartellverstoßes zunächst die direkten Verbindungen zu den Kartellbeteiligten zu überprüfen. Angaben aus der Einkaufsabteilung oder dem Rechnungswesen helfen hier weiter. Alle für die Schadensverfolgung relevanten Daten45 sollten auch nach Ablauf interner Aufbewahrungsfristen durch die Aussprache eines Dokumentenvernichtungsverbots gesichert werden.
18
Aus Gründen der effektiven Durchsetzung des Unionsrechts muss jedem Geschädigten eine Klagemöglichkeit zustehen.46 Daher können auch mittelbar Geschädigte Schadensersatz verlangen. Kartelleffekte können entlang der Lieferantenkette über mehrere Wertschöpfungsstufen hinweg eintreten, etwa wenn die kartellbedingten Preiserhöhungen an die Kunden weitergegeben werden („Pass-on“).47 Daher ist zu prüfen, ob kartellbefangene Produkte auf indirektem Wege beschafft wurden oder Bestandteile bezogener Vorprodukte sind. Supply-Chain-Manager des Einkaufs können hier Auskunft geben. Kartellabsprachen können ferner nicht nur die Preissetzungsspielräume der Kartellbeteiligten erhöhen, sondern auch die von nicht an dem Kartell beteiligten Kartellaußenseitern, die vergleichbare Produkte wie die Kartellbeteiligten anbieten (Preisschirm- oder Umbrella-Effekt).48 Deshalb sollten bei entsprechendem Verdacht auch die Beschaffungsvorgänge mit Kartellaußenseitern untersucht werden.49 Da der Kausalitätsnachweis bei Preisschirmeffekten schwieriger als bei direkten Beziehungen zu den Kartellbeteiligten zu erbringen ist,50 empfiehlt sich die frühzeitige Einschaltung eines internen bzw. externen Ökonomen. Selbst Personen, die nicht als Anbieter oder Nachfrager (mittelbar) auf dem von einem Kartell betroffenen Markt tätig sind können Schadensersatz verlangen,51 so dass es sich auch lohnen kann zunächst nicht ganz offensichtliche Verbindungen zu untersuchen.52
19
Kartellabreden können auch über das Ende des Kartells hinaus fortwirken und damit (weiterhin) Kartellschäden hervorrufen, etwa durch langfristige Verträge oder „Lerneffekte“ der Kartellbeteiligten. Daher empfiehlt es sich, die eigenen Vertragsunterlagen über das Ende des Kartellzeitraums hinaus zu prüfen. Auch eine Analyse der Preise im Zeitverlauf kann Aufschluss über etwaige Fortwirkungseffekte bringen. Hierauf deutet etwa ein unverändertes Preisniveau nach Kartellende hin. Solche Fortwirkungseffekte und daraus resultierende Schäden sollten in eine ganzheitliche Schadensermittlung einbezogen werden, ungeachtet dessen, ob es sich um direkte oder indirekte Lieferbeziehungen zu den Kartellbeteiligten oder gar um Preisschirmeffekte handelt. Soweit eine Fortwirkung der Kartellabsprachen und somit einer Schädigung über das Ende des Kartellzeitraums hinaus nicht ausgeschlossen werden kann, ist es naheliegend, auch die Lieferbeziehungen zu den Kartellbeteiligten, zu den ggf. von den Kartellbeteiligten kaufenden Lieferanten und Sublieferanten sowie zu etwaigen Kartellaußenseitern über das Ende des Kartellzeitraums zu überprüfen und Unterlagen, etwa Kaufbelege oder Ausschreibungsunterlagen, zu sammeln und aufzubewahren.
b) Schätzung der Schadenshöhe
20
Kartellschäden lassen sich selten mit absoluter Gewissheit quantifizieren. Während in einigen Jurisdiktionen eine gesetzliche Vermutung eines Schadens auch der Höhe nach besteht,53 enthält das GWB mit § 33a Abs. 2 bislang nur eine für nach dem 26.12.2016 entstandene Ansprüche geltende54 widerlegliche Vermutung, dass ein Kartell einen Schaden verursacht. Die instanzgerichtliche Rechtsprechung zum Kartellschadensersatz hatte Geschädigten auch schon für Fälle, auf die die gesetzliche Schadensvermutung der 9. GWB-Novelle noch nicht anwendbar ist, entsprechende Beweiserleichterungen sowohl für den Beweis der seinerzeit noch relevanten tatbestandsseitigen Kartellbefangenheit als auch eines Schadenseintritts eingeräumt.55 Ganz überwiegend nahmen die Instanzgerichte einen „doppelten“ Anscheinsbeweis an.56 Der BGH hat in der Schienenkartell-Entscheidung zumindest für Quoten- und Kundenschutzkartelle hingegen festgestellt, dass weder für den Eintritt des Schadens noch für die Kartellbetroffenheit die Voraussetzungen für die Annahme eines Anscheinsbeweises erfüllt seien.57 Vielmehr sei der strengere Maßstab einer tatsächlichen Vermutung zu erfüllen.58 Ein Klarstellungsbedürfnis durch den Gesetzgeber scheint angezeigt. Daran ändert auch die „Schienenkartell II“-Entscheidung des BGH vom 28.1.2020 grundsätzlich nichts.59 Der BGH stellt in der Schienenkartell II-Entscheidung allerdings klar, dass zur Ermittlung der haftungsbegründenden Kausalität nicht festgestellt werden muss, ob sich der Kartellverstoß auf die einzelnen in Rede stehenden Beschaffungsvorgänge oder Einkäufe, auf die der Anspruchsteller sein Schadensersatzbegehren stützt, tatsächlich ausgewirkt hat und das Geschäft damit in diesem Sinn „kartellbetroffen“ bzw. „kartellbefangen“ ist.60 Mit der 10. GWB-Novelle ist neben der gesetzlichen Vermutung zum Schadenseintritt auch eine widerlegliche Vermutung in § 33a Abs. 2 Satz 4 GWB über die Kartellbefangenheit aufgenommen worden, nach der Rechtsgeschäfte über Waren oder Dienstleistungen mit kartellbeteiligten Unternehmen, die sachlich, zeitlich und räumlich in den Bereich eines Kartells fallen, von diesem auch erfasst waren.61 Geschädigten kann es nicht zugemutet werden den Nachweis erbringen zu müssen, dass alle von ihnen bezogenen Produkte von den Kartellabsprachen umfasst waren und dass die konkreten Absprachen, die diese Produkte betreffen, auch in jedem einzelnen Fall beachtet und umgesetzt wurden. Dieser Nachweis ist dem Kläger in der Praxis oft nicht möglich, da es sich um in der Sphäre des Beklagten liegende Umstände handelt. Die Gerichte können gemäß § 33a Abs. 3 GWB und nach der Rechtsprechung des BGH62 eine Schadensschätzung gemäß § 287 ZPO vornehmen. Das LG Dortmund hat in einer Entscheidung im September 2020 Kartellschadensersatz auf der Basis einer freien Schadenschätzung nach § 287 ZPO zugesprochen, d.h. ohne, dass die Kläger ein ökonomisches Schadensgutachten vorgelegt hatten.63 Der Schadensersatzanspruch umfasst die Erstattung eingetretener Vermögenseinbußen einschließlich des entgangenen Gewinns sowie der Zinsen.64 Zinsen und Zinseszinseffekte können mitunter einen Großteil der Forderungssumme ausmachen oder diese sogar übersteigen.65 Die durch das Kartell verursachte Vermögenseinbuße besteht nach der Differenzhypothese grundsätzlich in der Differenz zwischen dem hypothetischen Wettbewerbspreis (kontrafaktischer bzw. But-For-Preis) und dem gezahlten Preis. Der But-For-Preis wird vor allem durch Vergleichsmarktbetrachtungen bestimmt.66 Ferner hat zumeist (über den Kartellverstoß hinaus) eine Reihe von Faktoren Einfluss auf die Höhe und die Entwicklungen von Preisen. Diese preisbeeinflussenden Faktoren werden sich sowohl im Zeitverlauf als auch im Vergleich regional und sachlich verschiedener Märkte unterscheiden. Einfache (Durchschnitts-)Preisvergleiche reichen hier nicht mehr aus. Hierfür können bestenfalls ökonometrische Methoden eingesetzt werden, die eine angemessene, simultane Berücksichtigung mehrerer preisbeeinflussender Faktoren einräumen und eine transparente, überprüfbare Schätzung des Schadens ermöglichen.67 In der Praxis entscheidet häufig die Datenverfügbarkeit darüber, welche Methode anwendbar ist und wie belastbar die Ergebnisse einzustufen sind.68 Neben unternehmensinternen Daten können Informationen teilweise auch über öffentliche Statistiken, Branchenberichte oder Marktstudien bezogen werden. Einige Daten existieren zwar in der Sphäre der Kartellbeteiligten, der Zugriff gestaltet sich hier aber weiterhin aufwendig.69 Ferner kann es sich in einigen Fällen als sinnvoll erweisen, mit anderen geschädigten Unternehmen im kartellrechtlich zulässigen Rahmen eine Datenbank aufzusetzen, um eine ggf. gegenüber den Kartellbeteiligten bestehende Informationsasymmetrie zumindest in Teilen aufzuwiegen. Sofern Daten nicht verfügbar sind, müssen entweder einfache, meist weniger belastbare Schätzmethoden verfolgt werden, oder es ist mit Annahmen zu arbeiten. Hierbei ist jedoch höchste Transparenz zu wahren.
2. Verjährung der Ansprüche
21
Verjährungsfristen sollten stets von Anfang an im Blick behalten werden. Kartellrechtliche Schadensersatzansprüche unterliegen nach der Umsetzung der Kartellschadensersatzrichtlinie durch die 9. GWB-Novelle gemäß § 33h Abs. 1 GWB einer fünfjährigen kenntnisabhängigen Verjährung. Die Verjährung beginnt nach zutreffender Ansicht nicht vor Veröffentlichung bzw. Offenlegung der kartellbehördlichen Entscheidung.70 Sie wird aufgrund eines kartellbehördlichen Verfahrens oder einer Auskunftsklage gemäß § 33h Abs. 6 GWB bis ein Jahr nach dessen Beendigung gehemmt. Kenntnisunabhängig verjähren Schadensersatzansprüche nach zehn Jahren ab Anspruchsentstehung und Beendigung des Verstoßes.71 Diese Regeln gelten gemäß § 186 Abs. 3 GWB nicht für vor dem 27.12.2016 entstandene Ansprüche. Für solche Ansprüche finden die jeweils geltenden Verjährungsvorschriften Anwendung.72 Um einer drohenden Verjährung zu entgehen, kommen verschiedene verjährungshemmende Maßnahmen in Betracht. Dazu zählt die Klageerhebung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB. In einem frühen Stadium sind die Erfolgsaussichten jedoch häufig unklar. Selbst eine Auskunfts-, Stufen- oder nur eine Feststellungsklage erscheint wegen der hohen Kostenrisiken oft nicht angebracht.73 Vorzugswürdig ist der Abschluss von Einredeverzichtserklärungen bzw. Verjährungshemmungsvereinbarungen mit den Kartellbeteiligten. Sofern diese einem Verzicht nicht zustimmen, können auch gem. § 203 BGB Verhandlungen die Verjährung hemmen.74
44 § 33a Abs. 2 GWB enthält eine widerlegliche Schadensvermutung; BGH, 28.6.2005, KRB 2/05, NJW 2006, 163, 164f. – Berliner Transportbeton I; Inderst/Thomas, Schadensersatz bei Kartellverstößen, S. 122ff. 45 Etwa Bezugspreise und -mengen, Lieferkonditionen und Bezugszeitpunkte. 46 EuGH, 20.9.2001, Rs. C-453/99, ECLI:EU:C:2001:465 m. Anm. Nowak, EuZW 2001, 715 – Courage; EuGH, 13.7.2006, verb. Rs. C-295/04 bis C-298/04, ECLI:EU: C:2006:461 m. Anm. Lübbig, EuZW 2006, 529 – Manfredi. Vgl. auch Art 12 Abs. 1 der Kartellschadensersatzrichtlinie; ferner BGH, 28.6.2011, KZR 75/10, BGHZ 190, 145 – ORWI. 47 Für eine vertiefende Erläuterung: Oxera u.a., Quantifying antitrust damages: Towards non-binding guidance for courts, S. 116ff.; EU-Kommission, Study on the Passing on of Overcharges, abrufbar unter http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/KD0216916ENN.pdf (zuletzt aufgerufen am 15.6.2020); EU-Kommission, Leitlinen für die nationalen Gerichte zur Schätzung des Teils des auf den mittelbaren Abnehmer abgewälzten Preisaufschlags, ABl. 2019 C 267/4. 48 Der EuGH hat in der Rechtssache Kone (EuGH, 5.6.2014, ECLI:EU:C:2014:1317, m. Anm. Zöttl, EuZW 2014, 586 – Kone) klargestellt, dass ein adäquater Kausalzusammenhang der Kartellabsprache und der Schädigung durch Preisschirmeffekte bestehen kann; vgl. dazu auch die anschließenden erste dt. Rechtsprechung: OLG Karlsruhe, 9.11.2016, 6 U 204/15 Kart (2), ECLI:DE:OLGKARL:2016:1109.6U204.15.0A = BB 2017, 398, 400f. – Grauzementkartell; BGH, 12.6.2018, KZR 56/16, ECLI:DE:BGH: 2018:120618UKZR56.16.0 = NJW 2018, 2479, 2482 – Grauzementkartell II. 49 Vgl. Ohlhoff, in: Kamann/Ohlhoff/Völcker, Kartellverfahren und Kartellprozess, § 26, Rn. 136ff.; Inderst/Maier-Rigaud/Schwalbe, WuW 2014, 1043; Beth/Pinter, WuW 2013, 228, 232. 50 Zu den Voraussetzungen vgl. Lettl, WuW 2014, 1032, 1038. 51 Vgl. EuGH, Rs. C- 435/18, 12.12.2019, ECLI:EU:C:2019:1069, NZKart 2020, 30 – Otis u.a.; siehe dazu auch BGH, 28.2.2020, KZR 24/17, ECLI:DE:BGH: 2020:280120UKZR24.17.0 – Schienenkartell II, Rn. 24. 52 In dem in der Rechtssache Otis dem EuGH vorgelegten Fall, stellte der Gerichtshof fest, dass das Land Oberösterreich höhere Förderdarlehen zur Finanzierung von Bauprojekten an Bauherren wegen durch das Aufzug- und Fahrtreppenkartells überhöhter Preise ausschütten musste, als dies ohne das Kartell der Fall gewesen wäre. Der Differenzbetrag, so der Gerichtshof, hätte für andere gewinnbringende Zwecke verwandt werden können. 53 Siehe Ungarn mit einer schon 2009 eingeführten widerlegbaren Schadensvermutung i.H.v. 10 % (88/C. § 116. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozas tilalmáról) und ebenfalls Lettland (§ 21 Grozījumi Konkurences likumā), wo sich hierzu aber jeweils noch keine bekannte Spruchpraxis der dortigen Gerichte hat herausbilden können. 54 Vgl. § 186 Abs. 3 Satz 2 GWB. 55 Vgl. OLG Karlsruhe, 10.3.2017, 6 U 132/15 (Kart.), ECLI:DE:OLGKARL:2017: 0310.6U132.15KART.0A, BeckRS 2017, 149111, Rn. 72 – Schienenkartell; OLG Karlsruhe, 31.7.2013, 6 U 51/12 (Kart.), ECLI:DE:OLGKARL:2013:0731.6U51. 12.0A, NZKart 2014, 366, 367 – Löschfahrzeuge; OLG Jena, 22.2.2017, 2 U 583/15 Kart, ECLI:DE:OLGTH:2017:0222.2U583.15KART.0A, NZKart 2017, 540, 541 – Schienenkartell; KG Berlin, 1.10.2009, 2 U 10/03, ECLI:DE:KG:2009:1001.2U10. 03.0A, BeckRS 2009, 88509 – Transportbeton; OLG München, 8.3.2018, U 3497/16 Kart, ECLI:DE:OLGMUEN:2018:0308.U3497.16KART.0A, NZKart 2018, 230, 232 – Schienenkartell; OLG München, 28.6.2018, 29 U 2644/17 Kart, ECLI:DE: OLGMUEN:2018:0628.29U2644.17KART.0A, NZKart 2018, 379, 380 – Weichenkartell; OLG Celle, 14.8.2018, 13 U 105/16 (Kart), ECLI:DE:OLGCE:2018:0814. 13U105.16KART.0A, BeckRS 2018, 30077, Rn. 51 – Schienenkartell. 56 Hutschneider/Stieglitz, NZKart 2019, 363, 368f.; eine Ausnahme bildete das OLG Düsseldorf, das jeweils von einer tatsächlichen Vermutung ausging, vgl. OLG Düsseldorf, 22.8.2018, VI-U (Kart) 1/17, ECLI:DE:OLGD:2018:0822.U.KART2.17.00, NZKart 2018, 477 – Schienenkartell I. 57 BGH, Urt. v. 11.12.2018, KZR 26/17, ECLI:DE:BGH:2018:111218UKZR26.17.0, NZKart 2019, 101 – Schienenkartell; siehe dazu auch z.B. Hutschneider/Stieglitz, NZKart 2019, 363ff. 58 BGH, 11.12.2018, KZR 26/17, ECLI:DE:BGH:2018:111218UKZR26.17.0 – Schienenkartell. 59 BGH, 28.1.2020, KZR 24/17, ECLI:DE:BGH:2020:280120UKZR24.17.0 – Schienenkartell II. Hieran hat er auch in den Urteilen Schienenkartell III, Schienenkartell IV und Schienenkartell V festgehalten, siehe BGH, 19.5.2020, KZR 70/17, BeckRS 2020, 22798, ECLI:DE:BG H:2020:190520UKZR70.17.0 – Schienenkartell III, BGH, 19.5.2020, KZR 8/18, ECLI:DE:BGH:2020:190520UKZR8.18.0 – Schienenkartell IV, BGH, 23.9.2020, KZR 4/19 – Schienenkartell V, wobei der BGH klarstellt, dass der Erfahrungssatz, dass die im Rahmen eines Kartells erzielten Preise im Schnitt über denjenigen liegen, die sich ohne die wettbewerbsbeschränkende Absprache gebildet hätten, auch dann zu berücksichtigen ist, wenn „nur“ über längere Zeit Listenpreise ausgetauscht wurden. Bindende Feststellungen der Kommission sind bei der Schadensschätzung durch das Gericht umfassend zu berücksichtigen. Wobei daraus Schlussfolgerungen gezogen werden können, die als solche nicht von der Bindungswirkung umfasst sind. 60 BGH, 28.1.2020, KZR 24/17, ECLI:DE:BGH:2020:280120UKZR24.17.0 – Schienenkartell II, BGH, 23.9.2020, KZR 4/19 – Schienenkartell V, ebenso LG Dortmund, 30.9.2020, 8 O 115/14, siehe auch BGH, 23.9.2020, KZR 35/19, ECLI:DE:BGH: 2020:230920UKZR35.19.0 – LKW, wobei der BGH hier den Pass-On-Einwand dahingehend einschränkt, dass insbesondere bei Streuschäden mittelbar Geschädigter, die eine mehrfache Inanspruchnahme der Schädiger ausschließen, der Weiterwälzungseinwand wegen einer hierdurch drohenden unbilligen Entlastung der Schädiger ausscheidet. 61 Gleiches soll nun nach § 33c Abs. 3 GWB auch für mittelbare Abnehmer gelten. 62 BGH, 12.7.2016, KZR 25/14, ECLI:DE:BGH:2016:120716UKZR25.14.0 = NZKart 2016, 436 – Lottoblock II; BGH, 28.1.2020, KZR 24/17, ECLI:DE:BGH:2020: 280120UKZR24.17.0, Rn. 35ff. = NZKart 2020, 136, 139 – Schienenkartell II. 63 LG Dortmund, 30.9.2020, 8 O 115/14; vgl. dazu auch Kühnen, NZKart 2019, 515ff. 64 Vgl. EU-Kommission, Mitteilung der Kommission zur Ermittlung des Schadensumfangs bei Schadensersatzklagen wegen Zuwiderhandlungen gegen Art. 101 oder 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, ABl. EU v. 13.6.2013, Nr. C 167/07, Rn. 6. 65 Dieser beträgt gemäß § 33 Abs. 4 GWB, § 288 Abs. 2 BGB mindestens fünf Prozentpunkte, bei Entgeltforderungen ohne Verbraucherbeteiligung sogar 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz gemäß § 288 Abs. 2 BGB, dazu BGH, 6.11.2013, KZR 58/11, NVwZ-RR 2014, 515, 521. Bei lang zurückliegenden Kartellen können sich entsprechend der damaligen Rechtslage andere Zinssätze ergeben. 66 Für einen ausführlichen Überblick der Methoden siehe Oxera u.a., Quantifying antitrust damages: Towards non-binding guidance for courts, S. 43ff.; Davis/Garcés, Quantitative Techniques for Competition and Antitrust Analysis, 2009, S. 354ff. 67 Vgl. Inderst/Thomas, Schadensersatz bei Kartellverstößen, S. 198ff. 68 Vgl. Inderst/Thomas, Schadensersatz bei Kartellverstößen, S. 247. 69 Trotz der Verbesserungen, die im GWB vorgesehen sind, vgl. dazu Kapitel G. 70 Makatsch/Mir, in: MüKo-Wettbewerbsrecht, § 33h GWB Rn. 45; Middelschulte/Hutschneider, in: Kamann/Ohlhoff/Völcker, Kartellverfahren und Kartellprozess, § 43, Rn. 136ff.; allein die Presseberichterstattung oder Pressemitteilung der Kartellbehörden nicht als ausreichend erachten z.B. KG Berlin, 1.10.2009, 2 U 17/03, ECLI:DE:KG:2009:1001. 2U10.03.0A – Transportbeton; Soyez, ZWeR 2011, 407, 418ff.; a.A. in der Literatur z.B. Harms, NZKart 2014, 175, 177, OLG Düsseldorf, 18.2.2015, VI U (Kart) 3/14, ECLI:DE:OLGD:2015:0218.VI.U.KART3.14.00, NZKart 2015, 201 – Zementkartell II, das Urteil betrifft aber eine Einzelfallkonstellation und ist nicht pauschal übertragbar; vgl. dazu krit. Makatsch/Abele, WuW 2015, 461. 71 Gegen eine Beibehaltung der kenntnisunabhängigen Verjährungsfrist vor Umsetzung der 9. GWB-Novelle z.B. Schweitzer, NZKart 2014, 335, 340; Makatsch/Mir, EuZW 2015, 7, 11; a.A. Pohlmann, WRP 2015, 546, 550. 72 Der BGH hat in dem vielbeachteten Urteil entschieden, dass die Hemmungsvorschrift des § 33 Abs. 5 GWB 2005, auch auf Schadensersatzansprüche Anwendung findet, die ihre Grundlage in Kartellverstößen haben, die vor dem Inkrafttreten der Norm am 1.7.2005 begangen wurden, und zu diesem Zeitpunkt noch nicht verjährt waren, vgl. BGH, 12.6.2018 – KZR 56/16, ECLI:DE:BGH:2018:120618UKZR56.16.0, NJW 2018, 2479, 2483 – Grauzementkartell II. Umstritten ist indes weiterhin die Auslegung des in § 33 Abs. 5 Satz 1 GWB 2005 verankerten Begriffs der Verfahrenseinleitung, hierzu Makatsch/Mir, in: MüKo-Wettbewerbsrecht, GWB § 33h Rn. 93ff. 73 Zu möglichen Kosten einer Anspruchsgeltendmachung aus § 33g GWB siehe Mallmann/Lübbig, NZKart 2016, 518, 520. 74 § 33h Abs. 6 GWB verweist auf die allg. Regeln.
IV. Strategie zur Anspruchsdurchsetzung
22
Die Festlegung einer auf den Einzelfall abgestimmten Strategie ist bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen Kartellbeteiligte von erheblicher Bedeutung.
1. Vergleichsverhandlungen als Alternative zum Prozess
23
Die gerichtliche Geltendmachung von Kartellschadensersatz gestaltet sich oft als langwierig, komplex und kostenintensiv.75 Gründe hierfür sind meist komplexe juristische und vor allem ökonomische Fragen der Schadensquantifizierung und eine oft schwierige Beweislage für den Kläger. Gerade in Deutschland stellen Umfang und Komplexität entsprechender Verfahren die zunächst zuständigen Landgerichte vor große Herausforderungen.76 Als Mittel der Wahl haben sich daher Vergleichsverhandlungen erwiesen.77 Ein Vergleich sollte nicht als Eingeständnis von Schwäche, sondern Investition in künftige Geschäftsbeziehungen gesehen werden. Gerade in Kartellschadensersatzverfahren sollte ein Interesse daran bestehen, eine längerfristige Geschäftspartnerschaft nicht wegen eines Streits über eine einmalige Schadensersatzzahlung zu gefährden. Ein frühzeitiger Vergleichsabschluss hat neben der Reduzierung von Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten die Vorteile, dass die Geschäftsbeziehungen rasch wieder normalisiert werden,78 die Zinsen und die bilanziellen Risiken reduziert werden und das Verfahren von den Parteien besser kontrolliert werden kann. Vergleiche dienen auch der Informationsbeschaffung, um gegen die übrigen Kartellbeteiligten vorzugehen und wiederum deren Vergleichsbereitschaft zu erhöhen.79
24
Der Abschluss eines Vergleichs hängt häufig auch vom Einvernehmen über den Kernpunkt des Kartellschadensersatzes, die Schadensberechnung, ab. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass auch ein Richter oder ökonomische Gutachten oft nicht zu einem eindeutigen und sachgerechten Ergebnis kommen. Da bei der Berechnung des Kartellschadens immer Unsicherheiten bestehen, sollten die Parteien versuchen zu einer beide Seiten zufriedenstellenden Lösung zu gelangen. Gegebenenfalls können hierbei Mediations- oder Schiedsgerichtsverfahren helfen. Regelmäßig stand dem Abschluss eines Vergleichs entgegen, dass Kartellbeteiligte mit dem Vergleichsabschluss eine spätere Inanspruchnahme durch Mitkartellanten ausschließen wollen.80 Gemäß § 33f Abs. 1 Satz 1 und 2 GWB wird eine solche Regressmöglichkeit grundsätzlich gesetzlich ausgeschlossen.81 Geschädigte können auch weiterhin durch die Ausgestaltung des Vergleichs Einfluss auf den Innenregress nehmen.82 Grundsätzlich sollte möglichst frühzeitig in Vergleichsverhandlungen eingetreten werden. Die Lösung ist in diesem Stadium noch nicht mit Verfahrenskosten überfrachtet, gleiches gilt für Zinslasten. Ohne die behördliche Feststellung des Rechtsverstoßes werden sich Kartellbeteiligte jedoch nur selten auf Vergleichsgespräche einlassen. Für den Geschädigten kann es sich lohnen, finanzielle Anreize für den ersten Vergleichsabschluss anzubieten, der immer auch eine Signalwirkung gegenüber den anderen Kartellbeteiligten hat. Letztendlich zeigt sich aber bereits jetzt, dass die 9. GWB-Novelle nicht zu einer Auflösung des Spannungsverhältnisses zwischen öffentlicher und privater Kartellrechtsdurchsetzung führen wird und es weiterer Anreize zur Förderung von Vergleichen bedarf. Der Gesetzgeber geht mit der 10. GWB-Novelle zumindest einen Schritt in die richtige Richtung. Im neuen § 81d Abs. 1 Nr. 5 GWB wurde explizit der Hinweis aufgenommen, dass sich das Bemühen um Schadensausgleich bußgeldmindernd auswirken kann.83 Z.B. in Österreich, Slowenien, Portugal und Schweden gibt es bereits ähnliche Regelungen. Die schweizer WEKO hat in ihrer Verfügung vom 19.8.2019 betreffend Bauleistungen in Graubünden 50 % der geleisteten Schadensersatzzahlungen vom Bußgeldbetrag abgezogen.84 Sie begründet dies wie folgt: „Werden Geschädigte vor der Sanktionsentscheidung entschädigt, so wird hierdurch der Gewinn des Kartellanten geschmälert, womit im Hinblick auf den Zweck der Gewinnabschöpfung eine Reduktion [...] tatangemessen erscheinen kann. Die Möglichkeit der Sanktionsreduktion infolge Kompensationsleistungen stellt einen wichtigen Anreiz dar, Kartellopfer zu entschädigen. Es trägt dazu bei, die (mutmaßliche) Kartellrente oder Teile davon den Kartellopfern zukommen zu lassen.“85 Allerdings wird die neue Regelung insofern nur solche Schadensersatzzahlungen erfassen können, die vor dem Abschluss des Bußgeldverfahrens geleistet worden sind. Vergleiche vor Abschluss des Bußgeldverfahrens sind jedoch erfahrungsgemäß sehr selten. Es liegt daher am Gesetzgeber eine Regelung zu schaffen die Schadensersatzzahlungen tatsächlich vor der Verhängung von Bußgeldern ermöglicht.86 Denkbar wäre hier das Bußgeldverfahren fakultativ zweistufig auszugestalten.87 Auf Wunsch der Kartellbeteiligten könnte das Bundeskartellamt in einem Zwischenbescheid den Kartellrechtsverstoß dem Grunde nach feststellen. Nach einem Übergangszeitraum zur Förderung der einvernehmlichen Streitbeilegung mit den Kartellgeschädigten könnte das Bundeskartellamt dann gegenüber den Kartellbeteiligten mit einem zweiten Bescheid das Bußgeld festsetzen, wobei sich privatrechtlich abgeschlossene Vergleiche bußgeldmildernd auswirken müssten.