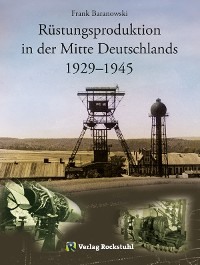Kitabı oku: «Rüstungsproduktion in der Mitte Deutschlands 1929 – 1945», sayfa 14
Als besonderer Fall der Perversion eines traditionellen mittelständischen Technologie-Unternehmens zum Dienstleister der SS und Krematoriumseinrichter von Auschwitz ist die Firma Topf & Söhne zu nennen. Der 1878 gegründete Erbauer industrieller Feuerungsanlagen nahm auf dem Gebiet der Brauerei- und Mälzereianlagen weltweit bis in die 1940er Jahre eine Spitzenstellung ein. Seit Verbreitung der Feuerbestattung hatte Topf & Söhne aber auch Krematoriumsöfen im Angebot, ein Randgeschäft, und verbesserte die Einäscherungstechnik laufend. Ohne Not und ohne Druck suchte die Firma seit 1941 die Zusammenarbeit mit der SS, bemühte sich um Staatsaufträge, entwickelte große, leistungsfähige Verbrennungsöfen in Serienfertigung, Entlüftungsanlagen für die Gaskammern und lieferte gasdichte Türen und Fenster für die meisten Konzentrationslager. Als besonderen Service hatte sie Ingenieure und Techniker vor Ort, die nicht nur Einblick in die Massentötungen hatten und wie selbstverständlich von „Vergasungskellern“ redeten, sondern auch Verbesserungsvorschläge für die Tötungsmechanik und Mehrfachverbrennungen machten. Eine Art „Verbrennungsfließband“ meldete die Firma 1942 zum Patent an. Es würde den Rahmen dieser Arbeit, aber auch die Vorstellungskraft sprengen, wollte man die willige Mittäterschaft von Topf & Söhne bei der Massenvernichtung mehrerer Millionen von Menschen, die Mobilisierung aller technischen Phantasie und das Angebot einer Vor-Ort-Betreuung bei der Massentötung angemessen darstellen wollen.45
Erfurter Betriebe hatten somit auf die vielfältigste Weise Anteil an der NS-Maschinerie von Krieg und Vernichtung. Die Expansion zum „totalen Krieg“ und der Übergang zur „Endlösung“ sicherte ihnen gute Geschäfte und einen beachtlichen Konjunkturaufschwung. Andere Städte und Kreise im Regierungsbezirk Erfurt hielten mit dieser Entwicklung lange nicht Schritt.
Steuerungsversuche der Thüringer Landesplanung
Seit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert verloren die rohstoffbezogenen thüringer Erwerbszweige an Boden, insbesondere die an Bergbau oder Wasserkraft gebundene metallverarbeitende Industrie und Betriebe der Glas- sowie Porzellanherstellung, da ihre Produktion wegen fehlender neuer Energiequellen (Steinkohle) sowie seit 1860 zunehmend versiegender Rohstoffvorkommen (Eisenerz) an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt hatten. Verstärkt wurden diese Standortnachteile durch die abseitige Verkehrslage zu den Steinkohlenlagerstätten, den Exporthäfen sowie dem neu ausgebauten Eisenbahnnetz.1 Die Industrie bevorzugte wenige, für sie vorteilhafte städtische Standorte in der Nähe der Rohstoffvorkommen oder in verkehrsgünstiger Lage und zog Arbeitskräfte aufgrund des natürlichen Bevölkerungswachstums und des dadurch hervorgerufenen Bevölkerungsdrucks in den ländlich geprägten Räumen an. Zu den Abwanderungsgebieten zählten vor allem der Thüringer Wald und das Thüringer Schiefergebirge, während Städte wie Jena,2 Erfurt, Ilmenau,3 Eisenach oder Gera enorme Bevölkerungszunahmen verzeichneten.4 Zu den Strukturproblemen traten Mitte der 1920er Jahren die Folgen der Weltwirtschaftskrise, die in Thüringen vor allem die Leicht-, Konsum- und Exportgüterindustrien und damit namentlich die dicht industrialisierten ost- und südthüringischen Industriegebiete beeinträchtigte. Insbesondere wurden die exportintensiven Spielwaren-, Glas- und Porzellanbranchen, ab 1932 auch die Textilindustrie von der Krise und der Massenarbeitslosigkeit erfasst. Dies alles ließ die Region zu einem ausgesprochenen Krisengebiet werden. Nur die Metallindustrie konnte sich mit Kurzarbeit und Lohnabbau einigermaßen über Wasser halten. Diese Strukturprobleme nutzen außerthüringische Großunternehmen, um in der Region durch Aufkauf oder Kapitalbeteiligung Fuß zu fassen oder ihre Position auszubauen.5
Charakteristisch für diesen Trend waren die Expansion der Kali- und Elektrokonzerne im thüringischen Raum, der Erwerb der ehemals staatseigenen Erfurter Gewehrfabrik durch AEG (1923/30), die Gründung der Rheinmetall Sömmerda AG (1924), der Erwerb des Eisenacher Dixi-Werkes durch BMW (1928) und der Maxhütte Unterwellenborn durch Flick (1931) sowie der Übergang der Mercedes-Büromaschinenwerke Zella-Mehlis in amerikanischen Besitz. Nur einigen wenigen einheimischen Unternehmen gelang es, dem Wirtschaftsdruck standzuhalten. Vor allem Zeiss stärkte mit Gründung einer Interessengemeinschaft der Optischen Industrie (1925), der Zeiss-Ikon AG (1926) und der Übernahme der Optischen Werke Rathenow (1928) seine marktbeherrschende Position. Internationale Verbindungen und anhaltende Militärgeschäfte sicherten die Marktbeherrschung weiter ab.6 Wie Simson in Suhl, Thiel in Ruhla, Rheinmetall in Sömmerda und Dixi/BMW in Eisenach schloss auch Zeiss 1925 entsprechende Mantelverträge mit der Reichswehr.7 Im Gegensatz zu diesen Unternehmen, die ihren Produktionsapparat in den 1920er Jahren modernisierten und ihren Besitzstand trotz Kriseneinbußen halten konnten, hatte sich die Wirtschaftslage großer Teile der einheimischen Industrie im Vergleich zur Vorkriegszeit drastisch verschlechtert.8
Nachdem Fritz Sauckel am 5. Mai 1933 zum Reichstatthalter für das Land Thüringen ernannt worden war und am 8. Mai die Landesregierung unter Leitung Marschlers berufen hatte, nahmen Gleichschaltung, Staats- und Parteieingriffe zunehmend konsolidierende, wirtschaftspolitisch gestaltende Tendenzen an.9 Sauckel gelang es, in Personalunion als Gauleiter, Reichstatthalter und Reichsverteidigungskommissar (ab 1939 für den Wehrkreis IX, ab 1942 für den Gau Thüringen) den Nachteil anfangs auseinanderfallender Verwaltungsstrukturen in einen Vorteil regionaler Machtpolitik umzumünzen. Er gehörte zu den Gauleitern, die in der NS-Polykratie und ihrem Spannungsfeld von Reichszentralismus und Gaupartikularismus einen besonders hohen regionalen Machtgrad und Aktionsradius mit erheblichen rüstungs- und kriegswirtschaftlichen Einfluss erreichte. Wie nur wenige Gauleiter verstand er, sich durch eigene wirtschaftliche Verfügungsgewalt, Ausschalten von Konkurrenten, gezielte Personal- und Strukturpolitik, geschickte Kombination zentraler Vorgaben mit seinen Regionalplänen und entsprechenden Rückhalt bei den Reichsstellen gegen konkurrierende Behörden und Amtsträger durchzusetzen.10
Dazu gehörte der Versuch, sich eine rüstungswirtschaftliche Hausmacht aufzubauen. Das dafür geeignete Objekt fand er in der „jüdischen“ Firma Simson,11 gegen die er 1933 mit Rückendeckung durch Berliner Reichs- und Heeresstellen ein Untersuchungsverfahren wegen angeblicher Übervorteilung des Reiches zwecks baldiger „Arisierung“ und Umwandlung in ein von ihm kontrolliertes Stiftungsunternehmen, die Gustloff-Werke, einleitete.12 Ähnliche Zielstrebigkeit legte Sauckel, der ein enges Verhältnis zu Himmler pflegte, im Zusammenwirken mit der SS an den Tag, als es 1936/37 darum ging, eines der geplanten Massen-Konzentrationslager nicht zuletzt wegen der damit verbundenen wirtschaftlichen Vorteile in Thüringen einzurichten oder während des Krieges das Arbeitskräftepotential des KZs für die Rüstungsproduktion, insbesondere die Gustloff-Werke, zu nutzen.13
Mit dem strukturell und personell eng verknüpften Gaustellengefüge gewannen industrielle Regional- und koordinierende Raumpolitik im Rahmen des Vierjahresplanes kräftig an Konturen. Am 3. Dezember 1936 beauftragte Göring die Gauleiter und Reichstatthalter mit dessen Durchführung auf Gau-, Landes- und Provinzebene. Dies bot Sauckel Gelegenheit, seine wirtschaftkontrollierenden Kompetenzen weiter auszudehnen. Am 7. Januar 1937 legte er einen von Göring genehmigten Plan zur „Durchführung des Vierjahresplanes im Gau Thüringen“ vor.14 Die aus dieser Breitenrüstung resultierenden Disproportionen und Konflikte schufen erheblichen regional- und strukturpolitischen Handlungsbedarf. Ins Zentrum rückten rohstoff- und ernährungssichernde, export- und industriefördernde Maßnahmen, die durch Mittel-, Auftrags-, Investitions-, Rohstoff und Arbeitskräftelenkung, Raumplanung, Industrieansiedlung, Wohnungs- und Verkehrsausbau den Rüstungssektor erweiterten.15 Die Produktionskapazitäten der thüringischen Wirtschaft wurden im Laufe des Vierjahresplanes, wenn auch in unterschiedlicher Intensität, enorm ausgebaut und auf die militärische Auseinandersetzung vorbereitet. Zudem orientierten sich viele Unternehmen auf ‚Erzeugnisse der Landesverteidigung‘ um.
Spätestens mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erfolgte eine forcierte Umstellung der Betriebe auf Rüstungsproduktion. Dies geschah zum einen durch volle Ausnutzung vorhandener Kapazitäten, teils im Mehrschichtbetrieb, zum anderen kam es an den größeren Rüstungsindustriestandorten, wie in den Räumen Suhl/Zella-Mehlis, Jena, Sömmerda, Eisenach, Gotha, Weimar, Saalfeld/Rudolstadt/Bad Blankenburg sowie in Altenburg und Erfurt zu baulichen Erweiterungen. Beispielhaft ist die Vergrößerung der Gustloff-Werke in Suhl und vor allem in Weimar. Häftlinge errichteten seit Juli 1942 unweit des KZ Buchenwald 13 große Werkhallen. Dieses Werk II der Gustloff-Werke war die größte neue Rüstungsfabrik in Thüringen und produzierte seit März 1943 in erster Linie Karabiner und Maschinenpistolen. Erheblich ausgedehnt wurde auch die Herstellung von Panzerfäusten und Patronenhülsen bei der HA-SAG in Altenburg.16 Mit dem Anwachsen der Rüstungsproduktion und dem Aufbau neuer Rüstungskapazitäten verstärkte sich die Notwendigkeit, zivile Produktionskapazitäten einzuschränken oder still zu legen. Je mehr „die früher stark notleidende thüringische Industrie mit umfangreichen Wehrmachtsaufträgen belegt“ wurde, desto knapper wurden Rohstoffe und Arbeitskräfte; dem versuchte man in der Vorkriegszeit durch einschränkende Maßnahmen „von der Rohstoffseite“ und nach Kriegsbeginn „von der Arbeitseinsatzseite“ Herr zu werden.17
Im Gegensatz zum übrigen mitteldeutschen Raum und zu den auf ‚grüner Wiese‘ errichteten Großstandorten Schkopau, Salzgitter und Wolfsburg förderten in Thüringen gerade industrielle Dichte, Standortfülle, fehlende Ballungsräume und entsprechende Dezentralisierungsmöglichkeiten die Ansiedlung und den Ausbau bzw. in den Kriegsjahren die Verlagerung von Rüstungsindustrie aus luftangriffsgefährdeten Gebieten. In der Vorkriegszeit boten längere Zeit brachliegende Produktionskapazitäten und Arbeitskräftepotentiale günstige Bedingungen. So sehr sich die Gesamtansiedlung von strategischen, verkehrs- und raumpolitischen Erwägungen leiten ließ, so richtete sich die Ansiedlung der 1930er Jahre eher nach dem verfügbaren Arbeitskräftepotential. Zwar wurden in den ausbau- und ansiedlungsintensiven Gebieten Thüringens schon vor Kriegsbeginn die Arbeitskräfte knapp, doch standen den ‚Engpass-Zonen‘ auf dem relativ engem Raum dieser kleinen Wirtschaftsregion bis 1938 noch genügend Gebiete mit hoher Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit gegenüber.
Erst 1938/39 waren die gauinternen Ausgleichsmöglichkeiten erschöpft, und der Trend einer dem verfügbaren Arbeitskräftepotential folgenden Industrieansiedlung kehrte sich um. Fortan wurden Arbeitskräfte gezielt in die Rüstungszentren gelenkt. Thüringen geriet zu einer Industrieverlagerungs-, Evakuierungs-, Häftlings- und Zwangsarbeiterzone erster Ordnung. Das begann mit der Zwangsevakuierung der Saarbevölkerung 1939 und endete mit den Evakuierten und Flüchtlingsströmen der Jahre 1944/45. Dieser Ausbau-, Verlagerungs- und Evakuierungsprozess und die nunmehr massive Arbeitskräftepolitik verschärften die divergierenden Entwicklungstendenzen, Disproportionen und Konflikte, ohne dem industriellen Strukturwandel Thüringen eine völlig neue Gestalt und Richtung zu geben. Dieser hatte sich bereits weitestgehend in den Vorkriegsjahren vollzogen. Die Kriegswirtschaft wirkte eher vertiefend.18
Die Disproportionen zwischen den rüstungsintensiven Zuwachs- und Zuwanderungsgebieten und den brachliegenden strukturschwachen Gebieten versuchte Sauckel durch Raumordnungspläne, Arbeitseinsatzlenkung, sowie Sperr- und Ansiedlungszonen in den Griff zu bekommen. Als Instrumentarium dienten die zwischen 1927 und 1933 entstandenen Landesplanungsstellen Gera, Weimar, Erfurt und Eisenach, die sich am 6. Juli 1936 auf Anordnung der 1935 gebildeten Reichsstelle für Raumordnung zur Landesplanungsgemeinschaft Thüringen unter Vorsitz von Sauckel vereinigt hatten. Der erste unter ‚wehrwirtschaftlichen Gesichtspunkten‘ aufzustellende „Raumordnungsplan Thüringen“ entstand im Oktober 1937, ein zweiter, präzisierter im September 1942.19 Allerdings handelte es sich mehr um Pläne für die Zukunft, die sich nur sehr punktuell und eher unsystematisch umsetzen ließen.20 Der rüstungsbedingte Kapazitätsausbau konzentrierte sich zumeist auf autobahnnahe Standorte im ost- und mittelthüringischen Raum mit den Städten Altenburg, Gera, Jena, Weimar, Erfurt, Arnstadt, Eisenach, Ruhla und Gotha, auf Sömmerda, Mühlhausen und Nordhausen im nordwestthüringischen sowie auf die Gebiete um Saalfeld/Rudolstadt und Suhl/Zella-Mehlis und südthüringischen Raum. Diesen seit 1937/38 überbesetzten und deshalb zu Sperrgebieten erklärten Ausbau-, Ansiedlungs- und Zuwanderungszonen standen leichtindustrielle Zentren mit hoher Ab- und Pendelwanderung von Arbeitskräften sowie nach wie vor industriearme Regionen (Eichsfeld, Rhön, Teile des Thüringer Waldes, Schleizer Oberland) gegenüber.21
Aus Sicht der Landesplanung – nicht aber der Industrie – galten sie vor und während des Krieges als bevorzugte Ansiedlungszonen für Rüstungsbetriebe, für die man gesonderte Raum- und Strukturentwicklungspläne aufstellte.22 Vor allem das Eichsfeld, das zwischen 1933 und 1939 annähernd 7.000 seiner Einwohner an andere Regionen verloren hatte, trat als Planungszone mit entsprechenden, in der Nachkriegszeit wieder aufgegriffenen Entwicklungsplänen hervor.23 Im Mai 1942 legte die Erfurter Außenstelle der Landesplanungsgemeineschaft Thüringen für den nordwestthüringischen Raum als Teil der landesweiten Planung eine ‚Gewerbelenkungskarte‘ vor, die neben dem „Aufbauraum“ Eichsfeld als „Ausbauräume“ die Städte Langensalza und Bad Tennstedt vorsah, die bisher schon durch Kriegsaufträge gestärkten Städte Mühlhausen und Nordhausen, den Ort Ellrich und das Gebiet um Wolkramshausen als „Umbauräume“ betrachtete. Das industriereiche Erfurt wurde noch als „Ergänzungsraum“ gewichtet, während der Ballungsraum um Sömmerda unter die Kategorie „Sperrraum“ fiel; schließlich war dort mit dem größten Rüstungsbetrieb des Landes, Rheinmetall-Borsig AG (in Spitzenzeiten 14.000 Beschäftigte) und der Firma Selkado (1.600 Arbeitskräfte) eine Sättigungsgrenze erreicht.24
Das Eichsfeld galt als anerkanntes Notstandsgebiet und stand in der Konzeption als absoluter „Aufbauraum“ an vorderster Stelle. Wegen fehlender Erwerbsmöglichkeiten war ein großer Teil der Bevölkerung zur Abwanderung oder zu auswärtiger Saisonarbeit gezwungen. Im gewerblichen Bereich fanden in erster Linie Frauen Arbeit, meist in der Strick- oder Zigarrenindustrie. Zur Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur sah die Gewerbelenkungskarte der Landesregierung vom Mai 1942 vor, in Heiligenstadt, Leinefelde, Dingelstedt, Küllstedt und Ershausen sowie dem südlich angrenzenden Treffurt mehrere kleinere bis mittlere Unternehmen anzusiedeln. Die Arbeiterschaft sollte aus den umliegenden Ortschaften gestellt, der Zuzug auswärtigen Personals dagegen unterbunden werden, da „das Gebiet […] nicht etwa menschenarm“ sei. Vielmehr stünde die Beschäftigung der bereits ansässigen Bevölkerung im Vordergrund.25 Somit war das Eichsfeld für Rüstungsverlagerungen in der Endphase des NS-Regimes geradezu prädestiniert. Entsprechend weist 1943 eine Kartenbeilage des „Eichsfeld-Planes“ das Arbeitskräfte-Reservoir um die nordwestlichen Städte Thüringens aus.
Doch die Intensivierung des Luftkriegs, die Aufnahme von Flächenbombardements zunächst durch die Royal Air Force, seit Anfang 1943 auch durch die Amerikaner auf die Industriezenten, größeren Städte und Verkehrswege Deutschlands erhöhte den Evakuierungsdruck auf Thüringen und konterkarierten weitgehend Steuerungsversuche. Zudem unterminierte das bekannte Kompetenzgewirr konkurrierender und einander überlagernder Instanzen von Staat, Partei und Wehrmacht weitgehend Strukturierungsversuche. So gelang es Sauckel ab 1943 nicht mehr, die über die verschiedenen Dienststellen laufenden Vorstöße bombengefährdeter Betriebe zur Umsiedlung nach Thüringen seiner Kontrolle zu unterziehen.26 „In der Geschäftsverlagerung bombenbeschädigter Betriebe nach hier sind allmählich Verhältnisse eingerissen, die jede Übersicht unmöglich machen. Tagtäglich erfährt man von neuen Betrieben, die hier zugezogen sind. Auch die Außenstelle der Gauwirtschaftskammer ist nicht über alles unterrichtet und erfährt das meiste, genauso wie ich, nur durch Zufall. […] Es ist vielmehr auch das, dass die Betriebe dann meistenteils ihre Gefolgschaftsmitglieder nach sich ziehen und in dem Bewusstsein, einen Fabrikationsraum bekommen zu haben, sich nicht darum kümmern, wo dann die Gefolgschaftsmitglieder unterkommen sollen“.27
Hinzu kam, dass Zivilbevölkerung aus den Zentren des Reiches nach Thüringen umquartiert wurde, Bombengeschädigte dorthin evakuiert, ganze Heime, Schulen, Krankenhäuser und Lazarette verlegt wurden;28 inmitten all dessen suchten „kriegswichtige“ Betriebe unter Zeitdruck Orte, Gebäude und Räume für ihre Verlagerung. Offiziell war Thüringen zum „Aufnahmegau“ für Luftkriegsbetroffene, aber auch zum „Bergegau“ für Industrieanlagen ausgewiesen. Für Firmen der Kriegsproduktion stand der Zeitfaktor an vorderster Stelle. Für sie ging es darum, die noch vorhandenen Produktionsmittel schnellstmöglich vor möglichen Luftangriffen zu schützen, ohne auf die langwierige Fertigstellung von Ausweichunterkünften warten zu müssen. Daher suchten sie eigenmächtig nach Verlagerungsmöglichkeit, wandten sich an lokale Behörden, drängten in vorhandene Gebäude und nahmen überörtliche Instanzen in Anspruch, wenn es galt, die bisherigen Nutzer von Fabriken, Werkstätten, Lagerräumen – meist der Textilindustrie – daraus zu verdrängen. So richtete sich der Druck auf die bisher schon industrialisierten Teile Thüringens, nicht auf den von der Landesregierung ausgewiesenen „Aufbauraum Eichsfeld“ in der nordwestlichen Ecke des Landes. Das absehbar herannahende Kriegsende gebot Eile, verbot Neubaumaßnahmen im unterentwickelten Winkel des Landes, und die erforderlichen Baumaterialien waren auch nur beschränkt verfügbar. Von daher blieb das Eichsfeld trotz landesplanerischer Vorrangstellung selbst in der NS-Phase von Verlagerungstendenzen, die ansonsten den gesamten nordwestthüringischen Raum erfasst hatten, verschont.
Die Entwicklung in Südhannover-Braunschweig ab Sommer 1943
Die Neugründung der Reichswerke Hermann-Göring, des Volkswagenwerkes sowie der Niedersächsischen Motorenwerke, aber auch die großzügige Vergabe von Rüstungsaufträgen an alteingesessene Unternehmen wie den LKW-Hersteller Büssing und andere hatte im Land Braunschweig zu einer solchen Industriedichte geführt, dass im Falle von Flächenbombardements der Alliierten die Gefahr von Totalverlusten entstanden war. Schon im April 1941 hatte das Rüstungskommando Braunschweig die Firmen seines Bereichs aufgefordert, einen Teil ihrer Produktion ins Ausland zu verlagern. Zu dem Zeitpunkt dürfte allerdings hinter dieser Anweisung die Absicht gestanden haben, die personellen und materiellen Ressourcen in den deutsch besetzten Gebieten zu nutzen und die der Heimat zu entlasten. Auf Geheiß staatlicher Stellen hatten im Mai 1941 sechs Unternehmen eine Verlagerung durchgeführt, sieben weitere Verhandlungen aufgenommen.1 So hatten die Büssing-Werke einen Teil ihrer Aufträge nach Frankreich und Belgien vergeben, und die Braunschweiger Firma Karges-Hammer, die für andere Rüstungsbetriebe Vorrichtungen und Werkzeuge zur Produktion von 5-cm-Kampfwagenkanonen herstellte, nahm im Jahr 1941 ein eigenes Werk in Belgien in Betrieb. Das MIAG-Marinewerk vergab einen Teil seiner Produktion von 3,7-cm-Geschützen an die Pariser Firma Précision moderne. Auch die zu den Brunsviga-Maschinenwerken gehörenden Viga-Werke ließen Rüstungsaufträge in Dänemark abwickeln.2
Bis August 1941 belief sich der Wert der von den Rüstungsfirmen im Bereich des Rüstungskommandos Braunschweig durchgeführten Auftragsverlagerungen ins besetzte Ausland auf fünf Millionen RM.3 Wegen des logistischen Aufwandes, der Zersplitterung der Produktion und langer Transportwege sowie der damit verbundenen Kosten waren diesen Industrieverlagerungen jedoch Grenzen gesetzt. Bereits im November 1940 hatte das Rüstungskommando festgestellt, dass die angestrebte Ausgliederung ziviler Produktionsbereiche der Firmen VES, MIAG, Willke-Werke und der Pantherwerke nicht in Betracht komme, da die Materialmenge einerseits erhebliche Frachtkosten verursache, sich andererseits eine nennenswerte Entlastung der Arbeitseinsatzlage nicht einstellen würde.4
Die ersten alliierten Bombenangriffe trafen Braunschweig vergleichsweise spät. Weder die Industrie noch die militärischen Instanzen hatten trotz der Ballung von Kriegsindustrie in der Stadt die Notwendigkeit gesehen, für den Ernstfall Vorsorge zu treffen. Erstmals im dritten Quartal 1943 wies das Rüstungskommando Braunschweig durch Luftangriffe entstandene Schäden an Produktionsanlagen aus. In der Nacht vom 27. zum 28. September 1943 wurde die weltberühmte Pianofortefabrik Grotrian-Steinweg, inzwischen Flugzeugwerk, von Bomben getroffen; die Produktion von Flugzeugteilen der Me 110 und der Ju 88 kam dadurch teilweise zum Erliegen.5 Dies war nur der Anfang. Totalschäden gab es am 8. April 1944 in den Luther-Werken und Karges-Hammer.6 Mittlere Schäden erlitten die Willke-Werke, das MIAG-Ammewerk und das -Marinewerk, Voigtländer & Sohn, die Stahlwerke Braunschweig in Watenstedt und das Kleineisenwerk Helmstedt.7 Infolge des Luftangriffs vom 19. Mai 1944 mussten in 23 Braunschweiger Betrieben 350.000 Arbeitsstunden für Aufräumungsarbeiten statt für die Produktion verwandt werden.8
Im dritten Quartal 1944 erlebte Braunschweig eine Welle von sechs weiteren feindlichen Bombenangriffen, bevor der Hauptangriff am 14./15. Oktober 1944 die Innenstadt nahezu komplett in Schutt und Asche legte. Wesentliche Teile der Wohn- und Industriegebiete sowie der Außenstadt wurden schwer beschädigt.9 Schon ab Mitte 1943 hatten Braunschweiger Industriebetriebe in Voraussicht der Gefahr für ihre Produktionsmittel gedrängt, ihre in den Jahren zuvor auf engstem Raum im Stadtgebebiet errichteten Rüstungsschmieden auszulagern. Eigenaktionismus setzte ein, ein völlig unkoordinierter Wettbewerb um Standorte in Kleinstädten und auf dem Lande griff um sich. Zumeist geschah das ohne Absprache mit dem Rüstungskommando, das oftmals erst im fortgeschrittenen Stadium Kenntnis von den eingeleiteten Umsetzungsmaßnahmen einzelner Betriebsteile oder gar deren Vollzug erhielt. Bevorzugte Ausweichziele waren die abseits gelegenen Harzorte und die Kleinstädte Helmstedt, Schöppenstedt, Schöningen und Königslutter.10 Aber diese hatten zusätzlich Betriebe aus anderen Reichsteilen aufzunehmen, und das Rüstungskommando Braunschweig stellte schon Ende Dezember 1943 fest, dass „die Harzorte […] schon jetzt als mit Ausweichbetrieben überlastet angesehen werden“ könnten.11
So ließen sich die durch den Luftangriff vom April 1944 zerstörten Braunschweiger Luther-Werke mit Zweigbetrieben in Bad Münder, Springe und Bennigsen nieder. Noch in der zweiten Jahreshälfte 1944 betrieb der Flugzeugproduzent12 den Aufbau eines weiteren Standortes unter dem Namen Helmstedter Maschinenbau AG in einer ehemaligen Glashütte in Helmstedt. Dort sollten etwa 50 % der mechanischen Abteilung der Luther-Werke unterkommen. Weiterhin beabsichtigte das Unternehmen eine unterirdische Fortführung seiner Produktion in den stillgelegten Grubenbauen des Staßfurter Kaliwerkes, doch mehr als Ausbaumaßnahmen dürften bis Kriegsende nicht mehr zustande gekommen sein.13 Nach dem Bombenangriff vom April 1944 unternahm die Firma Karges-Hammer den Wiederaufbau ihres Werkes in der Gegend von Gifhorn. Das MIAG-Marinewerk verlagerte Teile seiner Geschützproduktion (Kaliber 3,7-cm) nach Brünn (Waffenwerke Rakonitz), Münchenbernsdorf bei Gera und Schladen im Harzvorland.14 Erst im Spätsommer 1944 waren die Stahlwerke Braunschweig daran gegangen, Teilbereiche ihrer Munitionsherstellung in einen Verbindungsstollen zwischen den Schächten Haverlahwiese I und Gustedt unter die Erde zu verlagern. Bis Kriegsende standen dort 160 – 180 Werkzeugmaschinen, Drehbänke und Motoren, allerdings scheint es zu keiner wesentlichen Produktionsaufnahme mehr gekommen zu sein.15

Die Braunschweiger Luther-Werke in Schutt und Asche (NARA)
Auch Büssing hatte bis Mitte 1944 wesentliche Betriebsabteilungen seiner LKW-Produktion ausgelagert. Schon ab Mai 1944 verteilte sich das Unternehmen auf 17 dezentrale Produktionsstätten von Königsberg, Elbing bis nach Berlin-Oberschönweide und Leipzig. Um sich daraus ergebende zeitaufwendige Transporte zu vermeiden, hatte die Konzernleitung an 51 weiteren Standorten Material- und Zwischenlager eingerichtet und so frühzeitig vor der Bombardierung und nahezu vollständigen Zerstörung des Braunschweiger Stammwerkes am 22. August 1944 Vorsorge getroffen.16
Ebenso hatten Büssing und die zum Konzern gehörenden Niedersächsischen Motorenwerke GmbH (Niemo) unter Aufgabe ihrer bisherigen Betriebsstruktur mit der dezentralen Verlagerung ihrer Flugzeugmotorenproduktion begonnen. Die Weichen dafür wurden auf einer von Reichsamtsleiter Saur geleiteten Sitzung des „Jägerstabes“ am 15. März 1944 in den Luther-Werken gestellt sowie konkrete Vorschläge vereinbart.17 Ende des Jahres arbeiteten die Niemo-Werke an 15 Verlagerungsstandorten. Diese ‚Ausweichbetriebe‘ befanden sich in einem Radius von 35 bis 300 km um das Braunschweiger Stammwerk. Weiter entfernt war nur der Betrieb in Neupaka (Nová Paka) in der besetzten Tschechoslowakei. Andere Niemo-Betriebe befanden sich in Langelsheim auf dem Gelände der Firma Uhlig (170 Mitarbeiter) und der Sophienhütte, in Grasleben (420 Arbeitskräfte), in Wendhausen bei Braunschweig (80 Beschäftigte), in Lamspringe (150 Mitarbeiter) und in Alfeld (500 Arbeitskräfte). In Elze standen 1.350 und im Elzer Vorort Mehle weitere 160 Werksangehörige für Niemo an den Werkbänken.18 Weiter weg hatten die Niemo-Werke einen weiteren Produktionsstandort in Mönchengladbach, näher zu Braunschweig in Rhumspringe am Harz, vermutlich in den Gebäuden der Papierfabrik, wo 50 Personen tätig waren. Sogar in der „Goslarhalle“, in der vor dem Krieg die „Reichsbauerntage“ stattfanden, waren auf 3.500 qm 570 Mitarbeiter mit der Herstellung von Einzelkomponenten beschäftigt. Ihren Reparaturbetrieb brachten die Niemo-Werke in Landsberg am Lech unter.19 Bis Kriegsende hatte der Braunschweiger Flugmotorenhersteller seinen Bestand an Spezialmaschinen zur Herstellung von Komponenten weitgehend ausgelagert. Am Stammsitz waren nur die personalintensive Montage und die Prüfstände verblieben, die mit etwa zwei Drittel der ursprünglichen Belegschaft betrieben wurden.20
Im März 1944 drängten die Niemo-Werke weitere wichtige Spezialmaschinen zum Schutz vor Bombenangriffen unter die Erde verlagern und dort betreiben zu können. Seit Umwidmung der aufgelassenen Thüringer Kalischächte gleich nach 1933 (Bernterode) zu Rüstungszwecken war diese Untertageverlagerung von Munitionsvorräten und Waffenproduktion gängige Praxis geworden. Anfang März 1944 besichtigten Vertreter des Wehrkreiskommandos die Kaliwerke Walbeck und Buchberg bei Grasleben (im westlichen Sachsen-Anhalt, unmittelbar an der Grenze zum niedersächsischen Kreis Helmstedt) zur Feststellung der Tauglichkeit für Rüstungsbetriebe. Im März 1944 befanden sich auf der 420-m-Sohle des Walbecker Schachts acht Kammern im Vortrieb, um sie im Sommer mit Kriegsgerät zu belegen.

Noch im Rohbau – das KZ-Lager Weferlingen (ceges-soma)

Provisorische Häftlingsunterkünfte unter Tage (Gedenkstätte Buchenwald)
Der „Jägerstab“ setzte sich durch und sagte seinem Flugmotoren-Produzenten auf der 360-m-Sohle 3.500 qm für die Teileherstellung durch 800 Mitarbeiter zu. Der „Jägerstab“ hegte die Vorstellung, in den Walbecker Schächten innerhalb kürzester Zeit 73.500 qm für Produktionszwecke herzurichten; von denen 25.000 qm an die Henschel-Werke oder einen seiner Zulieferer gehen sollten. Weitere 45.000 qm hatte der „Jägerstab“ sich für eine spätere Vergabe vorbehalten.21 Im Sommer 1944 begannen die Bauarbeiten, kamen zunächst wegen fehlender Arbeitskräfte aber nur schleppend voran. Bis Ende Juli 1944 war erst ein Produktionsraum auf der zweiten Sohle hergestellt.22 Häftlinge, die die Bauleitung Mitte August 1944 aus dem Konzentrationslager Buchenwald heran geordert hatte, sollten den Ausbau unter Tage forciert fortführen. Am 23. August traf ein erster Transport mit 500 KZ-Gefangenen in dem neu gegründeten Außenkommando „Weferlingen“ ein;23 bis zur Errichtung eines Barackenlagers waren sie in Zelten untergebracht, die die SS in der Nähe des Nachbarschachtes Buchberg aufstellen ließ.24
Um Wegzeiten zur Zwangsarbeit zu vermeiden, brachten die Bewacher einen Teil der Bauhäftlinge gleich im Stollen unter, das Tageslicht sahen sie nur selten. Sie schliefen auf zusammengezimmerten Lattenrosten, die keinen Schutz gegen Nässe boten. Als Auflage diente ein Strohsack.25 Unter den widrigsten Bedingungen verrichteten diese Unter-Tage-Häftlinge erzwungene Schwerstarbeit. Sie begradigten Strecken, brachen Gestein aus und gossen Betonsockel für Maschinen. Der hohe Stand der oft wöchentlichen Rücktransporte Kranker und damit Arbeitsunfähiger ins Stammlager zeigt, wie zermürbend und kräfteraubend Leben und Arbeit unter Tage gewesen sein müssen.26 Durch ständigen „Ersatz“ dieser entkräfteten und siechenden Arbeitskräfte durch neue Häftlinge aus Buchenwald blieb die Belegschaft des Außenkommandos „Gazelle“ selbst in der Spätphase ab Januar 1945 mit 440 bis 460 Personen nahezu konstant.27