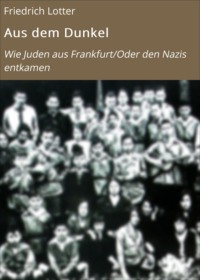Kitabı oku: «Aus dem Dunkel», sayfa 3
Die Kontrahenten. Ignaz Maybaum und Hermann Gerson
Alisa Jaffa, Memories of my Father, in Nicholas de Lange, Ignaz Maybaum – A Reader, New York/Oxford 2001.
Ignaz Maybaum wurde 1897 in Wien geboren, im gleichen Jahr, als in Basel der erste Zionistenkongress stattfand. Sein aus Ungarn stammender Vater betrieb eine Schneiderwerkstatt im 9. Distrikt. Dort besuchte Maybaum auch das Gymnasium. Moderne Fremdsprachen, wie Englisch, gehörten nicht zum Programm; eine Schulregel verpflichtete die Schüler, in den Pausen Griechisch zu sprechen. Nach dem Abitur meldete Maybaum sich zur Armee, wurde im 1. Weltkrieg Leutnant der Kavallerie und erhielt drei Tapferkeitsmedaillen, eine davon persönlich von Kaiser Franz Joseph. Eine Gelbsucht beförderte ihn ins Lazarett und rettete ihm das Leben, denn seine Kompanie wurde in der Zwischenzeit fast völlig aufgerieben. 
Nach seiner Entlassung 1919 entschloss er sich, Rabbiner zu werden. Das Erste, das er im Seminar in Wien zu sehen bekam, war das Schaubild einer Kuh mit Markierung der koscheren und nicht-koscheren Anteile. War das die Essenz des Rabbinertums? Maybaum hielt nichts von der in Österreich vorherrschenden traditionellen Orthodoxie. Jedenfalls verließ er bald Wien und ging nach Berlin an die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums.
In Berlin wohnte er bei seinem Onkel, Siegmund Maybaum, der selbst an der Hochschule Homiletik (Predigtlehre) unterrichtete. Der Onkel war als Prediger und Gelehrter angesehen und ein entschiedener Gegner des Zionismus. Im Haus des Onkels traf Maybaum seine spätere Frau, Frances Schor, damals ein 16-jähriges Schulmädchen. Er heiratete sie 1925, als er nach abgelegtem Examen seine erste Stelle in der Gemeinde von Bingen am Rhein antrat. Von hier aus wurde er 1928 nach Frankfurt/Oder berufen.
Die Machtergreifung Hitlers bedeutete einen tiefen Einschnitt. Bei einer Konferenz von jüdischen Honoratioren Ende 1935 wurden Bemerkungen Maybaums über Hitler von einem der Teilnehmer weitergegeben. Die Gestapo verhaftete ihn prompt wegen staatsschädigender Äußerungen und hielt ihn sechs Wochen im Berliner Columbia-Haus fest. Einmal wurde er zur Einschüchterung vor ein Hinrichtungspeleton gestellt. Nach öffentlichem Druck, auch durch die ausländische Presse, ließ man ihn schließlich ohne Prozess und Urteil frei.
In Frankfurt profilierte sich Maybaum als entschiedener Gegner des politischen Zionismus in Reden und Buchveröffentlichungen. Seiner Auffassung nach sollten Juden ihren Platz in Deutschland nicht aufgeben. 1936 wurde er zum Gemeinderabbiner von Berlin berufen. Seine Predigten dort erfuhren großen Zulauf. Inzwischen aber hatten sich die Bedingungen für die jüdischen Gemeinden verschlechtert. Jüdische Studenten konnten nicht länger die Universitäten besuchen. Als Ausgleich nahmen viele junge Leute jüdische Studien auf. Maybaum unterrichtete Klassen dieser Studenten in rabbinischer Lehre.
In der Pogromnacht im November 1938 entging er nur mit Glück der erneuten Verhaftung. Um von der Gestapo nicht zu Hause angetroffen zu werden, ließ er sich nächtelang von einem befreundeten Rabbiner durch die Vorstädte Berlins chauffieren, bis sich die Lage beruhigt hatte. Nach dieser Erfahrung war auch Maybaum zur Emigration bereit. Sein Plan, nach New York überzusiedeln, war wegen der US-Einwanderungsbeschränkungen nicht zu verwirklichen. Auf Empfehlung des Chief Rabbi von London, J.H. Hertz, erhielt er jedoch ein Visum für England. Der neunjährige Sohn Michael ging noch vor den Eltern mit einem Kindertransport dorthin. Die Eltern folgten mit der dreijährigen Tochter Alisa im März 1939. Maybaums jüngerer Bruder war bereits 1938 nach Palästina ausgereist, seine Eltern und Schwestern aber blieben im Land und sollten später der Nazi-Verfolgung zum Opfer fallen.
Bei seiner Ankunft in London sprach Maybaum kein Englisch. Er wurde daher zunächst als Prediger der deutschsprachigen Gemeinde in Hampstedt eingesetzt. Bald nach Kriegsbeginn begann man auch die deutschen Flüchtlinge pauschal als „feindliche Ausländer“ anzusehen und von der Polizei zu internieren. Maybaum entzog sich der Verhaftung mit der gleichen Taktik wie in Berlin. Da die englische Polizei, im Gegensatz zur deutschen, stets tagsüber kam, verbrachte er die Tage in der örtlichen Bibliothek mit Zeitungslesen. So entging er der Internierung und erwarb nebenbei seine Englischkenntnisse.
Von 1941-1945 unterrichtete er jüdische Flüchtlingskinder in einem Internat in Hindhead. Trotz der eingeschränkten Lebensumstände fanden sich häufig Gäste am Tisch des Hauses ein, Kollegen, Schüler und Studenten. Die Tochter erinnert sich an häufige und hitzige politische Diskussionen. 1948 übernahm Maybaum die Stelle des Rabbiners in der Gemeinde der Edgware&District Reform Synagogue, ab 1956 unterrichtete er vergleichende Religionsgeschichte, Theologie und Homiletik am Jewish Theological Seminary in London. Generationen von Rabbinerstudenten wurden dort durch ihn geprägt. 1957 berief ihn die Universität Frankfurt/Main für ein Semester als Gastdozent. Nur in Israel wurde ihm wegen seiner antizionistischen Haltung die Ehre einer Einladung nicht zuteil.
Ignaz Maybaum starb 1976 in London. Seitdem ist seine Bedeutung als Theologe, insbesondere als Theologe der Schoah noch gewachsen, kein Fachbuch kann ihn verschweigen8. Sein Vermächtnis an die Nachwelt sind, neben zahllosen Artikeln in Zeitschriften, zwölf Buchveröffentlichungen zu Problemen, die sich zwischen Theologie, Philosophie und jüdischen Lebensfragen bewegen und die Gedankenwelt und inhaltliche Ausrichtung seiner Lehren verdeutlichen. Maybaum vertrat einen der zwei Pole in der teilweise erbitterten Auseinandersetzung zwischen den Verfechtern der zionistischen Idee und denen, die die Berufung in der Diaspora sehen. Bei aller Anerkennung des Idealismus der zionistischen Pioniere in Palästina glaubte er die jüdische Zukunft in den Gemeinden der Diaspora besser gewährleistet - trotz Unterdrückung und Verfolgung.
Hermann Gerson: Eine Jugend in Deutschland, unveröffentlichte Autobiographie 1970.

Die entgegengesetzte Position vertrat Hermann Gerson, 1908 in Frankfurt geboren. Er besuchte dort das Friedrichsgymnasium, machte 1926 Abitur und ging dann zum Studium nach Berlin. Zunächst studierte er Jura, dann Philosophie und Psychologie an der Humboldt-Universität. Ebenso wie Maybaum einige Jahre vor ihm besuchte auch er die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums. 1932 erwarb er den Doktorgrad der Philosophie.
Seit seinem 18. Lebensjahr leitete Gerson die Frankfurter Ortsgruppe der "Kameraden", einem Verband jüdischer Wander-, Sport- und Turnvereine9. Zwei Jahre später war er zum Bundesführer aufgestiegen. Die "Kameraden" wollten die religiösen und sittlichen Werte des Judentums mit der deutschen Geistes- und Gemütswelt verknüpfen. Sie bekannten sich zum deutschen Volkstum und bekämpften ebenso den Antisemitismus wie alle nationaljüdischen Bestrebungen. Zwischen deutschem Vaterland und deutscher Kultur und der Besinnung auf ihre jüdische Herkunft strebten sie danach, einen neuen Menschentyp zu schaffen. Sie fügten sich damit nahtlos in die vielseitige Umwelt der deutschen Jugendverbände in den 1920er Jahren ein.
Die "Kameraden" waren jedoch in der jüdischen Gemeinde umstritten. Der Frankfurter Rabbiner - Ignaz Maybaum - wetterte von der Kanzel herab gegen den Jugendverführer Gerson und rief die Eltern zum Widerstand auf. Infolge der politischen Entwicklung in Deutschland kam es 1932 zur Spaltung. Deutschnational gesinnte Mitglieder gründeten das "Schwarze Fähnlein", eine radikal linke Abspaltung bildete die "Freie deutsch-jüdische Jugend", und der Großteil der "Kameraden" tat sich unter Führung Gersons zum Bund der "Werkleute" zusammen. Sie wählten ihren Namen nach einem alten Spruch des Rabbi Tarphon: "Der Tag ist kurz, das Werk ist groß".
Die "Werkleute" erstrebten die Herausbildung eines jüdischen Menschentyps im Sinne des Zionismus. Kurz nach Hitlers Machtübernahme beschlossen sie, ihre Ausbildungen und Berufe aufzugeben und einen Kibbuz zu gründen - eine radikale Entscheidung, die in der Folge manchen das Leben kosten, vielen aber das Leben retten sollte. Ein Kibbuz ist eine in Palästina entstandene neue Art der Gemeinschaftssiedlung, eine zumeist ländliche Genossenschaft mit kollektivem Landeigentum und basisdemokratischen Strukturen. Nachdem er mehrmals von der SA verhaftet und misshandelt wurde, begann Gerson Gelder für die Auswanderung zu sammeln.
Die britische Mandatsbehörde gab nur eine begrenzte Zahl von Visa für Palästina aus. Man konnte als "Kapitalist" oder als "Arbeiter" immigrieren. Als Arbeiter musste man eine landwirtschaftliche Ausbildung nachweisen, als Kapitalist benötigte man tausend englische Pfund (nach heutigem Wert ca. 50.000 EUR). Die erste Gruppe der Werkleute wanderte 1933 als "Kapitalisten" aus. Gerson folgte mit einer weiteren Gruppe ein Jahr später, um im Tal von Megiddo in Nordpalästina den Kibbuz Hasorea ("Der Sämann") aufzubauen.
Nach ihrer Ankunft waren die Einwanderer mit einer primitiven und grausamen Wirklichkeit konfrontiert. Wer heute durch Israel fährt, erlebt grüne Landschaften; in Palästina der 1930er Jahre erwarteten den Einwanderer kahle Einöden, ein mörderisches Klima, schwerste körperliche Arbeit. Manche der Pioniere erlagen kurz nach der Ankunft Typhus, Fieber und Erschöpfung. Intellektueller Scharfsinn und theologische Argumentation waren nicht mehr gefragt, ganz andere Führungsqualitäten als in Deutschland waren erforderlich. Als Doktor der Philosophie tat Gerson sich schwer.
Zunächst galt es, Land für den Kibbuz zu erwerben. Der Boden gehörte stets einem Emir, einem arabischen Großgrundbesitzer, der in Beirut saß oder in Paris. Auf dem Land lebten nur seine Arissim, die Pächter mit ihren Familien. Sie beackerten den kargen Boden mit Holzpflügen. Vom Ertrag hatten sie zwei Drittel an den Emir abzuliefern. Beim Kauf von Land mussten per Gesetz alle Pächter abgefunden und ihnen neue Parzellen zugewiesen werden. So zog sich der Landkauf für den Kibbuz Hasorea jahrelang hin.
Schließlich besaßen die Pioniere einen schmalen Streifen Land und ein paar verstreute Felder. Die Urbarmachung erwies sich als schwierig. Sie hatten kaum Erfahrung in der Landwirtschaft. Die Felder waren großenteils Sümpfe. Das Kapital war schnell aufgebraucht. Teilweise mussten sich die Kibbuzniks als Lohnarbeiter verdingen. Kurz, die wirtschaftliche Situation war ein Desaster. Um Geld zu beschaffen, musste Gerson tief in die Trickkiste greifen. Er eröffnete Konten bei mehreren Banken und stellte wechselweise Schecks auf sich selbst aus, die er dann einlöste und das Geld sofort abhob. Mit diesem Schneeballsystem wurde auch der Kauf eines 22-PS-Traktors finanziert. Andere Kibbuzim arbeiteten mit ähnlichen Methoden. Als die Finanzierung schließlich platzte, griff die Jewish Agency ein und konsolidierte die aufgelaufenen Schulden durch Umwandlung in langfristige Kredite. Ende der 1940er Jahre stand der Kibbuz auf eigenen Beinen. Die landwirtschaftliche Grundlage wurde mit der Zeit ergänzt durch eine Möbelfabrik und eine Produktionsanlage für Polyäthylenfasern. Zu den deutschen Gründern kamen bald Gruppen von Juden aus Bulgarien und Syrien hinzu.
Hermann Gerson hat mit seinen "Werkleuten" einen erheblichen Teil der jüdischen Jugend Frankfurts - und mitunter auch deren Eltern - nach Palästina geführt und damit gerettet. Er blieb bis an sein Lebensende Mitglied des Kibbuz Hasorea. Ab 1938 kümmerte er sich im Auftrag des Kibbuzverbands um die Erziehung und Ausbildung junger Kibbuzniks. 1940 wurde er Sekretär der Erziehungsabteilung, 1942 auch Mitglied der Exekutive. Er hielt Vorlesungen am Kibbuz-Seminar in Tel Aviv. In London hat er 1960 noch einmal ein Sabbatical, ein Studienjahr, an der School of Economics verbracht und im Bereich der Sozialpsychologie geforscht. 1965 gründete er in Tel Aviv eine eigene Fakultät für Kibbuzerziehung und leitete sie bis zu seiner Entpflichtung 1974. Gerson starb am 14. April 1989 in Hasorea und wurde ebendort beigesetzt.
Schleichende Entwurzelung. Die Geschwister Neumark
Bericht von Ada Brodski, geb. Neumark, in Jerusalem am 5. 11. 1995
Meine Eltern waren vollkommen in der deutschen Kultur verwurzelt. Mein Großvater mütterlicherseits, Max Bernhard, kam aus dem Burgenland, aus Eisenstadt, nach Posen, wo er meine Großmutter, Fanny Friedländer, heiratete. Er hatte dort einen Weinkeller und ein Weingeschäft. Die Großeltern väterlicherseits waren Kaufleute in Posen. Woher der Name Neumark stammt, weiß ich nicht. Es kam vor, dass ein Lehrer mich als Beispiel für einen guten deutschen Namen aufrief und dann entsetzt war, als sich herausstellte, dass ich jüdisch war.
Meine Eltern haben nach dem ersten Weltkrieg in Posen geheiratet. Mein Vater hat dort als Kinderarzt praktiziert. Meine Mutter war Sängerin, hat aber um der Familienpflichten willen auf eine Konzertkarriere verzichtet. Um 1920 verließen meine Eltern Posen, wie alle Mitglieder unserer weitverzweigten Familie, weil sie auf keinen Fall auf ihr Deutschtum verzichten und Polen werden wollten. Sie gingen nach Frankfurt, wo schon andere Familien aus Posen lebten, die Hirschbergs, die Nehabs. Man wuchs damals in richtigen Clans auf, Großfamilien, die alle möglichen Vettern, Cousinen, Onkels und Tanten, auch 2. und 3. Grades, einschloss, und traf sich häufig zu Familienfesten mit Aufführungen, Konzerten und Liedern.
Mein Vater war als Kinderarzt sehr beliebt. Er hatte eine große nichtjüdische Kundschaft. Im städtischen Krankenhaus leitete er die Säuglingsabteilung. Er hat auch unterrichtet und Kurse für Schwestern und Krankenpfleger gegeben. Ich erinnere mich, dass wir Kinder zweimal im Jahr Rechnungen für die Krankenkasse austragen mussten. Dadurch kannte ich die Stadt recht gut. Bei den vielen Besuchen meines Vaters in den Arbeitervierteln der Stadt - besonders der Dammvorstadt, wo es viel Armut gab - nahm er mich oft mit, damit ich "das Leben kennen lerne". Noch Ende 1933, als die neuen Machthaber die "Winterhilfe" veranstalteten, bat die Stadtverwaltung meinen Vater um eine Liste der bedürftigen Mitbürger, und mein Bruder und ich wurden offiziell mit der Verteilung der Lebensmittel an die betreffenden Familien beauftragt. Ob Judenkinder oder nicht, wir wurden dort mit Umarmungen und Dankeshymnen empfangen. Unsere Wohnung mit der Praxis lag am Wilhelmsplatz neben einem Blumengeschäft und dem Café Kyritz. Auf der andern Seite des Platzes, vorbei am Kaiserdenkmal, befand sich die Hardenberg-Loge. Vom Balkon aus konnten wir die Postuhr an der Ecke der Logenstraße sehen, nach der wir immer unsere Uhr stellten. Schräg gegenüber war die große Waldorf-Buchhandlung. In der Richtstraße trafen wir uns oft bei Luigi's Eisdiele. Für 10 Pfennig bekam man ein Eis im Glas. Unsere Eltern durften nichts davon wissen. Einmal kam ich dorthin, und da saß mein Bruder. Ich hatte Angst, dass er mich verriet, aber er aß ja auch selbst ein Eis.
Neben uns hatte Hirschberg sein Rechtsanwaltsbüro. Neben der Synagoge wohnte der Kultusbeamte Lapidas, seine Frau verkaufte dort koschere Würstchen. Von der Leihbücherei an der Ecke holte ich mir immer Kriminalromane, manchmal dreimal am Tage. Die deutsche Kultur hat mich als kleines Mädchen geprägt. Ich sehe mich noch in meinem Bett in dem schmalen Raum neben dem Musikzimmer, über mir an der Wand der Sämann von Van Gogh, mit selbstverdientem Geld erstanden, gegenüber das Schulpult, neben dem Bett ein wirres Durcheinander von Büchern - Karl May, Martin Buber, "Der Kampf der Tertia", "Die Buddenbrooks", "Professors Zwillinge", "Wüste und gelobtes Land". Vom Musikzimmer nebenan dringen die Klänge von Schubertliedern herüber, der Mezzosopran meiner Mutter, begleitet von meinem Bruder. Es war wie eine Rückzahlung einer Schuld an meine Kindheit, als ich vor einigen Jahren Übersetzungen dieser Lieder ins Hebräische veröffentlichen konnte.
Von den Nazis wusste ich lange nichts. Ich besuchte seit 1931 die Volksschule, übersprang dort eine Klasse und kam so 1934 in die Sexta des Kleist-Lyzeums. Einmal, wohl 1933 nach der Machtübernahme, bekamen wir die Aufgabe, aus der Zeitung Bilder unserer Staatsführer auszuschneiden. Mein Vater half mir und hat Bilder ausgeschnitten, lauter Bilder von Hindenburg, immer nur Hindenburg. Ich habe gesagt: "Aber wir brauchen auch Hitler!". Er sagte nur: "Nein, Hitler nicht." Ich wollte aber unbedingt das berühmte Bild haben, wo Hindenburg dem Hitler die Hand gibt. Da hat mein Vater die Schere genommen und Hitler abgeschnitten. Die halbe Hand war noch drauf. So hatte ich nur Bilder von Hindenburg und ging sehr unglücklich zur Schule, doch hat sich der Klassenlehrer dann gar nicht für mein Heft interessiert.
Ich erinnere mich auch noch gut an ein besonders unerquickliches Erlebnis zu etwa der gleichen Zeit, in der vierten Klasse der Grundschule. Unser Klassenlehrer war ein schneidiger junger Mann, oft in brauner Uniform, der aber trotzdem die jüdischen Schülerinnen meistens freundlich behandelte. Aber einmal rief er mich während einer Deutschstunde zusammen mit der "reinrassigen" Kriemhild vor die Klasse. Er forderte die Schülerinnen auf, uns genau anzusehen: "Sehr ihr, das ist Kriemhild, ein klassischer germanischer Typ, groß, blond, mit Langschädel, aber etwas langsam im Denken. Daneben Ada, bei der alle Kräfte auf typisch jüdische Art in den Kopf gegangen sind - auf Kosten aller anderen Fähigkeiten, wie ihr an dem verkümmerten Körper deutlich sehen könnt!" Das behagte mir keineswegs, zwar war ich klein, aber eine gute Turnerin, sehr begehrt beim Völkerball und im Hochsprung eine der Besten in der Klasse. Auch Kriemhild war nicht begeistert von der Charakterisierung. In der Pause standen wir auf dem Schulhof und schmollten gemeinsam, sie in ihrer hochaufgeschossenen germanischen Denklangsamkeit, ich in meiner körperverkümmerten jüdischen Intellektualität.
Ich konnte bis zu den großen Ferien 1938 zum Kleist-Lyzeum gehen. Irgendwann war ich die einzige Jüdin in der Klasse. In der Parallelklasse waren noch drei oder vier, die Gumperts, die Lachmann, die gingen etwas früher ab als ich. In der Klasse selbst hatte ich keine Schwierigkeiten, doch blieben Diskriminationen und Einschüchterungen seitens der Lehrer nicht aus. Fräulein Kunze, die feingeistige Direktorin - zur Unterscheidung von einer gleichnamigen Lehrerin "Oberkunze" genannt - verschwand nach der Machtübernahme von der Bildfläche. An ihre Stelle trat ein SA-Mann in Stiefel und Sporn. Bei seinen kurzen Visiten in den Klassen lief es mir kalt den Rücken herunter. Man hörte dauernd die NS-Lieder, viele Mädchen kamen bei uns auch mit BDM-Kluft in die Schule. Wir jüdischen Kinder wurden nicht vom Fahnenappell befreit, sondern mussten teilnehmen, mit an die Seite gepressten Armen, denn wir durften ja nicht mit den andern die Hand heben. Wir durften zwar das Deutschland-Lied, aber nicht das Horst-Wessel-Lied mitsingen. Für uns Kinder war das schwierig. Besser wäre gewesen, man hätte uns ganz befreit. Von den christlichen Andachten waren wir aber dispensiert und durften dann Schularbeiten machen.
In der Deutschstunde gehörte ich jetzt nicht mehr zu den zwei oder drei Erwählten, die ihre Aufsätze der Klasse vorlesen durften. Als einmal der Musiklehrer fragte, wer bereit sei, ein Gesangstück vom Blatt zu singen, und ich mich meldete, rief er entrüstet: "Was, keine einzige in der ganzen Klasse?" Da bekam er es aber mit meinen Mitschülerinnen zu tun, die ihn energisch auf meine erhobene Hand aufmerksam machten. Ich denke öfter und mit Gefühlen des Dankes an all diese blonden Mädchen in ihren Jungmädelblusen, die sich ohne viel Überlegung, aus spontanem Gefühl für Recht und Unrecht, auf meine Seite stellten – an meine Freundin Marianne, das freundliche Ilschen Schäfer, das kohlschwarzzopfige Mohrchen, die sanfte Ruth Bunge, die aristokratische Ingeborg Hermsmayer oder die temperamentvolle Annelore Maushacker, die Tochter des Chefredakteurs der Oder-Zeitung. Nie habe ich ein beleidigendes Wort von einer von ihnen gehört. Einige kamen nach wie vor zu mir nach Hause, um gemeinsam Schularbeiten zu machen, Bücher zu tauschen oder einen Kanon zu singen. Die hübsche Alice Wolf mit dem Bubikopf stand jeden Morgen zum gemeinsamen Schulweg vor unserm Haus. Ihr Bruder, ein hünenhafter Hitlerjugendführer, trat als Beschützer des meinen auf, indem er rassebewusstere Mitschüler des Friedrichsgymnasiums strengstens verwarnte, sich an ihm zu vergreifen.
Prüfungen für uns waren demgegenüber die Anpöbelungen auf der Straße. Ich habe noch eine Narbe an der Stirn von einem solchen Vorfall. Als ich einmal die Straße entlang ging, marschierte eine HJ-Abteilung mit Fahne vorbei. Da sprangen ein paar Jungen auf mich zu und stießen mich gegen die Wand, weil ich die Fahne nicht gegrüßt hatte. Als Jüdin durfte ich aber die Fahne gar nicht grüßen, im Gegensatz zu "deutschen" Mädchen. Ich habe furchtbar geblutet.
Schon 1933 wurde mein Vater als Leiter der Säuglingsstation entlassen. Auch die Krankenkasse bedurfte seiner Dienste nicht mehr. Bei immer schwächer werdender Privatpraxis wurde das Verdienen des Lebensunterhalts für die vierköpfige Familie immer mehr zum Problem. Als mein Vater keine nichtjüdischen Patienten mehr hatte, gab meine Mutter Englisch-Kurse. Die ganze Gemeinde hat bei ihr Englisch gelernt, sie wollten ja alle auswandern. Meine Mutter musste die Lektionen vorher erst selbst lernen, war den Schülern immer gerade eine Lektion voraus.
Wir haben auch ein Zimmer an einen nichtjüdischen Geigenlehrer vermietet. Er war entschiedener Antinazi und hat bis zum Sommer 1938 in diesem Zimmer in unserer Wohnung Geigenstunden gegeben. Eines Tages kam er dann zu meinen Eltern und eröffnete ihnen, dass er nicht mehr bei ihnen unterrichten dürfe. Er bat sie um Verständnis, er sei ganz außer sich, aber er hätte große Schwierigkeiten, die Schüler durften nicht mehr kommen. Bis dahin konnte auch die Klavierlehrerin noch in unser Haus zum Unterricht kommen, auch das war nun nicht mehr möglich. Auch sie musste uns absagen, es tat ihr schrecklich leid.
Mein Vater gehörte dem Vorstand der jüdischen Gemeinde an. Daneben war er auch in der Hardenberg-Loge tätig. Dies war eine jüdische Loge, die nach dem Verbot der anderen Logen noch fortbestand. Sie befand sich in einem schönen Gartenhaus am Wilhelmsplatz. Wir hatten dort auch unsere Heimabende von den "Werkleuten". Wir haben dort einen Chor gehabt und viel Musik gemacht. Während der Versammlungen kam mitunter ein SA-Mann und kontrollierte. Wir waren jedoch informiert, worüber wir dann zu sprechen hatten, und was wir zu singen hatten. Das Thema wurde sofort gewechselt.
Wir sind schon als junge Mädchen zu den "Werkleuten" gegangen, die aus den "Kameraden" hervorgegangen waren. Mein Bruder, der drei Jahre älter war, gehörte schon lange dazu. Die "Kameraden" waren noch in keiner Weise zionistisch ausgerichtet, sie standen dem Wandervogel nahe, veranstalteten Heimabende, hatten Lager, sangen Landsknechtslieder wie die andern deutschen Bünde. Der Wandervogel wurde jedoch zunehmend antisemitisch. Daher waren rein jüdische Wanderbünde gegründet worden. Die "Werkleute" waren bereits zionistisch ausgerichtet, Martin Buber hat sie stark beeinflusst. Sie sorgten auf die bestmögliche Weise für die Stärkung unseres Selbstbewusstseins. Wir pilgerten sonntags hinaus zu einer Wiese im Eichwald, hielten Völkerballturniere ab, sangen Landsknechts- und hebräische Pionierlieder durcheinander, saßen im Kreise auf dem Gras, im Schneidersitz, diskutierten über die Weltprobleme, den Chassidismus und die Kibbuz-Bewegung. Wenn wir durch die Wälder radelten, immer auf der Hut, zu zweit oder zu dritt, um nicht Aufmerksamkeit zu erregen, träumten wir von der judäischen Wüste, den Bergen Galiläas und der wunderbaren Freiheit, die uns dort erwartete. Wir fühlten uns inzwischen als Fremde in dem Land unserer Geburt, das so sehr darauf aus war, uns loszuwerden.
Gleichzeitig mit den wachsenden Einschränkungen und Schikanen der Nazi-Zeit intensivierte sich das kulturelle Leben. Da zahllose jüdische Künstler entlassen waren und sozusagen auf der Straße lagen, konnten sie nur noch im eigenen Rahmen wirken. So erschienen jetzt in unserer Provinzstadt angesehene Musiker, Schauspieler und Schriftsteller, um im Saal der Hardenberg-Loge, und nach der Beschlagnahme dieses schönen Hauses in dem nüchternen Gemeindesaal über der Synagoge ihre Kunst darzubieten. Alle wurden in unserm Haus empfangen, dort wurde musiziert, rezitiert, diskutiert, und so konnte man immer etwas Neues hören und erleben. Meine Eltern führten ein offenes Haus, es gab viel Geselligkeit. Hausmusik wurde veranstaltet, meine Mutter hat gesungen. Ich wurde als unentbehrliche Notenumblätterin in diesen Kreis hineingezogen und hatte meinen Anteil an dem Applaus für die Klaviervirtuosen. Wesentlicher war allerdings der Beitrag meines Bruders, der sich als Begleiter, Solopianist und sogar als Komponist hervortat. Sein erster größerer Auftritt erfolgte bei den Kinderszenen von Schumann, diesen Tondichtungen von den Freuden und Leiden, Ängsten, Grübeleien und Träumen einer heilen Kindheit. Eben der, die unsere Eltern für uns geplant hatten, bevor ein böser, mächtigerer Wille eingriff.
Aus dem Sprechzimmer meines Vaters hörte man immer seltener Babygeschrei, manchmal verstummte es für ganze Stunden, besonders, wenn der SA-Mann auf der Straße patrouillierte und jeden, der mit einem Kind ins Haus trat, nach Namen und Anliegen fragte. Die wenigen, die der ruhigen Autorität meines Vaters zuletzt noch die Treue hielten, kamen oft erst nach Anbruch der Dunkelheit oder baten ihn telefonisch um einen abendlichen und nächtlichen Besuch. Meine Mutter, von Jugend auf zionistisch orientiert, drängte auf Auswanderung nach Palästina. Mein Vater pflegte auf schlimme Geschichten stets mit dem Ausspruch zu reagieren: "Das glaube ich nicht!"- In der Emigration - und die Alijah, der "Aufstieg" ins Land Israel war für ihn nichts anderes - sah er nichts als ein Kapitulieren, ein fatales Akzeptieren des Sieges des Bösen über das Gute. Seine Gäste führte er nach wie vor in die alten Frankfurter Messehäuser, zum Geburtshaus von Heinrich von Kleist, zeigte ihnen das Kunersdorfer Schlachtfeld oder den exotischen Baum, Gingko biloba, den er in den Anlagen entdeckt hatte, und deklamierte dazu das Gedicht, das Goethe einst bei der Betrachtung eines Baumes dieser Art in Heidelberger Schlosshof niedergeschrieben hatte.
Doch war meine Kindheit keine glückliche. Nicht wegen des sich immer mehr verfinsternden Himmels, denn was wusste ich schon von dem Grauen, das in der Zukunft wartete, sondern weil über ihr die große, schwarze Wolke des Abschieds lag. Mein Vater hatte beschlossen, nicht auszuwandern. Andere, viele nahe Verwandte und Freunde, entschieden sich anders. Häuser, in die wir gewohnt waren einzutreten, wurden zu abweisenden Fassaden. Um den Weggezogenen in ihre neuen Wohnorte zu folgen, mussten wir, neben der Palästina-Karte, Knaurs großen Weltatlas zu Rate ziehen. Oft bedurfte es der Wanderung über mehrere Länder, um die verstreuten Mitglieder einer bis vor kurzem noch glücklich vereinten Familie aufzufinden.
Hirschbergs waren die ersten, die weggingen, schon 1933, ohne zu zögern. Onkel Josef und Tante Else, wie wir sie nannten, waren die besten Freunde unserer Eltern gewesen. Onkel Josef besaß ein Riesengrundstück mit Garten, Wiese und Wald am Rande der Stadt, ein Paradies unserer Kindheit, bald ein verlorenes Paradies. Damals war Traudchen Lapidas noch da, die unzertrennliche Gefährtin meiner frühen Kindheit, die Tochter des Kultusbeamten der jüdischen Gemeinde. Unter seinen verschiedenen Ämtern und Pflichten fiel ihm auch die Aufgabe zu, an den hohen Feiertagen den Schofar, das uralte Widderhorn, zu blasen. In den letzten Monaten vor ihrer Abreise waren wir sehr aktiv. Ich schrieb Geschichten, sie illustrierte sie und band sie ein, und dann verkauften wir sie für teures Geld an wohlmeinende Bekannte, eine Mark oder 1,50 pro Buch. Dann ging sie mit ihren Eltern nach Palästina, und ich schloss mich für eine Woche in mein Zimmer ein und war für niemanden zu sprechen.
In den ersten Jahren predigte unser Rabbiner, Ignaz Maybaum, der angesehene und autoritäre Seelsorger unserer Gemeinde, noch gegen die Kleingläubigen, die nicht standhalten wollten. Eines Tages verschwand aber auch er, zunächst nur ins Gefängnis, und wir mussten uns für seinen kleinen Sohn Mischa alle möglichen Ablenkungen ausdenken, damit er nicht zu oft nach seinem Vater fragte. Irgendwann packte auch er seine Siebensachen, nahm seine Frau, den krausköpfigen Mischa und das Baby, und suchte das Weite.
Im Laufe der Zeit wurde es eine Gewohnheit, auf den Bahnhof zu gehen, wenn jemand abfuhr. Wir winkten, bis der Zug außer Sicht war, dann gingen wir nach Hause und brüteten. In den letzten zwei Frankfurter Jahren, 1937/38, hatten alle unsere großen Brüder und Schwestern von den "Werkleuten" die Stadt verlassen. Wir elf- bis dreizehnjährigen Jungen und Mädchen versuchten, unsere Verwaistheit mit gesteigerter Aktivität zu verdrängen. Führerlos zurückgeblieben mussten wir uns nun selbst führen, auch nach außen hin. In bestimmten Abständen musste ich mich als kleines Mädchen mit Pony und Stupsnase, doch "Ortsgruppenleiterin der Werkleute", bei der Kriminalpolizei melden. Das war immer ein allgemeines Gaudium, und keiner von den jovialen Beamten sprach anders mit mir als mit amüsiertem Augenzwinkern.