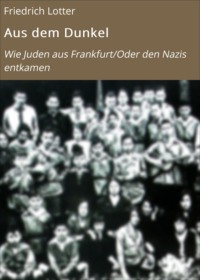Kitabı oku: «Aus dem Dunkel», sayfa 5
Flucht mit Gestapo-Hilfe. Salo Glass
Bericht von Salo Glass, im Alter von 92 Jahren, nahezu blind, 1995 in New York auf Band gesprochen. Ergänzende Informationen durch seine Tochter.
Geboren bin ich 1903 in Gollantsch, im Kreis Wongrowitz in der Provinz Posen. Posen gehörte zum V. Armeekorps, und auch in meiner Familie gab es viele Soldaten. Mein Vater hat bei den Grünen Jägern gedient, sein jüngerer Bruder bei den Schwarzen Husaren in Danzig. Auch der ältere Bruder meiner Frau war Soldat, er fiel 1918 wenige Tage vor Kriegsende. Ich war seit meinem 10. Lebensjahr Mitglied der Jugendwehr. Im Krieg haben wir in Lazaretten bei der Betreuung der Verwundeten geholfen.
Ich lebte bis 1920 in Posen, votierte nach Abtretung der Provinz an Polen für Deutschland und siedelte nach Frankfurt/Oder über. 1938 wohnte ich dort mit meiner Frau und zwei Töchtern im Haus von Rechtsanwalt Broh in der Richtstraße. Zwei Wochen vor den Novemberereignissen war der zweite Kantor und drei Tage später der alte Synagogendiener gestorben. Rabbi Curtis Cassel fragte mich den Tag darauf, ob ich nicht einspringen wollte. Es passte mir schlecht, aber ich bin seiner Bitte nachgekommen.
Im Herbst 1938 war die Mehrzahl der jüdischen Geschäfte in Frankfurt schon in "arische" Hände überführt worden. Viele Juden, vor allem jüngere, hatten die Stadt bereits verlassen. Am 8. November 1938 nachmittags hörte ich von einem Freund, dass etwas im Gange sei. Ich solle am Abend besser nicht zu Hause bleiben. Ich bin spät nach Hause gekommen und habe gehört, wie man meinen Nachbarn zur Rechten und meinen Nachbarn gegenüber abgeholt hat. Bei mir hat man nicht angeklopft - ich glaube, man hat noch nicht gewusst, dass ich hier eingezogen war.
Um Viertel vor Zwölf bin ich hinausgegangen zur Synagoge. Dort habe ich alles in Trümmern vorgefunden. Ich konnte nur noch zwei Thora-Rollen retten. Plötzlich stand ein Gestapo-Kommissar mit seinem Assistenten vor mir. Was ich hier tue? Ich erwiderte, ich versuche zu retten, was ich kann. Er: Sie haben kein Recht dazu! Ich erklärte ihm, dass ich nach dem Tod des alten Synagogendieners dessen Amt übernommen habe. Im gleichen Moment kam die SA-Abteilung in die Synagoge, Sturmbannführer Schilow10 mit seinen 60 Mann. Er redete kurz mit dem Kommissar, und die Sache war geklärt. Nachher fragte mich der Kommissar nach meiner Beziehung zu Schilow. Es war eine alte Freundschaft. Ich war zu seinem 50. Geburtstag eingeladen. Dort waren 60 SA-Leute, 12 SS-Leute und meine Wenigkeit.
Der Kommissar hat mich noch zehn Minuten lang verhört und dann gehen lassen. Kurz vor Eins war ich zu Hause. Früh am nächsten Morgen ging ich noch einmal zur Synagoge, um nachzusehen, ob noch etwas zu retten war. Die Synagoge war völlig niedergebrannt. Die Leute, die dort zuschauten, gaben sich gleichgültig. Mir war klar, dass ich auf der Straße nicht mehr sicher war. Ich bin dann mit der Straßenbahn zum Judenfriedhof gefahren und blieb dort ungefähr zwei Stunden. Der Friedhofsaufseher Billerbeck hat mich dann mit seinem Auto zu meinem – nichtjüdischen - Freund Lautensack gefahren. Ich wusste, dort war ich vorerst außer Gefahr.
Später erfuhr ich, dass der Kommissar sich Einlass zu unserer Wohnung verschafft und mit meiner Frau gesprochen hatte. Er sagte zu ihr: "Lass deinen Mann allein, komm mit den Kindern, du bekommst eine schöne Wohnung, und wir werden für dich sorgen. Du bist doch nicht jüdisch." Sie sagte mit Nachdruck: "Ich bin jüdisch!" Sie zeigte ihm auch das Bild ihres Bruders, der 1918 gefallen war. Er gab dann meiner Frau noch eine Bescheinigung und versprach ihr, sie könne sich auf ihn berufen, wenn jemand sie bedrängen sollte. Eine Woche später allerdings hat der Kommissar noch einmal zwei Leute zu meiner Frau geschickt, um sie zu einer Trennung zu überreden.
Ich war sehr vorsichtig, als ich nach Hause ging. Mit meiner Frau hatte ich verabredet, dass sie ein Handtuch aufs Fenster legt, damit ich wissen konnte, ob jemand oben war. Ich ging hinauf, müde und kaputt von allem, was ich gehört und gesehen hatte, und bestürzt darüber, wer alles verhaftet worden war. Später habe ich gehört, dass die Verhafteten, etwa 35 Männer, ins KZ Sachsenhausen transportiert worden waren. Mich selbst hat man nicht belästigt.
Der Kommissar bat mich tags darauf um meine Hilfe. Ein jüdischer Feldwebel in Fürstenberg hatte sich die Uniform angezogen mit dem Eisernen Kreuz 1. und 2. Klasse und sich dann erschossen. Ich sollte den Toten identifizieren und dann bestatten. Ich habe in ihm einen alten Bekannten wiedererkannt, der vier Jahre im kaiserlichen Hauptquartier gedient hatte. Wir haben getan, was wir konnten, um ihn aufzubahren und ins Grab zu legen.
Mit dem Gestapo-Kommissar bin ich meistens gut ausgekommen. Eines Tages wurde ich wieder zu ihm bestellt. Er hat dagestanden mit erhobener Faust, wie um mich zu schlagen. Es ging darum, dass ich den vorgeschriebenen Vornamen "Israel" nicht führte. Er nahm schließlich aus seiner Schublade die Verordnung heraus und stellte dann fest, dass ich den Namen Israel nicht tragen müsse, denn mein Name Salo reiche zur Kennzeichnung als Jude aus. Von der Zeit an hatte ich Ruhe.
Als meine Abreise feststand, ging ich zu ihm, um ihm mitzuteilen, dass ich das Land verlasse. Er hat mich aufgefordert, wahrheitswidrig zu unterschreiben, dass ich der kommunistischen Partei angehört habe. Ich habe mich geweigert. Er bestand darauf und hat sich aufgeregt, als ich dies nicht tat. Aber als ich mich verabschiedete, wünschte er mir gute Reise.
Meine Frau und ich sollten im Spätsommer 1939 mit einem von der Gestapo organisierten Transport nach Palästina ausreisen. Meine beiden Töchter konnten nicht mit uns fahren, da Kinder unter 12 Jahren nicht legal einreisen durften. Ich konnte für sie jedoch Plätze in Kindertransporten nach England beschaffen. Es gab keine andere Möglichkeit, wir mussten uns von ihnen trennen. Meine jüngere Tochter Ruth fuhr so mit 6 Jahren im Februar 1939, meine Ältere, Margot, mit 11 Jahren etwas später nach England.
Wir Eltern reisten zunächst in Begleitung von zwei Beamten zusammen mit vielen anderen, die verhaftet und inzwischen freigelassen worden waren, per Bahn nach Wien. Als wir dort ankamen, wer hat da gesessen? Der Kommissar mit seinem Assistenten! Der Transport ging über die Donau. Es waren insgesamt 400 Leute, die auf das Schiff sollten. Alle sind untersucht worden. In der letzten Minute befahl der Kommissar mich zu sich. Er forderte mich auf, mein Jacket zu öffnen, er wolle wissen, was ich noch versteckt habe. Er hat mein Jacket und meine Hose durchsucht. "Ich habe nichts versteckt, ich habe hier nur das erlaubte Geld. Weiter nichts!". "Wieso hat er noch Geld?" "Ich wollte meiner Frau noch eine Uhr kaufen, aber wir sind zurückgerufen worden, und daher hatte ich das Geld noch in der Tasche". Es waren 150 Mark und etwas Kleingeld. Er sagte, das Kleingeld könne ich behalten, die 150 Mark müssten zurückgeschickt werden, an die Mutter oder einen Verwandten. Ich sagte, das Geld solle dann an eine jüdische Familie gehen, wo der Mann gefallen ist. In dem Moment habe ich geglaubt, er wolle mich erschießen. Doch er nahm mir nur das Geld ab und ging weg. Wir sind dann abgefahren.
Wir fuhren hinunter nach Rumänien und sollten von dort per Schiff in die Türkei weiterreisen. Da ich in Konstantinopel einen Verwandten hatte, wollte ich mich erkundigen, ob ich telefonieren könne. Plötzlich stand wieder der Kommissar vor mir. Er hatte das Schiff gar nicht verlassen, sondern war mit uns gefahren und hatte in der Kapitänskajüte übernachtet. Er gab mir etwas englisches Geld und meinte, es sei nicht ganz recht gewesen, dass er mir das Geld weggenommen habe. Schließlich würden wir noch viele Wochen unterwegs sein. Er gab mir auch eine Karte mit einer Briefmarke. Von Palästina aus sollte ich ihm schreiben. Er wollte überprüfen, ob der Dampfer angekommen ist. Es war ein sehr altes Schiff, ein früherer Pferdedampfer.
In Rumänien verließ uns der Kommissar also endgültig. Wir waren noch zwei Monate unterwegs, bis wir endlich in Palästina ankamen. In Frankfurt waren bei unserer Abreise noch etwa zwanzig jüdische Familien zurückgeblieben.
Rauch und splitterndes Glas. Curtis Cassell
Interview mit Rabbi Curtis Cassell am 21.6.1996 in London ; sowie C. Cassell , Die Liste : Erinnerungen an die Pogromnacht in Frankfurt .
Mein Abitur habe ich in Oppeln abgelegt, dann drei Semester in Breslau studiert und mein Studium in Berlin an der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums fortgesetzt. Meine Lehrer waren hier Leo Baeck und Ismar Elbogen, dessen Tochter an seiner Vorlesung teilnahm. 1936 traf ich eines schönen Tages auf dem Weg zum Bahnhof Dr. Ignaz Maybaum. Der fragte mich, ob ich sein Nachfolger als Rabbiner in Frankfurt/Oder werden wollte. Maybaum war damals gerade zum ersten Gemeinderabbiner von Berlin berufen worden. Er war ein großer Wissenschaftler, aber auch ein Querkopf: Zunächst Zionist, dann entschiedener Antizionist, als der Zionismus modern wurde.
Das Angebot Maybaums nahm ich nach Rücksprache mit meinen Professoren an. Ich musste jedoch zunächst noch fast täglich von Frankfurt nach Berlin fahren, um das Studium abzu-schließen. Die jüdische Gemeinde in Frankfurt war sehr geschlossen. Vom Antisemitismus habe ich dort zunächst nicht allzu viel gespürt, doch hatte ich auch wenig Kontakt mit Nichtjuden. Allerdings gab es schon vor der Kristallnacht 1938 einige antisemitische Vorfälle. Darunter eine Vorladung zur Gestapo, als ich 1938 aus dem Urlaub von Prag zurückkehrte. Eingehend befragte man mich nach den Gründen meines Besuchs in Prag, und dann forderte mich der vernehmende Beamte auf, ihm eine Liste sämtlicher Juden des Regierungsbezirks auszuhändigen. Den Zweck dieser Liste fand ich erst später heraus, durch die Ereignisse der „Kristallnacht“.
Am 28. Oktober 1938 wurden 17000 Juden polnischer Herkunft in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus Deutschland deportiert, wobei sie all ihren Besitz verloren. Da Polen sie nicht hereinließ, irrten sie unter unsäglichen Bedingungen im deutsch-polnischen Grenzgebiet umher. Damals bat mich die Zentralstelle der Reichsvertretung deutscher Juden, nach Bentschen an die Grenze zu fahren, um Hilfe für die gestrandeten Juden zu organisieren. Doch als ich in Bentschen ankam, wurde ich sofort von der Gestapo verhaftet und mit dem nächsten Zug nach Frankfurt zurückgeschickt. Am 7. November erschoss Herschel Grünszpan, dessen Eltern zu den Ausgewiesenen gehörten, den Angestellten von Rath der Pariser Botschaft. Dies wurde zum Anlass der „Kristallnacht“ und der Ereignisse des 9. November 1938 genommen.
Dieser Tag war auch mein Geburtstag. Meine Schwiegereltern aus Berlin waren zu Besuch gekommen, und ich begleitete sie abends zum Bahnhof. Dabei fielen mir schon zahlreiche Polizisten auf, die sich dort aufhielten. Später gingen wir schlafen, wurden jedoch bald vom Geräusch zerschlagenen Glases und Brandgeruch geweckt. Die Synagoge brannte. Fenster und Schaufenster der Geschäfte wurden eingeworfen. Noch heute leidet meine Frau unter dem Schock dieser schrecklichen Nacht, wenn sie das Geräusch splitternden Glases hört. Wir riefen den befreundeten Rechtsanwalt Leo Nehab an, der in der gleichen Straße wohnte. Wir fürchteten, dass man auch unser Haus nicht verschonen würde, da es ja der Synagoge angeschlossen war. Nehab forderte uns auf, sofort zu ihm zu kommen.
Die Synagoge hatte zwei Ausgänge, den Haupteingang in der Richtstraße, einen Nebenausgang in der Wollenweberstraße. Dass die Gestapo uns am Haupteingang erwartete, wussten wir nicht. Glücklicherweise verließen wir das Haus durch den Nebenausgang und entgingen so der Verhaftung. Ungefähr um elf Uhr abends waren wir sicher in der Wohnung unseres Freundes. Um vier Uhr früh klingelte es dort an der Tür. Es war die Gestapo, die Nehab verhaftete. Ich konnte mich mit meiner Frau unter dem Schreibtisch verstecken. Es war uns klar, dass wir Frankfurt schleunigst verlassen müssten. Da der Bahnhof, wie ich am Abend gesehen hatte, von Polizei bewacht wurde, gingen wir zu Fuß zur nächsten Bahnstation und bestiegen dort den Zug, der uns zu den Schwiegereltern nach Berlin führte. Am übernächsten Tag erschien die Gestapo auch hier und verhaftete meinen Schwiegervater. Ich stand neben ihm, doch mir passierte nichts, denn ich stand nicht auf ihrer Liste.
Die Beamten gingen mit preußischer Gründlichkeit vor, verhaftet wurde nur, wer auf der Liste stand. Erst später wurde mir bewusst, dass auch die Gestapo in Frankfurt die Verhaftungen nach einer solchen Liste vornahm, eben der Liste, die ich für sie im Sommer 1938 hatte anfertigen müssen. Tatsächlich sah ich meine Liste bei einem der Verhöre nach der Kristallnacht bei der Gestapo auf dem Schreibtisch liegen. Da wurde mir klar, dass die Aktion schon lange vorbereitet worden war und wenig mit von Raths Tod zu tun hatte, der nur als Vorwand diente.
Mein Schwiegervater, Werner Mosse, wurde mit vielen anderen in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht, wo er mehrere Wochen blieb. Als er entlassen wurde, war sein Gesundheitszustand äußerst schlecht. Er war im ersten Weltkrieg Stabsarzt gewesen und hatte immer geglaubt, dass die Berichte über deutsche Untaten in Belgien und anderswo Gräuelmärchen sein mussten. Nun war er eines anderen belehrt. Inzwischen war meine Frau nach Frankfurt zurückgefahren, um nach der Wohnung zu sehen. Sie fand sie versiegelt vor. Um die Siegel entfernen zu lassen, musste sie bei der Gestapo vorsprechen. Dort sagte man ihr, ich solle sofort nach Frankfurt zurückkehren. Als ich dort ankam, war die „Aktion“ vorüber. Ich wurde nicht verhaftet, doch unter Hausarrest gestellt. So aber konnte ich meine Gemeinde nicht betreuen, obwohl die Frauen besonderen Beistand benötigten, da ihre Männer verhaftet waren. Als ich mich darüber bei der Gestapo beschwerte, wurde der Hausarrest aufgehoben. Übrigens kam nach der „Kristallnacht“ ein protestantischer Geistlicher zu mir, um mir sein Mitgefühl auszudrücken.
Das Innere der Synagoge war zum großen Teil demoliert, die Orgel völlig zerstört. Die Orgelpfeifen waren beschlagnahmt worden, da sie aus Blei waren. Aus meiner Wohnung war eine neue Reiseschreibmaschine verschwunden. Bei einem weiteren Verhör bat ich die Gestapo um eine entsprechende Bescheinigung, da ich auswandern wollte und diese für die Behörden benötigte. Daraufhin erhielt ich die Schreibmaschine zurück, denn sie sei nicht rechtmäßig entfernt worden. Die Gestapo trug mir auf, weiterhin Gottesdienste abzuhalten, denn es sollte so aussehen, als ob weiter nichts geschehen sei.
Neben den Gottesdiensten begann ich für die wenigen jüdischen Schüler, die noch in Frankfurt verblieben und nun aus den allgemeinen Schulen herausgeworfen worden waren, Schulunterricht zu organisieren. Die Frauen der in die KZ eingelieferten Männer baten mich immer wieder, sich bei der Gestapo für sie zu verwenden, doch hatte ich damit nur wenig Erfolg. Mir war inzwischen eine Stelle in Australien angeboten worden. Ich wollte im März 1939 auswandern und beantragte bei der Gestapo einen Reisepass mit Visum nach England hin und zurück. Diesen verweigerte man mir mit der Begründung, ich sollte erst dafür sorgen, dass auch die übrigen Mitglieder der jüdischen Gemeinde aus Deutschland verschwänden. Erst dann dürfe auch ich gehen.
Die verhafteten jüdischen Männer kamen seinerzeit fast alle wieder frei, doch konnten nur wenige vor Kriegsbeginn ausreisen. Alle Verbliebenen wurden später in Ghettos nach Warschau oder Posen deportiert. Im Mai 1939 wurde mein erster Sohn geboren, und als ich seinen Namen registrieren lassen wollte, musste ich aus einer Liste einen jüdischen Namen wählen. Ich wählte Elias, doch hieß er später in England Charles. Immerhin konnte ich am 25. August 1939 mit meiner Frau und dem Sohn Frankfurt verlassen und nach England reisen. Den Krieg über blieb ich in England.
Nach drei Monaten meldete ich mich zum Militär, war erst bei den Pionieren, wo ich beim Straßenbau eingesetzte wurde, dann konnte ich zur Artillerie überwechseln. Allerdings hatte ich dort Schwierigkeiten, denn statt der für die Ballistik nötigen Mathematik hatte ich im Seminar nur jüdische Kabbalistik gelernt. So wurde ich als Dolmetscher eingesetzt. 1947 erhielt ich mit der Entlassung zugleich die englische Staatsbürgerschaft. Ich war eine Zeitlang Rabbiner in London und wurde dann nach Bulawayo in Südrhodesien, dem heutigen Zimbabwe, berufen. Dort amtierte ich von 1957 bis zu meiner Pensionierung 1977 als Rabbiner. Seitdem lebe ich wieder in London.
Erst 56 Jahre nach der „Kristallnacht“, am 9. November 1994, kam ich wieder nach Frankfurt. Dort erlebte ich gemeinsam mit dem OB Pohl, mit Ignaz Bubis, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, dem Ministerpräsident Stolpe und anderen die Wiederaufstellung des Gedenksteins an die ehemalige Synagoge am Brunnenplatz.
1933. Zwölf Thesen wider den undeutschen Geist
Plakat in fetter roter Frakturschrift, im April 1933 überall angebracht in Fluren, Vorlesungsräumen und Mensen deutscher Universitäten.
1. Sprache und Schrifttum wurzeln im Volke. Das deutsche Volk trägt die Verantwortung dafür, dass seine Sprache und sein Schrifttum reiner und unverfälschter Ausdruck seines Volkstums sind.
2. Es klafft heute ein Widerspruch zwischen Schrifttum und deutschem Volkstum. Dieser Zustand ist eine Schmach.
3. Reinheit von Sprache und Schrifttum liegt an Dir! Dein Volk hat Dir die Sprache zur treuen Bewahrung übergeben.
4. Unser gefährlichster Widersacher ist der Jude, und der, der ihm hörig ist.
5. Der Jude kann nur jüdisch denken. Schreibt er deutsch, dann lügt er. Der Deutsche, der deutsch schreibt, aber undeutsch denkt, ist ein Verräter! Der Student, der undeutsch spricht und schreibt, ist außerdem gedankenlos und wird seiner Aufgabe untreu.
6. Wir wollen die Lüge ausmerzen, wir wollen den Verrat brandmarken, wir wollen für den Studenten nicht Stätten der Gedankenlosigkeit, sondern der Zucht und der politischen Erziehung.
7. Wir wollen den Juden als Fremdling achten, und wir wollen das Volkstum ernst nehmen. Wir fordern deshalb von der Zensur: Jüdische Werke erscheinen in hebräischer Sprache. Erscheinen sie in Deutsch, sind sie als Übersetzung zu kennzeichnen. Schärfstes Einschreiten gegen den Missbrauch der deutschen Schrift. Deutsche Schrift steht nur Deutschen zur Verfügung. Der undeutsche Geist wird aus öffentlichen Büchereien ausgemerzt.
8. Wir fordern vom deutschen Studenten Wille und Fähigkeit zur selbständigen Erkenntnis und Entscheidung.
9. Wir fordern vom deutschen Studenten den Willen und die Fähigkeit zur Reinerhaltung der deutschen Sprache.
10. Wir fordern vom deutschen Studenten den Willen und die Fähigkeit zur Überwindung des jüdischen Intellektualismus und der damit verbundenen liberalen Verfallserscheinungen im deutschen Geistesleben.
11. Wir fordern die Auslese von Studenten und Professoren nach der Sicherheit des Denkens im deutschen Geiste.
12. Wir fordern die deutsche Hochschule als Hort des deutschen Volkstums und als Kampfstätte aus der Kraft des deutschen Geistes.
Die Deutsche Studentenschaft
Luftkrieg über China. Gerhard Neumann
Gerhard Neumann, Herman The German (Autobiographie), Neuauflage Bloomington 2004.
Gerhard Neumann wurde im Oktober 1917 in eine wohlhabende Frankfurter Unternehmerfamilie geboren. Sein Vater, Siegfried Neumann, besaß die „Norddeutsche Bettfedernfabrik“ in der Gubener Straße, wo jetzt noch (2009) auf den Backsteingebäuden die verblichene Aufschrift zu lesen ist. Beide Eltern entstammten jüdischen Familien, praktizierten jedoch ihr Judentum nicht. Der Vater hatte sich gleich zu Beginn des ersten Weltkrieges freiwillig zum Militärdienst gemeldet. Die Erziehung im Elternhaus war streng preußisch. 
Von 1927 bis 1933 besuchte Neumann das Friedrichsgymnasium in der Gubener Straße nahe der väterlichen Fabrik. Er baute Radios, unternahm ausgedehnte Touren mit seinem Faltboot und flog mit 15 Jahren Segelflugzeuge im Rahmen eines Sportprogramms – eine unbeschwerte Kindheit in der Weimarer Republik. Nach bestandenem Einjährigenexamen ging er zu dem Automechaniker Alfred Schroth in der Dammvorstadt in die Lehre. Dieser Mann besaß nur eine winzige Werkstatt, war jedoch ein wahrer Meister im Umgang mit Metall, Motoren und Schweißtechnik. Es sollte sich erweisen, dass Neumann diesen Lehrjahren nicht nur viel für seine spätere Laufbahn verdankte, sondern möglicherweise auch sein Leben.
1935 legte Neumann das Gesellenexamen ab und besuchte eine der renommiertesten technischen Schulen Deutschlands, die Ingenieurschule Mittweida in Sachsen. Er und zwei andere Juden durften dort studieren, weil ihre Väter Frontsoldaten gewesen waren. Selbst spürte Neumann zu dieser Zeit noch kaum etwas vom Antisemitismus. Schulfreunde und Lehrlingskollegen fanden nichts dabei, das Neumannsche Haus mitunter auch in brauner oder schwarzer Uniform zu besuchen. SS-Leute brachten ihre Wagen zur Reparatur in jüdische Werkstätten, und in Frankfurt fanden öffentliche Boxturniere zwischen dem örtlichen Verein und dem jüdischen Boxclub „Maccabi“ statt.
Mit der Pogromnacht 1938 änderte sich das. Neumann wurde klar, dass es für einen jüdischen Ingenieur in Deutschland keine Zukunft gab. Er erfuhr, dass die chinesische Nationalregierung deutsche Techniker suchte. Inzwischen waren allerdings die Japaner in China eingefallen und hatten die Küstenregionen besetzt. Der neue chinesische Regierungssitz Chongqing im Landesinneren war schwierig zu erreichen. Unter Mühen bekam Neumann die nötigen Transitvisen für 16 Länder zusammen. Im Mai 1939 flog er von London aus in acht Tagen über Marseille, Tunis, Alexandria, Beirut, Basra, Karachi, Kalkutta, Bangkok und Saigon nach Hongkong. Doch dort saß er fest.
Alle Verbindungen nach Nationalchina waren auf japanischen Druck hin gekappt worden. Inzwischen brach der Krieg auch in Europa aus. Wie alle Deutschen in Hongkong wurde Neumann von den Briten interniert. Doch im Juni 1940 erreichte er durch ein glückliches Zusammentreffen mit einem US-Manager eine Freistellung. Seine neue Arbeitsstelle war Kunming, Hauptstadt der Südwestprovinz Yunnan, und sein neuer Arbeitgeber der amerikanische Chefberater Oberst Lee Chennault.
Neumann erledigte verschiedene Aufträge für die Amerikaner und eröffnete dann in Kunming eine Autowerkstatt. Sie lief hervorragend. Doch ein ruhiges Leben als Automechaniker in der chinesischen Provinz war ihm nicht beschieden. Am 9. Dezember 1941 griffen die Japaner Pearl Harbour an. Ein US-Jagdgeschwader wurde noch im Dezember nach China verlegt und Chennault unterstellt – die „Flying Tigers“. Neumann wurde als Flugzeugingenieur rekrutiert. Er war nun Sergeant der US-Army, zugleich staatenlos, „feindlicher Ausländer“ und ohne Pass.
Nach anfänglichen Erfolgen gegen die japanischen Bombergeschwader sahen sich die US-Piloten mit den neuen Zero-Jägern konfrontiert. Sie waren den amerikanischen Kampfflugzeugen überlegen. Ein Luftkampf mit einer Zero bedeutete oft das Todesurteil für den US-Piloten. Neumann, der mittlerweile als Chefingenieur die Flugzeugwartung mit 60 Mitarbeitern leitete, ließ Trümmerteile von abgestürzten Zero-Jägern aus ganz China zusammentragen. Es gelang ihm, die Teile zu einer flugfähigen Maschine zusammenzubauen und ihre Stärken und Schwächen zu testen. Die Zero war durch ihre Leichtbauweise extrem wendig, aber auch verwundbar. Ein einziger Treffer genügte oft zum Abschuss. Die Konsequenz war, Luftkämpfen fortan auszuweichen und das Flugzeug stattdessen aus weiter Entfernung im Sturzflug zu beschießen. Diese neue Taktik wendete das Blatt im Luftkrieg über China. Durch seinen Beitrag zum Erfolg und durch weitere Aktionen – so spionierte er, als chinesischer Kuli verkleidet, feindliche Flugfelder aus - wurde Neumann als "Herman the German" zur Legende unter den US-Piloten.
Nichtsdestotrotz bedurfte es eines Sondergesetzes durch den US-Kongress und der Unterschrift durch Präsident Truman, um ihm nach dem Krieg die Einbürgerung in den Vereinigten Staaten und den Erwerb einer Flugzeugmechanikerlizenz zu ermöglichen. Nach einem Aufenthalt in Shanghai und einer abenteuerlichen Rückreise durch halb Asien mit einem alten Militärjeep begann Neumann, inzwischen mit einer Amerikanerin verheiratet, eine neue Karriere als Triebwerkskonstrukteur bei General Electric in Massachusetts.
Zu diesem Zeitpunkt war GE einer der ersten Hersteller von Strahltriebwerken. Neumann stieg schnell in der Karriereleiter auf. Seine erste patentierte Erfindung waren verstellbare Leitschaufeln, die die Leistung der Triebwerke erhöhten und gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch senkten. In der Folge entwickelte er, nun Leiter des Geschäftsbereichs Strahltriebwerke, das Atomtriebwerk X-39 und das konventionelle Triebwerk J-79. Letzteres brach bei seiner Erprobung 1954 fünf Höhen- und Geschwindigkeitsrekorde und war für Jahrzehnte das zuverlässigste militärische Triebwerk, das auch von den anderen NATO-Streitkräften, Israel und Japan eingesetzt wurde.
1961 übernahm Neumann den gesamten Geschäftsbereich Flugantriebe und wurde 1963 schließlich Vizepräsident des GE-Konzerns. Er behielt diese Position bis zu seiner Pensionierung 1980. 1986 wurde er in der National Aviation Hall of Fame neben Charles Lindbergh und Neil Armstrong verewigt, 1987 mit der Ehrendoktorwürde seiner früheren Hochschule Mittweida ausgezeichnet. Das Luftfahrtmuseum im bayerischen Niederalteich wurde ihm zu Ehren Gerhard-Neumann-Museum benannt.
Erstmals sah er Frankfurt 1976 wieder. Sowohl die Fabrik seines Vaters in der Gubener Straße wie auch die elterliche Villa und sogar die Autowerkstatt seines ehemaligen Meisters Schroth hatten den Krieg überstanden. 1981 lud ihn die Volksrepublik China zu einem Besuch an den Stätten seiner Tätigkeit bei den Flying Tigers ein. So schloss sich der Kreis. Am 2. November 1997 ist Gerhard Neumann an Knochenmarkleukämie verstorben.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.