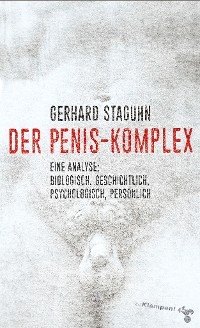Kitabı oku: «Der Penis-Komplex», sayfa 5
Und wie steht dieser David überhaupt da! Nun, er steht klassisch-griechisch da: im kokett-femininen Kontrapost, womit der harmonische Ausgleich zwischen Ruhe (des Standbeins) und Bewegung (des Spielbeins) gemeint ist – exakt jene Haltung, die für die griechischen und römischen Heroen-Statuen typisch ist. Doch in einer realen Kampfsituation wird sich kein Mensch so hinstellen.
Mit seinem David distanziert sich Michelangelo vom päderastischen Körperideal der alten Griechen, obwohl es vortrefflich zu einem Hirtenknaben passen würde. Doch er distanziert sich nicht mit letzter Konsequenz, eben weil er dem Knabenpenis treu bleibt und nur dem Skrotum und dem Schamhaar eine erwachsene Männlichkeit zugesteht. Nun kann man einwenden, dass auch so mancher erwachsene Mann einen knabenhaften Penis haben kann, der sich erst im Erigieren zu einem respektablen Mannsphallus auswächst. Dieser Einwand ist überzeugend, bekräftigt aber letztlich nur die These, dass wir es hier nicht mit dem biblischen Schafhirten David zu tun haben, sondern mit dem Mann an sich, und zwar in der vollen Blüte seiner Männlichkeit. Michelangelo hat sich für den kleinen Penis aus Gründen der klassisch-griechischen Ästhetik entschieden, vielleicht aber auch aus Gründen des christlichen Schamgebots. Immerhin sollte die Monumentalplastik auf dem belebten und repräsentativen Hauptplatz der Stadt Florenz aufgestellt werden. Seit dem Ende der Antike, das heißt seit über 1000 Jahren, wurde damit zum ersten Mal wieder eine monumentale Statue eines nackten Mannes auf einem öffentlichen Platz gezeigt – ein gewiss sehr heikles Unterfangen. Es heißt, dass es über die Jahrhunderte immer wieder zu Anschlägen, etwa Steinwürfen, gegen das Kunstwerk gekommen ist.
Tatsächlich verschwindet der ohnehin klein geratene Penis fast vollständig hinter dem Skrotum, sobald man als Betrachter direkt vor der Statue steht und von schräg unten, buchstäblich aus der Froschperspektive, auf sie blickt. In direkter Anschauung der David-Figur wird deren Männlichkeit weitaus stärker vom Skrotum und vom Schamhaar als vom Penis repräsentiert. Das Skrotum erscheint nicht als beutelartige, runzelige Hauttasche, sondern die Hoden sind von einer glatten, transparent wirkenden Haut überzogen, sodass sie fast wie bloßgelegt wirken und dadurch stärkste Präsenz erlangen. Davids ganzer Sexus steckt in diesen Hoden, während sich der zierliche Knabenpenis schamvoll dahinter versteckt.
Die Hoden, griechisch didimoi (Zwillinge), kokkoi (Beeren), kyamoi (Bohnen), orches (Oliven) oder sphairidia (Kügelchen), galten schon den alten Griechen als der eigentliche Sitz einer potenten erwachsenen Männlichkeit. Das bevorzugte Wort für ›männlich‹ war enorcha (hodig). »Der Same«, so meinte der antike, aus Griechenland stammende römische Arzt Galenos (129 – 199), »macht die Männer warm, gelenkig, haarig, tiefstimmig, hochgemut, stark im Denken und Handeln.« Das sind exakt die Eigenschaften, die Michelangelos David ausstrahlt – neben einigen anderen mehr. Davids Skrotum, nicht sein Penis, weisen ihn als ›ganzen Mann‹, als enorches aner, aus, wie die Griechen zu sagen pflegten: als ›Hodenmann‹. Und ein besonders potenter Mann wurde lapidorchas genannt: ›Hodenkönig‹. Einen solchen haben wir wahrhaftig in Michelangelos David vor Augen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Michelangelos David gleich in mehrfacher Hinsicht in sich widersprüchlich ist: Der Dargestellte ist ein Knabe (Lockenkopf, knabenhafter Penis), aber gleichzeitig ein erwachsener Mann (Schamhaar, Skrotum). Er ist ein antiker Heros (Nacktheit), aber ohne Heroen-Waffe; vielmehr trägt er die hinterhältige Waffe des Feiglings. Gleichzeitig ist er ein biblischer Schafhirte, aber ohne die typischen Attribute eines solchen. Der Dargestellte ist Jude (biblischer David), aber ebenso kein Jude (vorhandene Vorhaut). Das will alles nicht so recht zusammenpassen.
Ob Michelangelo mit seiner Skulptur wirklich den biblischen David gemeint hat, ist letztlich zweitrangig. Denkt man sich die überflüssige, weil antiheroische Schleuder weg, dann ist keine bestimmte Person mehr gemeint, sondern, wie schon gesagt, das Ideal der Männlichkeit. Das gilt nicht nur in körperlicher, sondern ebenso in geistiger Hinsicht. In Davids Gesicht spiegeln sich Mut, Willenskraft und Entschlossenheit; sie formen jene markanten Gesichtszüge, wie wir sie, grotesk überzeichnet und zur Maske erstarrt, in den faschistischen Kolossalplastiken wiederfinden. Dort verkehren sie sich in ihr Gegenteil und verweisen auf nichts anderes als männliche Impotenz, die kriegerisch kompensiert werden muss. Durch diesen leeren NS-Klassizismus, ja durch alle klassizistischen Nachahmungen, ist uns die Freude an Michelangelos monumentalem Meisterwerk tatsächlich ein wenig vergällt.
Nicht zuletzt gibt es noch ein Drittes, das, neben Gesicht und Skrotum, in besonderem Maß die Virilität der David-Figur bekundet und den Blick des Betrachters immer wieder auf sich zieht: die rechte Hand. Sie springt nicht nur wegen ihrer fast schon expressionistisch überzeichneten Größe ins Auge, sondern ebenso durch ihre eigenartig gekrümmte, dadurch einerseits gespannte, gleichzeitig aber auch lässige Haltung. Diese Hand ist auf fast schon magische Weise präsent: eine Hand, die ohne Geste auf eindringliche Weise gestisch wirkt. Als meisterhaft durchgearbeiteter Ausdrucksträger der Figur übertrifft sie in ihrer Intensität fast noch das Gesicht und tritt nicht nur in eine spannungsreiche Beziehung zu diesem, sondern viel mehr noch zum Penis. Dieser erscheint im Verhältnis zur Hand noch kleiner, als er eh schon ist. Man stelle sich nur vor, David würde mit dieser Riesenhand sein kleines Ding ergreifen! Es würde zwischen den großen Fingern nahezu verschwinden. Das Spannungsverhältnis zwischen Hand und Geschlecht wäre allerdings auch bei einer normal großen Hand gegeben, insofern die Hand als wichtiges ›Vollzugsorgan der Sexualität‹ eine besondere Beziehung zu den Genitalien hat: jene der Masturbation.
Doch um Masturbation geht es hier nicht. Vielmehr scheint sich die Libido, die Davids Knabenpenis entbehrt, in die Hand verschoben zu haben. Davids ganzer Eros steckt in dieser überdimensionierten rechten Hand; sie ist sein erotischster Körperteil. Sie verkörpert den männlichen Eros, den Davids enterotisierter und dadurch gelähmter Penis nicht haben darf. In dem Maße, wie sich der dem Penis abhanden gekommene Eros auf Davids rechte Hand verschoben hat, verschiebt sich auch das erotische Interesse des Betrachters auf diese Hand, die in ihrer Übergröße und Angespanntheit tatsächlich etwas Erigierendes an sich hat. Die Hand, so könnte man sagen, erigiert stellvertretend für den Penis, der nicht erigieren darf, vielleicht auch gar nicht dazu fähig ist. In dieser Hand konzentriert sich alle sublimierte Libido. Sie ist die schöpferisch erregte Hand des Künstlers, konkret: die Hand Michelangelos, die auf geniale Weise befähigt ist, den Trieb zu sublimieren und in unsterbliche Kunst zu verwandeln.
Und nun stelle man sich, um zum Anfang dieses Kapitels zurückzukehren, das Unvorstellbare vor: Dieser David präsentierte uns eine formvollendete, von Michelangelo meisterhaft ausgearbeitete Erektion! Von einer Sekunde zur nächsten würde die Statue den Schritt vom Erhabenen ins Lächerliche vollziehen – und das, obwohl der ideal gestaltete Phallus, für sich genommen, nichts Lächerliches an sich hätte. Doch es bliebe nicht bei der Komik, die genau genommen eine Situationskomik wäre. In diese mischte sich ein Erschrecken über die rohe Triebseite des Mannes, die sich mit der idealisierten, triebfernen Schönheit des Dargestellten nicht in Einklang bringen ließe. Der Phallus machte auf drastische Weise das Tier sichtbar, das der Mensch, bei aller Ebenbildlichkeit mit Gott, eben auch ist – aber nicht sein will.
Und so kommt endlich die These, die längst im Raum steht: Michelangelos David ist gar nicht David. Aber wer ist er dann? Der soeben verwendete Begriff der ›Ebenbildlichkeit‹ liefert uns eine mögliche Antwort: Vor uns steht Adam, der Ur-Mensch in seiner gottgleichen Riesenhaftigkeit. (Zu diesem passte, nebenbei bemerkt, auch der Stein als Waffe; er war die Distanzwaffe des Urzeit-Menschen.) Vor uns steht der gottgleiche Adam vor dem Sündenfall, der noch keine Eva hat und noch ganz dem Schöpfer gehört, dessen erster Sohn und Geliebter er ist.
Aber er ist noch mehr. Er ist auch Michelangelos Sohn und Geliebter. In seinem David, diesem Adam ohne Eva, kommt Michelangelos eigene Homosexualität zum Tragen, nicht anders als in seinem berühmten Sixtinischen Bildnis von der Erschaffung Adams mit den symbolträchtig sich berührenden Fingern, mit denen symbolhaft die Penisse gemeint sind. Mit seinem David schlägt Michelangelo, über die formale, klassisch-antike Ästhetik der Figur hinaus, den Bogen zur päderastischen Homosexualität der Griechen, die deren plastische Kunst so stark geprägt hat. In der antiken griechischen Homosexualität, so meinte der Psychoanalytiker Otto Rank (1884 – 1939), kommt »die Hochschätzung nicht so sehr der Sexualität, als ihres Produkts, des Sohnes, zum Ausdruck, in dem das eigene Ich und die eigene Seele weiterlebte […] das lebendige Abbild seiner eigenen Seele, die in einem möglichst körpergleichen (oder idealisierten) Ich materialisiert erscheint«. Auch Gott schuf sich in Adam kein rein geistiges Ebenbild. Vielmehr stellt Adam, dieser leibliche Sohn Gottes, eine ebenbildliche Widergeburt Gottes als rein ›körperliches Ich‹ dar. Und dieses ist ausschließlich im gleichen Geschlecht zu finden, das bei einem männlichen Gott nun mal das männliche ist.
Wenn Michelangelos David in Wirklichkeit Adam ist, dann schlüpft der geniale Künstler wie von selbst in die Rolle des Schöpfergottes. Der künstlerische ›Schöpfer-Gott‹ Michelangelo hat sich in der Kolossalstatue des David ein vollkommenes, individualisiertes Unsterblichkeitssymbol geschaffen. Für einen göttlich-genialen Künstler wie ihn ist die Homosexualität, wie bei den antiken Griechen auch, keine bloße Sache der Geschlechtlichkeit, sondern ein Bemühen um die Schaffung der eigenen Wiedergeburt als idealisiertes menschliches Ich. Und dieses Ideal ist der Sohn als Geliebter. Diesen geliebten ebenbildlichen Sohn, und niemand anderen, suchten die Griechen unbewusst in ihrer Knabenliebe. Der biblische David, »bräunlich, mit schönen Augen und guter Gestalt« ist dieser Sohn und Geliebte, den Michelangelo eigentlich meint. Aber er muss ihn, wie Gott, als ganzen Mann, als Adam gestalten, genauer: als heroischen Adam und Ebenbild Gottes. Hierfür hatten die Griechen die Bezeichnung Heros theos (Gottheros). Adam ist nicht nur der gottgleiche erste Mensch, sondern ebenso der erste Held – freilich ein tragischer, wie alle echten Helden. Denn Adam, und darin liegt seine Tragik, ist nicht nur idealer Gottheros, sondern ebenso das triebhafte Menschtier. Aus diesem Gegensatz erwächst das ganze Heroismusproblem des menschlichen Daseins: dieses ewige Scheitern an der Welt und an sich selber.
Um am Ende auf die oben imaginierte Erektion des David/Adam zurückzukommen: Wer genau hinsieht, wird mit etwas Fantasie zu Füßen der Figur eine Art von stellvertretender Erektion entdecken, jenen phallisch aufragenden, die Figur abstützenden Baumstrunk hinter Davids Standbein. Diese symbolische Erektion steht in einem deutlichen homosexuellen Bezug zu David/Adam, indem sie ganz unverhohlen auf sein Gesäß gerichtet ist. David/Adam müsste nur in die Hocke gehen – und schon wär’s passiert!
Und wer sehr genau hinsieht, wird in diesem Stellvertreter-Phallus sogar eine kleine, gleichsam aus der homosexuellen Verdrängung zurückkehrende Vulva entdecken.
Fünftes Kapitel
Doktorspiele
Es ist ja keineswegs so, dass man als männlicher Mensch erst mit Beginn der Pubertät ein Interesse für seinen Penis entwickeln würde – und als weiblicher Mensch für seine Vulva. Da man kaum Erinnerungen an die eigenen frühkindlichen Sexualaktivitäten hat, ist man geneigt, seine ersten Lebensjahre für asexuell zu halten. Seit Freuds bahnbrechender Erforschung der menschlichen Sexualität wissen wir, dass der Mensch von Geburt an – ja sogar schon im Uterus – ein sexuelles Wesen ist und somit auch Sex hat. Er hat ihn vor allem mit seiner Mutter, an deren nährender Brust er saugt. Das Saugen ist mit oralsexueller Lust verbunden. Auf dezente Weise hat der neugeborene Mensch aber auch Sex mit dem Vater – vorausgesetzt, dieser ist geneigt, sein Kind zu streicheln und zu liebkosen. Denn auch die Haut ist ein veritables Sexualorgan, vielleicht sogar das wichtigste von allen. Und nicht zuletzt, sondern vor allem, haben Kinder Sex mit sich selbst.
Bei der kindlichen Autosexualität spielen Fantasien eine zentrale Rolle. Sie machen sogar den Großteil der frühkindlichen Sexualität aus, wie Freud nachweisen konnte: Die ursprüngliche Aktivität der kindlichen ›Sexualorganisation‹ ist symbolischer Natur. Damit war eine der wichtigsten Entdeckungen der Psychoanalyse gemacht: Die menschliche Sexualität ist etwas, das sich nicht nur im Körper und mit dem Körper, sondern vor allem im Kopf abspielt. Und so wird die Fantasie zum entscheidenden Schlüssel für das Verständnis von Neurosen, deren Wurzeln zumeist in der frühen Kindheit liegen.
Die Ursache der Neurose besteht weniger in der Verdrängung von tatsächlichen sexuellen Ereignissen in der frühen Kindheit, als vielmehr in der Verdrängung sexueller Fantasien des Kindes. Bei den frühkindlichen sexuellen Fantasien handelt es sich zumeist um höchst komplizierte Szenerien der Verführung durch den Vater oder die Mutter, wobei sich oftmals Wunsch- und Angstvorstellungen miteinander vermischen. Diese beherrschen das Leben des kleinen Kindes und können bis ins Erwachsenenalter, etwa in Gestalt von Missbrauchs-Fantasien, wirksam bleiben. Frühkindliche inzestuöse Wunschbilder können so intensiv sein, dass der erwachsene Mensch sie in seiner Erinnerung für real geschehene Erlebnisse hält.
Die frühkindlichen sexuellen Fantasien der Verführung gehen oft mit Manipulationen an den eigenen Genitalien einher. Kinder onanieren von klein auf. Selbstbefriedigung ist subjektiv nicht nur angenehm und beruhigend, sondern objektiv wichtig für die Entwicklung einer ›normalen‹, oder sagen wir besser: ›normal‹ Sexualität, wie die meisten von uns sie leben, die eigentlich auch neurotisch ist. Wer aufgrund rigider Verbote und Bestrafungen durch Eltern oder Erzieher in seiner Kindheit nicht oder nur mit schweren Schuldgefühlen masturbiert hat, dem wird es als Erwachsenem schwer fallen, im ›normal-neurotischen‹, also nicht perversen Geschlechtsakt mit einem anderen Menschen Befriedigung zu finden.
Dass man schon vor den wissenschaftlichen Entdeckungen Sigmund Freuds von den Masturbationsaktivitäten des Kindes wusste, beweisen die massiven, geradezu sadistischen Praktiken, mit denen sie dereinst bekämpft wurden. Dass man dabei die Masturbation der Knaben viel strenger sanktionierte als die der Mädchen, versteht sich von selbst: Die der Mädchen wurde meistens übersehen, da sie naturgemäß weniger auffällt. Doch selbst wenn man sie wahrnahm, wurde sie ignoriert – und zwar in dem Maße, wie man die weibliche Sexualität aus patriarchalischer Sicht für nicht so wichtig und erst recht nicht als gleichwertig ansah. In Entsprechung hierzu wurde auch die männliche Homosexualität rigoros verfolgt, während man um die weibliche nicht viel Aufhebens machte.
Gegen die Onanie der Knaben wurde bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein in der Art von Teufelsaustreibungen vorgegangen. Vor allem in den bürgerlichen, religiös geprägten Schichten herrschte ein moralischer Horror vor der kindlichen Sexualität. Es gab vielfältige Onanieverhinderungs-Konstruktionen, angefangen bei extra langen Nachthemden, die unterhalb der Füße zusammengebunden wurden. Freilich konnte der Knabe seine Genitalien durch den Hemdstoff hindurch berühren, weshalb es naheliegend erschien, ihm auch noch die Hände am Bettgestell festzubinden. Sogar Zwangsjacken, wie man sie in psychiatrischen Anstalten einsetzte, wurden den Jungen zum Schlafen angelegt.
Eine Kindheit ohne Kastration
Derartige Folterwerkzeuge zur Onanieaustreibung blieben mir erspart, selbst in den verklemmten, noch schwer vom NS gezeichneten fünziger Jahren, in die ich hineingeboren wurde. Ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwelche Probleme im Zusammenhang mit meinem sich versteifenden Kinderpenis gegeben hätte. Kastrationsdrohungen, in welcher Form auch immer, wurden – zumindest in meiner Erinnerung – nicht ausgesprochen.
Zum Komplex meiner kindlichen Onanie hat sich eine einzige Szene, die den Charakter und die Qualität einer Freud’schen Urszene hat, in erstaunlich klaren Bildern in meinem Gedächtnis aufbewahrt, freilich unter der Voraussetzung, dass man den Erinnerungen aus früher Kindheit nicht unbedingt trauen kann: Ich bin wohl um die fünf Jahre alt und liege nachts allein im Ehebett der Eltern – auf der Mutterseite, wie man sich denken kann. Diese Seite bevorzuge ich allein schon wegen des angenehmen Geruchs, den sie, im Gegensatz zur Vaterseite, verströmt: ein verführerischer, geradezu himmlischer ›Rundum-Geborgenheits-Geruch‹. Ich spiele mit meinem steifen Penis, bis dieser sich irgendwann derart mit der Schlafanzughose verheddert, dass ich das buchstäbliche ›Gewurschtel‹ nicht mehr zu entwirren vermag, beziehungsweise mir einrede, es nicht mehr entwirren zu können. Denn tatsächlich will ich es gar nicht entwirren. So habe ich einen willkommenen Grund, nach der Mutter zu rufen. Sie eilt auch sofort herbei und versucht, das echte oder wahrscheinlich nur vorgetäuschte Durcheinander zwischen meinen Beinen in Ordnung zu bringen. Dabei bekommt sie zwangsläufig meinen steifen Penis zu Gesicht, muss ihn vielleicht sogar anfassen. Mir ist das nur recht, mehr noch: Es ist das verborgene Motiv meiner Aktion. Aber was heißt schon ›verborgen‹! Es könnte offensichtlicher kaum sein. Nicht die geringste Spur einer Peinlichkeit oder Beschämung trübt meine Erinnerung an diese objektiv peinliche Situation.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es, bewusst oder unbewusst, darauf angelegt hatte, die Mutter zu mir und meiner Knabenerektion ans Bett, beziehungsweise ins Bett zu locken – ein klarer Fall von ödipaler Verführungssituation, wie sie typisch ist für die phallische Phase der kindlichen Libido-Entwicklung: Ich nötige die Mutter, unter Vortäuschung eines Problems mit der Schlafanzughose, an meinem steifen Penis herumzumachen und ihn dabei anzuschauen. Auf ziemlich raffinierte Weise mache ich mich zu ihrem Verführer und Liebhaber, noch dazu – wie symbolträchtig! – im elterlichen Ehebett. Dessen für mich unangenehm riechende Vaterseite – die Seite des Geschlechtsrivalen, den ich nicht ›riechen‹ kann, – ist verwaist. Der Vater ist nicht da, soll heißen: Er ist nicht mehr da. Ich habe ihn beseitigt. Der abwesende, unbewusst von mir beseitigte Vater steht meinem Wunsch nach körperlichem Besitz der Mutter nicht mehr im Weg. Und dieser Besitz geschieht in gewisser Weise ja auch – sogar mit einer leibhaftigen Erektion im Zentrum des Geschehens. Ich weiß noch, dass ich, als die Mutter wieder fort war, äußerst zufrieden mit mir war. Wenigstens für kurz war ich der Mann meiner Mutter gewesen.
Wer weiß, ob meine Mutter die nicht zu übersehende sexuelle Erregung ihres fünfjährigen Sohnes als den Versuch einer Verführung verstanden hat. Wahrscheinlich nicht. Es war zwar nur ein kindlicher, doch keineswegs unschuldiger Versuch. Denn ab einem gewissen Alter ist es mit der sexuellen Unschuld des Kindes vorbei. Jedenfalls wurde mir nach dieser unterschwellig inzestuösen Urszene die manuelle Beschäftigung mit meinem ›Pfeiferl‹, wie die Mutter das kleine Ding auf gut-bairische Art zu nennen pflegte, nicht verboten. Nicht die Spur einer Kastrationsdrohung! Und so blieb mir ein kindliches Sexualtrauma erspart, das geeignet ist, nicht nur die Beziehung zu den Eltern massiv zu stören, sondern in den späteren sexuellen Beziehungen zum anderen oder eigenen Geschlecht mannigfaltige Probleme zu schaffen. Da keine Kastrationsdrohung ausgesprochen wurde, blieb ich logischerweise vom Kastrationskomplex verschont. Und so bin ich legitimiert, grundsätzliche Zweifel an Freuds pauschaler Annahme eines geradezu schicksalhaften, einen jeden betreffenden Urkomplexes anzumelden.
Freilich haben vor mir schon andere und wesentlich kompetentere Leute solche Zweifel geäußert. Es ist gewiss richtig, dass jeder kleine Junge lustvoll an seinem Schwänzchen herumspielt. Aber nicht jeder kleine Junge wird dabei entdeckt oder wünscht sich, wie in meinem Fall, nichts sehnlicher, als von der Mutter entdeckt zu werden, um sich bei dieser Gelegenheit als ihr Liebhaber anzudienen. Selbst wenn er entdeckt wird, so muss nicht automatisch die fatale Drohung ausgesprochen werden, ihm zur Strafe seinen Penis abzuschneiden, falls man ihn noch einmal dabei erwischen sollte. Aus dieser elterlichen Drohung, die nach Freud jeder Knabe früher oder später erfahre und die im Wesentlichen eine väterliche Drohung sei, entstehe eine lebenslange Kastrationsangst, die das Sexualleben aller Männer maßgeblich präge. Damit machte Freud aus einer zufälligen katastrophalen Erfahrung eine allgemeine – und diese müsse von jedem Knaben auf dieser Welt und zu allen Zeiten mit zwingender Notwendigkeit gemacht werden.
Vermutlich war die Kastrationsdrohung zu Freuds Zeiten für sehr viele Knaben tatsächlich eine reale traumatische Erfahrung. Freud unterlief nur der Fehler, daraus eine Art von universalem Naturgesetz zu formulieren, das ausnahmslos für jede männliche Biografie in allen Kulturen gültig sei. Freuds fragwürdige These wird nicht dadurch überzeugender, dass er auch die Mädchen dem Kastrationskomplex unterwirft. Die kleinen Mädchen, so Freud, seien in der kindlichen Vorstellung ja gerade der augenscheinliche Beweis, dass die Kastration nicht nur als Drohung ausgesprochen, sondern auch ausgeführt wird. Die Mädchen haben keinen Penis, was in der kindlichen Vorstellung nur bedeuten könne, dass er ihnen abgeschnitten wurde. Daraus folgt, dass der Kastrationskomplex nicht nur Knaben, sondern auch Mädchen betrifft, zumindest von dem Moment an, da sie zum ersten Mal bei einem nackten Jungen den Penis sehen, den sie selber nicht haben, genauer: nicht mehr haben. Und der Junge sieht am nackten Mädchen die Kastrationsdrohung der Eltern augenscheinlich bestätigt, weil sie offensichtlich an einem Anderen bereits in die Tat umgesetzt wurde. Die weiblichen Genitalien würden somit in den Augen des Kindes die Realität der Kastration bezeugen. Das heißt: Mädchen sind – in den Augen des Kindes – auch nur Knaben, allerdings solche, denen der Penis bereits abgeschnitten wurde.
Überzeugend ist das nicht. Die Argumentation Freuds wirkt, bei aller innerpsychoanalytischen Plausibilität, irgendwie bemüht und vordergründig – zumindest aus heutiger Sicht. Wer droht heutzutage einem kleinen Jungen noch mit Kastration, wenn er beim Herumfingern an seinem Penis beobachtet wird! In der verklemmten großbürgerlichen Welt des ausgehenden 19. Jahrhunderts, in der Freud die Grundlagen seiner Theorie entwickelt hat, war das bedrohliche Kastrationsszenario wahrscheinlich allgegenwärtig. Hätte Freud im Arbeiter- oder Bauernmilieu geforscht, dann wäre seine Theorie wahrscheinlich in mancher Hinsicht anders ausgefallen.
Allein unter einer allgegenwärtigen Kastrationsdrohung erscheint überhaupt das grundlegende psychoanalytische Argument plausibel, das da lautet: Wenn der Knabe einmal zur Kenntnis genommen hat, dass es menschliche Wesen gibt, die keinen Penis besitzen, dann erscheint ihm dieses Organ als etwas, das vom Körper entfernt werden kann. An so etwas denkt das Kind aber nur, wenn es die Kastrationsdrohung im Kopf hat. Ohne diese Drohung erscheint der Unterschied einfach als etwas, das naturgemäß so gegeben ist. Schließlich nimmt das Kind auch wahr, dass es menschliche Wesen gibt, die Brüste haben, und andere, die keine haben. Entsprechend wäre auch die weibliche Brust etwas, das vom Körper entfernt werden könnte. Männer wären demnach Frauen, denen die Brüste, freilich nicht die Brustwarzen, abgeschnitten worden sind.
In heutigen Durchschnittsfamilien, ebenso in Kindergärten und Schulen, wird den Kindern deutlich vor Augen geführt, dass es von Natur aus – und nicht wegen Kastration – zwei Geschlechter gibt und nicht nur eines. Die Kinder erleben von klein auf, dass Mädchen und Frauen etwas Eigenes sind und nicht bloß kastrierte Knaben und Männer. Wenn bereits kleine Kinder, wie Freud überzeugend nachweist, um die eigene Sexualität und die der Eltern ›wissen‹, dann ›wissen‹ sie logischerweise auch, dass es von Haus aus zwei Geschlechter gibt – und vermutlich ahnen sie sogar, wozu! Nur so hat es einen Sinn, dass der kleine Junge insgeheim die Mutter begehrt und mit seinen kindlichen Mitteln zu verführen versucht – und das kleine Mädchen den Vater.
Wie man weiß, sehen Kinder sehr genau hin. Sie sehen, dass Mädchen – eben weil es Mädchen sind und nicht bloß kastrierte Jungs – anstelle des Würstchens nicht nur etwas quantitativ Anderes – etwas Fehlendes – haben, sondern etwas qualitativ Anderes, das entfernt einem geschlitzten Semmelchen ähnelt. In meiner bayerischen Heimat wird diese weiche, geschlitzte, inzwischen von Bäckern kaum noch angebotene Semmelart Eiweckerl genannt. Der Anblick jenes ›Eiweckerls‹, das kleine Mädchen zwischen den Beinen haben, war mir als kleiner Junge ganz vertraut, denn ich hatte das Glück, mit fünf Jahren ein Schwesterchen zu bekommen. Mangels erlebter Kastrationsdrohung kam ich gar nicht auf den Gedanken, dass man meiner kleinen Schwester zur Strafe den Penis abgeschnitten haben könnte. Schließlich war sie ja mit diesem ›Eiweckerl‹ zur Welt gekommen, wie ich mit den wachen Augen eines Fünfjährigen sofort festgestellt hatte. Sie, die als Er zur Welt gekommen wäre, hätte unsinnigerweise gleich nach der Geburt die Kastration erlitten. Aber wofür?
Das ›Eiweckerl‹ meiner kleinen Schwester war für mich die Bestätigung dessen, was ich eh schon wusste: dass es zwei ›Sorten‹ von Menschen gibt, nämlich männliche und weibliche. Zudem sah das ›Eiweckerl‹ meiner Schwester überhaupt nicht wie eine frische, ja nicht mal wie eine vernarbte Wunde aus. Wunden, auch vernarbte, sind hässlich. Doch das ›Eiweckerl‹ meiner Schwester war alles andere als hässlich; ich fand es hübsch, wohlgeformt und, wie die echten Eiweckerl beim Bäcker, irgendwie zum Reinbeißen. Ich empfand keinen »Schrecken über die verstümmelte Kreatur«, wie Freud ihn unterstellt, weil da nichts nach Verstümmelung aussah.
Es mag ja sein, dass die Entdeckung des Geschlechtsunterschieds bei Kindern auch heute noch einen gewissen natürlichen Schrecken hervorruft, aber es ist gewiss kein Schrecken über eine angenommene grausam vollzogene Verstümmelung durch die geliebten Eltern. Vielmehr könnte man als Kind über das existenzielle Faktum erschrecken, dass man genauso gut mit dem anderen Geschlecht hätte zur Welt kommen können. Der Schrecken, oder besser: die Irritation, läge dann in der Entdeckung der Zufälligkeit unserer geschlechtlichen Bestimmung und damit unserer ganzen Person und Existenz. Man ist ein Junge, könnte aber genauso gut ein Mädchen sein, vielleicht sogar beides zugleich. Damit fehlt uns eine grundlegende Freiheit: sexuell der zu sein, der wir sein wollen. Doch dieses Erschrecken über die Zufälligkeit unseres Geschlechts hält sich naturgemäß in Grenzen. Denn was wäre eigentlich schlimm daran, dem anderen Geschlecht anzugehören! Nichts. Und weil das so ist, übernimmt so mancher kleine Junge in den Spielen der Kindheit auch gern mal die Rolle des Mädchens – und umgekehrt –, allein zu dem Zweck, sich ein wenig in das andere Geschlecht hineinzufühlen, das man selber entbehrt. Darin erweist sich weniger ein Geschlechter-Erschrecken als vielmehr eine Geschlechter-Faszination.
Weniger ist manchmal mehr
Es kann ja sein, dass so manches kleine Mädchen auch gerne ein Penis-Würstchen hätte, mit dem man so frech wie zielsicher in der Gegend herumpinkeln kann. Womit wir beim Penisneid, dieser anderen fragwürdigen Theorie Sigmund Freuds, angelangt wären. Zu fragen ist, ob es für ein kleines Mädchen wirklich triftige Gründe gibt, auf den Penis des Knaben neidisch zu sein. Beim Pinkeln den Harnstrahl lenken zu können, reicht für ein massives, die Seele belastendes Neidgefühl wohl kaum aus. So wichtig ist das Wasserlassen nun auch wieder nicht. Darüber hinaus besitzt der Penis eines kleinen Jungen keine weiteren Qualitäten, für die es sich lohnte, Neid zu entwickeln.
Freuds grundlegender Gedankenfehler besteht, wie schon gesagt, darin, die Vulva als ein Organ zu betrachten, dem wegen imaginärer Verstümmelung etwas fehlt. Tatsächlich aber fehlt einer Vulva nichts. Sie ist so perfekt wie der Penis; sie hat bei genauer Betrachtung sogar mehr zu bieten als dieser. Die Vulva als ein ›Organ des Fehlens« – und damit als etwas Mangelhaftes – zu betrachten, ist einem typisch patriarchalischen, auf den Penis fixierten Blick geschuldet. Ihn pflegten schon die alten Griechen. Sie sahen in der Vulva eine offene, zu allem Übel auch noch regelmäßig blutende Wunde. Diese wird, wie schon erwähnt, vom Mann bei jedem Koitus auf paradoxe Weise nicht nur aufgerissen, sondern der Frau im ›Liebeskampf‹ ein jedes Mal neu zugefügt.
Darüber hinaus reproduzierte Freud mit seiner Theorie des Penisneids auch noch den patriarchalisch-biblischen Mythos von der Frau als unvollkommenem Adam. Ihr fehlt nicht nur der Penis, sondern mit diesem auch ein Begehren, das einzig als ein phallisches denkbar erscheint. Oder mit den Worten der Philosophin Svenja Flaßpöhler: »So unmöglich ist die sexuell begehrende Frau gesellschaftlich gesehen, dass ihr von einem kulturgeschichtlich wirkmächtigen Diskurs, der Psychoanalyse, jede eigene sexuelle Position abgesprochen wird. ›La femme n’existe pas‹, behauptete Jacques Lacan: Die Frau gibt es nicht. Das weibliche Geschlecht ist das Abwesende, ein furchterregendes und peinliches Fehl. Die Frau hat ein Nichts zwischen den Beinen, aus dem nichts folgt, weder ein eigenes Begehren noch eine eigene Subjektivität. Bezugspunkt für die Frau ist somit auf ewig der Phallus. Ihre angestammte Position ist eine rein auf den Phallus bezogene […].« (Süddeutsche Zeitung vom 21. 6. 2016)
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.