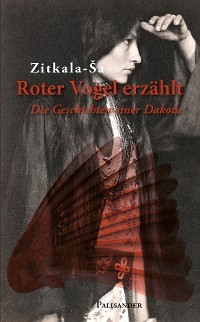Kitabı oku: «Roter Vogel erzählt», sayfa 3
Schultage eines Indianermädchens
I – Das Land der roten Äpfel
Wir waren zu acht in unserem Trupp brauner Kinder, die mit den Missionaren nach Osten reisten. Drei von uns waren junge Burschen, zwei waren große Mädchen und wir drei, Judéwin, Thowin und ich, waren die Kleinen.
Wir warteten voll Ungeduld, dass die Reise in das Land der roten Äpfel endlich begann. Dieses Land, so wurde uns gesagt, lag ein Stück hinter dem großen, runden Horizont der westlichen Prärie. Wir träumten davon, wie wir unter einem Himmel von der Farbe rosiger Äpfel genauso umherstreifen würden, so frei und glücklich, wie wir den Schatten der Wolken in den Prärien der Dakota nachgejagt waren. Wir hatten viel Spaß daran gehabt, uns vorzustellen, auf dem Eisenross zu reiten, aber das Gewimmel uns anstarrender Bleichgesichter verwirrte und beunruhigte uns.
Im Zug hielten die blonden Frauen, die in jedem Arm ein Baby wiegten, inne und musterten die Kinder, die ohne ihre Mütter reisten. Große Männer mit schwerem Gepäck in den Händen blieben in der Nähe stehen und hefteten ihre glasblauen Augen auf uns.
Ich sank tief in die Ecke meines Sitzes, weil es mich störte, beobachtet zu werden. Direkt vor mir hängten sich Kinder, die nicht größer waren als ich, über ihre Sitzlehnen und richteten ihre kecken weißen Gesichter auf mich. Von Zeit zu Zeit nahmen sie ihre Zeigefinger aus dem Mund und zeigten auf meine in Mokassins steckenden Füße. Ihre Mütter, anstatt sie für diese unverhohlene Neugierde zu tadeln, betrachten mich eingehend und machten ihre Kinder auf meine Decke aufmerksam. Ich schämte mich, und mir war nach Weinen zumute.
Ich saß vollkommen still, die Augen zu Boden gerichtet, und wagte nur gelegentlich, mich umzuschauen. Ich traute mich endlich, zum Fenster zu blicken, und es verschlug mir den Atem, als ich etwas Wohlvertrautes erblickte. Es waren die Telegraphenmasten, die in kurzen Abständen vorüberglitten. Ganz in der Nähe der Hütte meiner Mutter, entlang einer Straße, die dicht von wilden Sonnenblumen gesäumt war, hatten weiße Männer solche Masten aufgestellt. Wenn ich diese Straße entlangging, hatte ich oft angehalten, um mein Ohr an einen Mast zu pressen und sein leises Ächzen zu vernehmen. Ich hatte mich gefragt, was die Bleichgesichter getan hatten, um ihn zu quälen. Jetzt saß ich da und betrachtete jeden Masten, der vorüberglitt und wartete auf den letzten von ihnen.
Auf diese Weise hatte ich meine unangenehme Umgebung schon ganz vergessen, als ich plötzlich einen meiner Kameraden meinen Namen rufen hörte. Der Missionar stand bei uns und warf uns Süßigkeiten und Kaugummis zu. Das machte uns großen Spaß, und wir wetteiferten darum, wer von uns wohl die meisten Bonbons fangen konnte.
Obgleich wir mehrere Tage lang im Innern des Eisenrosses reisten, entsinne ich mich keiner der Mahlzeiten mehr.
Es war Nacht, als wir auf dem Schulgelände anlangten. Das Licht aus den Fenstern fiel auf einige mit Eiszapfen behangene Bäume, die unter ihnen standen. Wir wurden zu einer offenen Tür geleitet, von wo helles Licht über die Köpfe der aufgeregten Bleichgesichter, die uns den Weg versperrten, hinwegschien. Mein Körper zitterte mehr vor Furcht als vor Kälte, während ich durch den Schnee trottete.
Nachdem ich das Haus betreten hatte, stellte ich mich dicht vor die Wand. Das starke, grelle Licht in dem großen, weißgetünchten Raum blendete meine Augen. Das Geräusch von harten Schuhen, die über Holzfußböden eilten, verstärkte das Schwirren in meinen Ohren. Ganz nah an der Wand zu bleiben schien das einzige zu sein, was mir ein Gefühl von Sicherheit vermitteln konnte. Während ich darüber nachsann, in welche Richtung ich all dieser Verwirrung entkommen könnte, ergriffen mich plötzlich zwei feste, warme Hände, und ich wurde hochgehoben und in die Luft geworfen. Die Bleichgesicht-Frau mit rosigen Wangen fing mich wieder auf. Ich war zugleich verängstigt und beleidigt von dieser Neckerei. Ich starrte ihr in die Augen und wünschte mir, dass sie mich wieder auf die Füße stellte, aber mit wachsender Begeisterung warf sie mich immer wieder in die Höhe und fing mich wieder auf. Meine Mutter hatte nie ein Spielzeug aus ihrer kleinen Tochter gemacht. Als ich daran dachte, begann ich laut zu weinen.
Man missverstand die Ursache meiner Tränen und setzte mich an einen weißen Tisch voll Essen. Unsere Gruppe war wieder beieinander. Als ich nicht aufhören wollte zu weinen, flüsterte mir einer von den älteren zu: »Warte damit, bis du nachts allein bist.«
Ich konnte an diesem Abend nur sehr wenig herunterbekommen zwischen all meinen Schluchzern.
Ich klagte: »Ach, ich möchte zu meiner Mutter und meinem Bruder Dawée! Ich möchte zu meiner Tante!« Aber die Ohren der Bleichgesichter konnten mich nicht hören.
Vom Tisch wurden wir einen schräg nach oben führenden Weg aus Holzkästen geführt, den ich später als Treppe zu bezeichnen lernte. An seinem oberen Ende befand sich ein ruhiger Saal, der nur schwach erhellt war. Die ganze Wand entlang standen in gerader Linie viele schmale Betten. In ihnen lagen schlafende braune Gesichter, die aus den Decken hervorlugten. Ich wurde zusammen mit einem von den großen Mädchen in einem Bett verstaut, weil sie meine Muttersprache verstand und mich zu trösten schien.
Ich war im wunderbaren Land des Rosenhimmels angekommen, aber ich war nicht glücklich, wie ich es mir erträumt hatte. Die lange Reise und all die verwirrenden Dinge, die ich gesehen hatte, hatten mich erschöpft. Ich schlief ein, unter müden Schluchzern, die tief aus mir hervorstiegen. Meine Tränen mussten von allein trocknen und bildeten helle Streifen auf meiner Haut, da weder meine Tante noch meine Mutter in der Nähe waren, um sie mir abzuwischen.
II – Mein langes Haar wird geschnitten
Der erste Tag im Land der Äpfel war ein bitter kalter. Draußen lag noch immer Schnee, und die Bäume waren kahl. Eine große Glocke läutete zum Frühstück, ihre laute Metallstimme schmetterte hoch vom Glockenturm herab in unsere empfindlichen Ohren. Das unangenehme Geklapper von Schuhen auf blankem Holzfußboden ließ uns keine Ruhe. Das ständige Aufeinanderprallen greller Geräusche, unterlegt von einem Gemurmel aus vielen Stimmen in einer Sprache, die ich nicht verstand, schuf ein wahres Tollhaus, in dem ich mich fest angebunden fühlte. Mein Geist riss sich selbst in Stücke in seinem Ringen um die verlorene Freiheit, aber es war vergebens.
Eine Bleichgesicht-Frau mit weißem Haar kam zu uns. Wir mussten uns einer Reihe von Mädchen anschließen, die in den Speisesaal gingen. Es waren Indianermädchen mit steifen Schuhen an den Füßen. Sie trugen enganliegende Kleider und Schürzen mit Ärmeln. Ihr Haar war kurz geschnitten. Während ich geräuschlos in meinen weichen Mokassins ging, wäre ich am liebsten vor Scham im Boden versunken, denn man hatte mir meine Decke von den Schultern genommen. Ich sah mir die Indianermädchen aufmerksam an, die sich nicht darum zu kümmern schienen, dass sie sogar noch unanständiger gekleidet waren als ich in ihrer eng sitzenden Kleidung. Als wir in den Saal gelangten, kamen die Jungen durch eine gegenüberliegende Tür herein. Ich hielt Ausschau nach den drei jungen Burschen, die mit unserer Gruppe gekommen waren. Ich erspähte sie in den hinteren Reihen, und sie schienen sich genauso unbehaglich wie ich zu fühlen.
Jemand schlug eine kleine Glocke an, und jeder der Schüler zog einen Stuhl unter dem Tisch hervor. In der Annahme, dass dies dazu gedacht war, sich hinzusetzen, zog ich meinen auch heraus und schwang mich sogleich von der Seite hoch auf den Sitz. Aber als ich mich umschaute, bemerkte ich, dass ich die einzige war, die saß, alle anderen an unserem Tisch standen noch immer. Gerade, als ich wieder heruntergeglitten war und mich scheu umblickte, um herauszufinden, wie man Stühle benutzen musste, erklang ein zweiter Glockenschlag. Alle setzten sich, und ich musste wieder auf meinen Stuhl klettern. Ich vernahm die Stimme eines Mannes an einem Ende des Saals, und ich drehte mich um, um nach ihm zu sehen. Aber alle anderen hingen mit ihren Köpfen über ihren Tellern. Während ich die lange Reihe der Tische entlangblickte, bemerkte ich, dass eine Bleichgesicht-Frau mich anstarrte. Sofort senkte ich die Augen und wunderte mich, dass die seltsame Frau mich so scharf beobachtete. Der Mann beendete sein Gemurmel, und ein dritter Glockenschlag erklang. Alle griffen nun zu Messer und Gabel und begannen zu essen. Ich hingegen begann zu weinen, denn ich hatte Angst vor dem, was noch kommen mochte.
Aber das förmliche Essen war nicht die schwerste Probe jenes ersten Tages. Spät am Morgen kündigte meine Freundin Judéwin mir gegenüber etwas Schreckliches an: Sie sprach schon ein paar Worte Englisch, und sie hatte gehört, wie die Bleichgesicht-Frau davon gesprochen hatte, dass man uns unser langes, schweres Haar abschneiden wollte. Unsere Mütter hatten uns beigebracht, dass nur ungeschickten Krieger, die in Gefangenschaft geraten waren, vom Feind die Haare kurz geschnitten würden. In unserem Volk trugen lediglich Trauernde das Haar kurz, und nur Feiglingen wurden sie abgeschnitten!
Wir besprachen unser Schicksal, und als Judéwin sagte: »Wir fügen uns, denn sie sind stark«, rebellierte ich.
»Nein, ich werde mich nicht fügen! Ich werde kämpfen!«, antwortete ich.
Ich wartete auf meine Chance, und als niemand auf mich achtgab, verschwand ich. Ich schlich in meinen quietschenden Schuhen – meine Mokassins waren gegen Schuhe ausgetauscht worden –, so leise ich konnte, die Treppe hoch. Ich kam durch einen Saal, ohne dass ich wusste, wohin ich ging. Ich wandte mich zur Seite, wo eine Tür offenstand, und fand dahinter einen großen Raum mit drei weißen Betten darin. Vor den Fenstern hingen dunkelgrüne Vorhänge, die den Raum sehr düster erscheinen ließen. Glücklich darüber, dass niemand hier war, richtete ich meine Schritte zu der am weitesten von der Tür entfernten Ecke. Auf Händen und Knien kroch ich unter das Bett und kauerte mich in den dunklen Winkel.
Ich spähte aus meinem Versteck hervor, vor Furcht bebend, wenn ich in der Nähe Schritte vernahm. Obgleich im Saal laute Stimmen meinen Namen riefen und ich wusste, dass sogar Judéwin nach mir suchte, öffnete ich nicht den Mund, um zu antworten. Die Schritte wurden schneller und die Stimmen aufgeregter. Die Geräusche kamen immer näher. Frauen und Mädchen kamen in das Zimmer. Ich hielt den Atem an und beobachtete, wie sie Schranktüren öffneten und hinter große Koffer spähten. Jemand zog die Vorhänge auf, und plötzlich war der Raum von Licht durchflutet. Was der Anlass dafür war, dass sie innehielten und schließlich unter dem Bett nachsahen, weiß ich nicht. Ich erinnere mich daran, wie ich darunter hervorgezogen wurde, obgleich ich mich mit Tritten zur Wehr setzte und wild kratzte. Gegen meinen Willen wurde ich die Treppen hinabgetragen und fest an einen Stuhl gebunden.
Ich schrie laut, warf die ganze Zeit meinen Kopf hin und her, bis ich die kalten Klingen der Schere an meinem Hals spürte und das Geräusch hörte, mit dem sie einen meiner dicken Zöpfe abfraßen. Ich war außer mir. Seit ich von meiner Mutter weggeführt worden war, hatte ich die schlimmsten Demütigungen erdulden müssen. Leute hatten mich angestarrt. Ich wurde in die Luft geworfen wie eine Holzpuppe. Und jetzt wurde mir mein langes Haar abgeschnitten wie bei einem Feigling! In meiner Seelennot wimmerte ich nach meiner Mutter, aber niemand kam, um mich zu trösten. Nicht eine einzige Seele sprach ruhig mit mir, wie meine Mutter dies zu tun pflegte. Von nun an war ich nur noch eines von vielen kleinen Tieren, die von einem Hirten getrieben wurden.
III – Eine Begebenheit im Schnee
Kurz nach unserer Ankunft spielten wir drei Dakotamädchen in einer Schneewehe. Wir verstanden noch immer nichts von der englischen Sprache, außer Judéwin, die schon immer solche verwirrenden Dinge gehört hatte. Eines Morgens erfuhren wir durch ihre Ohren, dass es uns verboten war, uns der Länge nach in den Schnee fallen zu lassen, wie wir es getan hatten, um unsere Abdrücke sehen zu können. Es dauerte aber nur wenige Stunden, bis wir diese Anordnung vergessen hatten, und wir hatten gerade sehr viel Spaß im Schnee, als eine schrille Stimme uns rief. Wir blickten auf und sahen eine befehlende Hand, die uns ins Haus winkte. Wir klopften den Schnee von uns ab und gingen so langsam, wie wir uns trauten, zu der Frau.
Judéwin sagte: »Jetzt ist das Bleichgesicht böse auf uns. Sie wird uns dafür bestrafen, dass wir uns in den Schnee haben fallen lassen. Wenn sie euch direkt in die Augen blickt und laut spricht, dann müsst ihr abwarten, bis sie wieder aufhört. Dann, nach einer kleinen Pause, sagt ihr ›nein‹.« Den restlichen Weg übten wir das kleine Wörtchen »nein«.
Es ergab sich, dass zuerst Thowin vor das Gericht gerufen wurde. Die Tür schloss sich hinter ihr mit einem Klicken.
Judéwin und ich standen ganz still da und lauschten am Schlüsselloch. Die Bleichgesicht-Frau sprach in sehr strengem Ton. Ihre Worte fielen wie knisternde Glut von ihren Lippen, und ihr Tonfall sprang nach oben wie das dünne Ende einer peitschenden Gerte. Ich verstand ihre Stimme besser als die Dinge, die sie sagte. Offenkundig hatten wir sie sehr verärgert. Judéwin verstand genug von dem Gesagten, um zu begreifen, dass sie uns die falsche Antwort gelehrt hatte.
»Oh, arme Thowin«, stieß sie hervor und hielt sich mit beiden Händen die Ohren zu.
Genau in dem Moment hörte ich Thowin mit bebender Stimme sagen: »Nein.«
Wütend rief die Frau etwas aus und verabreichte Thowin eine Tracht Prügel. Schließlich hörte sie damit auf und sagte etwas. Judéwin übersetzte: »Wirst du das nächste Mal meinen Worten gehorchen?«
Und wieder antwortete Thowin mit dem einzigen Wort, das sie beherrschte: »Nein.«
Diesmal wollte die Frau ihr mit ihren Schlägen richtig wehtun, und das arme Mädchen schrie aus Leibeskräften. Nach einer Weile hörte die Frau mit dem Schlagen plötzlich auf, und sie stellte eine andere Frage: »Wirst du dich wieder in den Schnee fallen lassen?«
Thowin gab ihrem Zauberwort eine weitere Chance. Wir hörten, wie sie mit schwacher Stimme sagte: »Nein! Nein!«
Daraufhin legte die Frau ihren halb zerfledderten Pantoffel beiseite und führte das Kind hinaus, seinen schwarzen, geschorenen Kopf tätschelnd. Vielleicht sah sie ein, dass brutale Kraft nicht die Lösung für ein solches Problem war. Sie tat weder Judéwin noch mir etwas an. Sie brachte uns nur unsere unglückliche Kameradin zurück und ließ uns allein in dem Zimmer.
Während der ersten zwei oder drei Jahreszeiten gab es noch etliche Missverständnisse, die nicht weniger lächerlich waren als dieses und die Ängste und Bestrafungen in unsere kleinen Leben brachten, die durch nichts zu rechtfertigen waren.
Nach einem Jahr war ich in der Lage, mich einigermaßen in gebrochenem Englisch auszudrücken. Sobald ich einen Teil dessen, was gesagt und getan wurde, verstehen konnte, ergriff ein boshafter Rachegeist von mir Besitz. Eines Tages wurde ich wegen irgend eines Fehlverhaltens von meinem Spiel weggerufen. Ich hatte eine Regel nicht beachtet, die in meinen Augen völlig nutzlos war. Ich wurde in die Küche geschickt, um Kohlrüben fürs Abendbrot zu stampfen. Es war Mittag, und dampfende Schüsseln wurden eilig in den Speisesaal getragen. Ich hasste Kohlrüben, und ihr Geruch, der mir aus dem braunen Topf in die Nase stieg, beleidigte mich. Mit Feuer im Herzen ergriff ich das hölzerne Werkzeug, das die Bleichgesicht-Frau mir reichte. Ich stand auf einer Stufe, und den Griff mit beiden Händen packend, beugte ich mich voll Zorn über die Kohlrüben. All meine Rachegelüste ließ ich an ihnen aus. Jedermann war so beschäftigt, dass niemand etwas bemerkte. Ich sah, dass die Kohlrüben sich in einen Brei verwandelt hatten, und dass weiteres Schlagen ihren Zustand nicht verbessern würde. Aber mein Auftrag lautete: »Stampfe diese Kohlrüben!«, und stampfen würde ich sie! Ich sammelte meine Kräfte und stieß den Stößel mit größter Wucht in den Boden des Topfes. Ich hatte die befriedigende Empfindung, dass mein ganzes Körpergewicht in diesem Stoß gelegen hatte.
Genau in diesem Augenblick kam eine Bleichgesicht-Frau an meinen Tisch. Sie blickte in den Topf und schob meine Hände grob beiseite. Ich stand da, furchtlos und wütend. Sie ergriff den Topf mit ihren roten Händen, hob ihn an und ging mit großen Schritten vom Tisch fort. Aber siehe da! Der ganze Brei fiel durch den zerschlagenen Boden auf die Erde. Ein Schwall von Beschimpfungen ergoss sich über mich. Ich schenkte dem keine Beachtung. Ich triumphierte innerlich, auch wenn ein Teil von mir Bedauern empfand wegen des zerbrochenen Topfes.
Beim Essen stellte ich fest, dass keine Kohlrüben serviert wurden. Mein Herz jubilierte darüber, dass ich wenigstens dieses eine Mal erfolgreich rebelliert hatte.
IV – Der Teufel
Unter den Legenden, die die alten Krieger mir zu erzählen pflegte, waren viele Geschichten von bösen Geistern. Doch man hatte mir beigebracht, sie nicht mehr zu fürchten als jene Wesen, die in körperlicher Gestalt unter uns wandelten. Nie aber hatte ich davon gehört, dass es unter den bösen Geistern ein dreistes Oberhaupt geben sollte, das es wagte, seine Truppen gegen den Großen Geist auszusenden, bis ich diese Legende des Weißen Mannes von einer Bleichgesicht-Frau vernahm.
Sie zeigte mir ein großes Buch, das ein Bild vom Teufel des Weißen Mannes enthielt. Mit Schrecken betrachtete ich die starken Klauen, die aus seinen fellbedeckten Fingern hervorragten. Seine Füße glichen seinen Händen. Ein schuppiger Schwanz hing ihm bis zu den Fersen, und das Ende des Schwanzes war ein Schlangenkopf mit aufgerissenem Maul. Sein Gesicht war das reinste Flickwerk. Er hatte bärtige Wangen, wie manche Bleichgesichter sie besaßen. Seine Nase war ein Adlerschnabel, und seine spitzen Ohren waren aufgestellt wie die eines listigen Fuchses. Darüber befand sich ein Paar einwärts gebogener Stierhörner. Ich zitterte vor Ehrfurcht, und das Herz schlug mir bis in die Kehle, als ich den König der bösen Geister betrachtete. Dann hörte ich, wie die Bleichgesicht-Frau sagte, dass diese schreckliche Kreatur frei durch die Welt streifte, und dass kleine Mädchen, die gegen die Schulregeln verstießen, von ihr gefoltert würden.
In der folgenden Nacht träumte ich von dieser bösen Gottheit. Im Traum war ich wieder auf dem Gehöft meiner Mutter. Eine Indianerin war zu ihr zu Besuch gekommen. Zu beiden Seiten des Küchenherdes, der in der Mitte des kleinen Hauses stand, saßen meine Mutter und ihr Gast auf Stühlen mit hohen, geraden Lehnen. Ich spielte mit einem Zug aus leeren Garnspulen, die mit einer Schnur aneinandergereiht worden waren. Es war bereits Nacht, und der Lampendocht brannte schwach. Plötzlich hörte ich, wie jemand von außen am Türknauf drehte.
Meine Mutter und die Frau unterbrachen ihr Gespräch und blickten zur Tür. Ich hockte hinter dem Herd und wartete, was geschehen würde. Die Türangeln quietschten, als die Tür sich langsam, sehr langsam nach innen öffnete.
Und dann schlüpfte plötzlich der Teufel herein! Wie groß er war! Er sah genau so aus wie auf dem Bild, das ich auf dem papiernen Blatt des Weißen Mannes gesehen hatte. Er sagte kein Wort zu meiner Mutter, denn er kannte die indianische Sprache nicht. Doch seine glitzernden, gelben Augen waren auf mich gerichtet. Mit großen Schritten ging er um den Herd herum, vorbei an dem Stuhl, auf dem die Frau saß. Ich ließ meine Garnspulen fallen und rannte zu meiner Mutter. Er schien keine Angst vor ihr zu haben und folgte mir auf dem Fuße. Dann rannte ich im Kreis um den Herd herum und schrie laut um Hilfe. Doch meine Mutter und die Frau schienen von der Gefahr, in der ich mich befand, gar nichts zu bemerken. Still saßen sie da und schauten ruhig zu, wie der Teufel mich jagte. Schließlich wurde mir schwindlig. Mein Kopf drehte sich wie ein Karussell. Meine Knie wurden weich, und ich klappte zusammen wie ein Taschenmesser mit zerbrochener Feder. Neben dem Stuhl meiner Mutter sank ich auf eine Kiste. Erst in dem Augenblick, da der Teufel sich mit ausgestreckten Klauen über mich beugte, erwachte meine Mutter aus ihrer gleichgültigen Starre und nahm mich auf den Schoß. Daraufhin verschwand der Teufel, und ich erwachte.
Am nächsten Morgen rächte ich mich am Teufel. Ich schlich mich in den Raum, in dem ein Wandregal voll Bücher stand und zog das Buch »Die Geschichten aus der Bibel« heraus. Mit einem zerbrochenen Griffel, den ich in meiner Schürzentasche mitgebracht hatte, begann ich die verfluchten Augen des Teufels auszukratzen. Einige Weilchen später war ich bereit, den Raum wieder zu verlassen: Auf der Seite, wo einst das Bild des Teufels geprangt hatte, war nur noch ein Loch mit ausgefransten Rändern zu sehen.
V – Eiserne Routine
Eine lärmende Glocke weckte uns an jedem der kalten Wintermorgen um halb sieben. Aus glücklichen Träumen von den wogenden Prärien des Westens und von unbändiger Freiheit taumelten wir auf den kalten, kahlen Boden eines neuen Tages der Bleichgesichter. Uns blieb nur wenig Zeit, in unsere Kleider und Schuhe zu schlüpfen und unsere Augen mit kaltem Wasser zu befeuchten, bevor eine kleine Handglocke uns unbarmherzig zum Zählappell rief.
Es gab zu viele schläfrige Kinder und zu viele Anordnungen für den Tag, als dass man auch nur einen Moment hätte verschwenden dürfen, der Natur in irgendeiner Weise Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, deren Kinder jeden Morgen solch einem Schock ausgesetzt wurden. Wir eilten die Treppen hinunter, wobei wir jeweils zwei der hohen Stufen nahmen, und landeten schließlich im Versammlungsraum.
Eine Bleichgesicht-Frau mit einem aufgeschlagenen Buch mit gelbem Einband im Arm, das die Namenslisten enthielt, und einem abgenagten Bleistift in der Hand, erschien am Eingang. Ihr kleines, müdes Gesicht war kalt erleuchtet von einem Paar großer grauer Augen.
Sie stand still da, umgeben von einer Aura aus Autorität. Ihre Augen spähten unruhig über den Rand ihrer Brille hinweg durch den Raum. Nun blickte sie auf ihre lange Namensliste und rief den ersten Namen. Sie streckte ihr Kinn nach vorn und schaute durch die Kristallgläser ihrer Brille, um sich der Antwort »Hier!« zu vergewissern.
Unerbittlich markierte ihr Bleistift, wenn wir nicht anwesend waren und keiner unserer Freunde erfolgreich an unserer statt hatte auf den Aufruf reagieren können. Es war völlig egal, ob vielleicht dumpfer Kopfschmerz oder ein qualvoller Husten wegen einer langsam fortschreitenden Schwindsucht den Abwesenden aufgehalten hatte, einzig und allein die Säumigkeit wurde notiert; Zeit, den Grund dafür zu erforschen, war nicht vorhanden. Es war so gut wie unmöglich, aus der eisernen Routine auszubrechen, wenn die Zivilisierungsmaschinerie erst einmal ihr Tagwerk begonnen hatte, und es entsprach meiner Natur, lieber still zu leiden als jemanden, dessen offene Augen meine Qual nicht sehen konnten, um Hilfe zu bitten. Und so habe ich mich viele Male auf müden Beinen in das Zuggeschirr des Tages geschleppt wie ein sieches Stück Vieh.
Einmal verlor ich eine teure Klassenkameradin. Ich erinnere mich gut, wie sie trübselig und mühsam an meiner Seite trottete, bis sie sich eines Tages nicht mehr aus dem Bett erheben konnte. Ich stand weinend an ihrem Sterbebett, während die Bleichgesicht-Frau auf einem Stuhl saß und dem Mädchen die trockenen Lippen befeuchtete. In den Falten des Bettzeugs entdeckte ich eine offene Bibel. Das sterbende Indianermädchen stammelte zusammenhanglose Worte über Jesus Christus und über das Bleichgesicht, das ihre geschwollenen Hände und Füße kühlte.
Ich war verbittert und warf der Frau vor, dass ihr unsere Krankheiten auf grausame Weise gleichgültig wären. Ich schmähte die Bleistifte, die automatisch ihre Einträge machten, und den einen Teelöffel, der aus einer großen Flasche ein und dieselbe Medizin an eine ganze Reihe von Indianerkindern, die an den verschiedensten Krankheiten litten, verteilte. Ich machte der fleißigen, gutwilligen und ungebildeten Frau, die ihre abergläubischen Ideen in unsere Herzen einpflanzte, bittere Vorwürfe.
Doch obgleich ich wegen all meiner kleinen Kümmernisse düster gestimmt war, fühlte ich mich nach einer Weile wieder besser. Ich konnte nun sogar lächeln über die grausame Frau. Und nach einer Woche war ich schon wieder dabei, die Ketten, die meine Individualität so sehr fesselten, dass sie einer eingeschnürten Mumie glich, aktiv auszutesten.
Die Schwermut dieser schwarzen Tage hat so lange Schatten geworfen, dass sie den Pfad all der Jahre, die seither verflossen sind, verdüstert hat. Die bitteren Erinnerungen sind stärker als die an jene Schultage, die reibungslos verliefen. Vielleicht gleicht meine indianische Wesensart dem brausenden Wind, der diese Erinnerungen aufwirbelt, damit ich sie hier niederschreiben kann. Doch mögen auch in meinem Innern Stürme tosen – meine Aufzeichnungen sind nur ein leises Rauschen, das aus einer seltsam gefärbten Muschel dringt, vernehmbar nur für solche Ohren, die sich ihr mit Mitgefühl zuneigen.
VI – Vier merkwürdige Sommer
Nach meinen ersten drei Schuljahren reiste ich wieder in den Westen und verbrachte dort vier merkwürdige Sommer.
Ich hatte während dieser Zeit das Gefühl, dass meine Welt vollkommen aus den Fugen geraten war. Kein Mensch half mir, keine Stimme tröstete mich. Mein Bruder, der fast zehn Jahre älter war als ich, konnte nicht so recht begreifen, was ich fühlte. Meine Mutter hatte nie eine Schule von innen gesehen, und so war sie nicht in der Lage, ihre Tochter, die inzwischen lesen und schreiben konnte, zu trösten. Die Natur selbst schien keinen Platz mehr für mich zu haben. Weder war ich ein kleines Mädchen noch ein großes; weder war ich eine wilde Indianerin noch eine gezähmte. Diese beklagenswerte Lage war das Ergebnis meiner kurzen Lehrzeit im Osten, und hinzu kam, dass ich inzwischen in meinen »Teenagerjahren« war, eine Zeit, in der Mädchen ohnehin unzufrieden mit sich und der Welt sind.
So sah es also aus, als ich an einem strahlenden Nachmittag ruhlos und unglücklich in der Hütte meiner Mutter saß und plötzlich das flinken Getrappel des Ponys meines Bruders auf der Straße, die an unserem Haus vorbeiführte, vernahm. Bald darauf hörte ich die Räder einer leichten, offenen Kutsche und dann Dawées vertrautes »Ho!«, das er seinem Pony zurief. Auf dem bloßen Boden vor unserer Hütte stieg er aus, band das Pony an einem der hervorstehenden Eckblöcke der niedrigen Hütte fest und stieg die hölzerne Eingangsstufe hinauf.
Ich begrüßte ihn flüchtig. Als er an mir vorüberging, warf er mir einen ruhigen, fragenden Blick zu.
Während er begann, sich mit meiner Mutter zu unterhalten, löste ich das Seil vom Zaumzeug des Ponys. Ich ergriff die Zügel, stieg auf das vordere Brett der Kutsche, saß auf und ließ das Pferd blitzschnell wenden. Es war sofort bereit, loszugaloppieren. Ich blickte mich um und sah, dass Dawée mir zuwinkte. Ich ritt um die nächste Kurve, und schon war ich außer Sicht. Ich folgte der gewundenen Straße, die zwischen niedrigen Hügeln aufwärts führte. Zu beiden Seiten der Straße verliefen tiefe, vom Wasser ausgewaschene Gräben. Ein starker Wind blies mir ins Gesicht und ließ meine Ärmel flattern. Das Pony erreichte die Kuppe des höchsten Hügels und begann, in gleichmäßigem Galopp über die Ebene zu jagen. Soweit das Auge blickte, regte sich nichts bis hin zum weiten, runden Horizont der Prärien der Dakota, außer dem hohen Gras, das im Winde in langen rollenden, schattenhaften Wogen schwankte.
In diesem riesigen Tipi aus Blau und Grün ritt ich unbekümmert und ohne Ziel dahin. Weißer Schaum flog vom Maul des Ponys, und das gefiel mir.
Plötzlich zog ein Kojote vorüber, und mit schwingendem Gang trottete der gerissene Dieb auf den Hügel zu, in Richtung des dahinterliegenden Dorfes. Ohne nachzudenken, jagte ich ihm eine lange Strecke hinterher und flößte ihm auf diese Weise einen heilsamen Schrecken ein. Als ich endlich von ihm abließ, um zum Dorf zurückzukehren, sank der Kojote abgehetzt auf seine Hinterkeulen, denn es war ein heißer Sommertag. Während ich langsam nach Hause ritt, konnte ich noch lange seine spitze Schnauze sehen, die auf mich gerichtet war, bis ich zwischen den Hügeln aus seiner Sicht entschwand.
Es dauerte nicht mehr lange, und ich erblickte wieder das Haus meiner Mutter. Dawée stand im Garten neben einem alten Krieger und lachte, während dieser mit dem Zeigefinger zu den Hügeln wies und schließlich mit der Hand in ihre Richtung fuchtelte. Der Krieger trug seine Decke über einer Schulter, und er sprach und gestikulierte ganz aufgeregt. Dawée fasste den alten Mann bei der Schulter und zeigte auf mich.
»Oh, han!« – »Oh, ja«!, murmelte der Krieger. Er war auf die Kuppe seines kahlen Lieblingshügels gestiegen, um die Prärie zu betrachten und war Zeuge meiner Jagd auf den Kojoten geworden. Seine scharfen Augen erkannten das Pony und seinen Reiter. Besorgt um meine Sicherheit, war er zur Hütte meiner Mutter gerannt, um sie zu warnen. Mir gefiel sein wohlwollendes Interesse keineswegs, denn es hinterließ ein nagendes Gefühl von Unruhe in meinem Herzen.
Sobald er weggegangen war, stellte ich Dawée eine Frage zu einem völlig anderen Thema.
»Nein, meine kleine Schwester, ich kann dich nicht mit zu der Party heute Nacht mitnehmen«, erwiderte er. Obwohl ich schon fast fünfzehn war und schon seit langem das Gefühl hatte, dass ich alles, was meiner großen Cousine erlaubt war, auch dürfen sollte, nannte er mich immer noch »kleine Schwester«.
In dieser vom Mondschein erhellten Nacht weinte ich in Gegenwart meiner Mutter, als ich hörte, wie fröhliche junge Leute an unserem Gehöft vorbeiliefen. Aber sie waren nun nicht mehr junge Krieger mit Decken und Adlerfedern und Indianermädchen mit hübsch bemalten Wangen. Drei Jahre waren sie in die Schule im Osten gegangen, und nun waren sie zivilisiert. Die jungen Männer trugen Jacken und Hosen der Weißen und helle Krawatten. Die Mädchen trugen enge Musselinkleider, mit Bändern am Hals und an der Hüfte. Bei Ihren Zusammenkünften sprachen sie Englisch. Ich konnte fast so gut Englisch sprechen wie mein Bruder, aber ich war nicht schick genug angezogen, dass er mich hätte mitnehmen können. Ich hatte keinen Hut und keine Bänder und auch kein enganliegendes Kleid. Als ich von der Schule zurückgekehrt war, hatte ich meine Schuhe fortgeworfen und trug nun wieder meine weichen Mokassins.