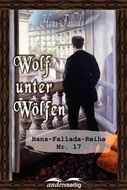Kitabı oku: «Der eiserne Gustav», sayfa 9
8 Spionenfang
Sie waren noch ein Stück die Frankfurter Allee hinausgegangen, die Häuser standen immer spärlicher. Dann kamen Gärten, kleine Feldstücke – und nun lag das erste richtige große Kornfeld vor ihnen: Roggen.
»Sieh mal, Bubi, Roggen, Korn, angemäht, aber nicht weitergemäht. Der ist längst reif. Denen ist auch der Krieg dazwischengekommen. Wer das nun wohl erntet?«
Er sah über die weiten Felder, alles war still und verlassen. Kein Mensch war an der Arbeit zu sehen, nur auf den Straßen liefen und fuhren sie eilig.
»Es wird schon so kommen, Bubi, wie ich heute früh zu Rabause gesagt habe: Die Frauen werden jetzt die Männerarbeit machen müssen.«
»Mutter auch?«
»Natürlich. Mutter auch.«
»Na, Vater …«
»Was ist mit Mutter? Wenn sie muß, wird sie schon können. Ich will heute nachmittag auch sehen, daß ich mich stelle als Freiwilliger.«
»Aber du bist doch zu alt, Vater! Und dann hast du immer mit dem Herzen zu tun.«
»Ich habe gar nichts mit dem Herzen!«
»Doch – manchmal wirst du ganz blau, Vater!«
»Also! Ich werde mich stellen, und sie werden mich nehmen. Du wirst sehen!«
»Aber …«
»Sie werden mich nehmen! Und nun halte den Mund, Bubi!«
»Dann nehmen sie mich auch, Vater!«
»Du sollst den Mund halten, Bubi!!«
Eine Weile gingen sie schweigend. Sie bogen in einen Feldweg, vor ihnen lag erhöht ein Bahndamm.
»Wohin geht denn die Bahn, Vater?«
»Nach Strausberg, Bubi. Und dann immer weiter nach dem Osten, bis nach Posen oder nach Rußland …«
»Da kommt ein Zug, Vater!«
»Ja, ich sehe ihn auch …«
Von Berlin her kam, hinter zwei schnaufenden Lokomotiven, ein Zug, ein Zug mit vielen Viehwagen, deren Türen zurückgeschoben waren. Aus den Viehwagen sahen Pferdeköpfe heraus, in den Türen standen Soldaten, feldgraue Soldaten, und auf den offenen Wagen standen – Bubi jubelte – Kanonen! Es war der erste Zug, der vor ihren Augen in den Krieg fuhr, und Vater und Sohn waren gleich aufgeregt.
»Vater! Vater! Sie fahren in den Krieg! Sie fahren gegen die Russen! Hurra, ihr!« schrie Bubi. »Haut sie tüchtig!«
Die Soldaten winkten lachend zurück. Auch der Vater schrie hurra und winkte. Wagen um Wagen …
»Einundvierzig, zweiundvierzig …«, zählte Bubi. Und: »Vater, was ist das? Das schwarze Dings mit dem Schornstein? Das sieht ja komisch aus! Ist das auch zum Schießen?«
»Das ist eine Feldküche, Heinz. Gulaschkanone sagt man auch«, erklärte der Vater. »Daraus wird bloß Essen geschossen …«
»Vierundvierzig, fünfundvierzig …«, zählte Heinz eifrig weiter. »Vater, es sind siebenundvierzig Wagen ohne den Kohlenwagen …«
»Bubi!« flüsterte Hackendahl.
»Was denn, Vater?«
»Nicht so laut! – Bubi, kuck mal dahin, nach dem Busch rechts … Aber nicht so, daß es auffällt, ganz unauffällig … Siehst du den Mann im Weidengebüsch?«
»Doch!«
»Kuck weg, jetzt sieht er zu uns hin. Tu mal so, als ob du dein Schuhband bindest. – Was macht der Mann denn hier so allein im Busch? Das sieht doch ganz aus, als hätte er sich versteckt.«
Bubi knüpfte an seinem Schuhband, dabei schielte er.
»Vater, jetzt hat er was Weißes in die Tasche gesteckt, sieht ganz wie Papier aus. Ob er den Zug aufgeschrieben hat …?«
»Was hat er den Zug aufzuschreiben?« knurrte Hackendahl.
»Die Soldaten, die Pferde, die Kanonen? Ob es ein Spion ist, Vater?!«
»Ruhig, Bubi, nicht so laut! Er sieht wieder her! Warum guckt er immer zu uns? Wir gehen ihn doch gar nichts an …«
»Er hat ein schlechtes Gewissen, Vater – das ist ein Spion!«
»Man muß kaltblütig überlegen. Was hat er hier an der einsamen Stelle zu suchen? Wenn wir nicht ganz zufällig gekommen wären …«
»Vater! Vater!! Jetzt pfeift er … Ob noch mehr hier sind?«
»Möglich ist alles!«
»Vater, komm, wir gehen hin zu ihm, wir fragen ihn, was er hier sucht. Wenn er uns dann nicht ansehen kann, nehmen wir ihn fest.«
»Wir können ihn doch nicht festnehmen! Dann läuft er uns bloß weg.«
»Ich kann schneller laufen.«
»Aber du kannst ihn nicht allein festhalten – und ich komme nicht nach, wegen meines Herzens.«
»Siehst du? Doch dein Herz!«
»Ruhig jetzt! – Er hat gemerkt, daß wir ihn beobachten. Er haut ab. Gehen wir hinterher!«
»Los, Vater!«
»Langsam doch, Bubi, nur nicht den Kopf verlieren! Es muß ganz so aussehen, als gingen wir spazieren, er darf keinen Verdacht schöpfen …«
»Er geht zur Chaussee rüber.«
»Natürlich, er will sich unter den Leuten verkrümeln …«
»Den kriegen wir doch noch, Vater …«
»Hast du gesehen, er hat sich wieder nach uns umgedreht! Er hat schon Angst!«
Vater und Sohn waren gleichermaßen im Feuer, Jugend wie Alter brannten lichterloh. Sie gingen dem verdächtigen Manne nach, sie taten so unverdächtig, daß sie dem Harmlosesten aufgefallen wären. Sie zeigten sich mit ausgestrecktem Arm eine Lerche im Himmelsblau und ließen den Kerl nicht einen Moment aus dem Auge. Wenn er langsamer ging, blieben sie stehen. Bubi pflückte eine Blume, Vater summte: »Gloria, Viktoria.« Dann gingen sie weiter, und der Mann, der sich nach ihnen umgedreht hatte, lief schneller …
»Er reißt aus, Vater!«
»So schnell kann ich auch noch laufen!«
Aber Hackendahl keuchte schon. Es war nicht nur das Herz, es war nicht nur die Hitze – es war die Aufregung: ein Spion! Die Chaussee war ganz nah, die Chaussee war voller Leute …
»Wir können einem Radfahrer Bescheid sagen«, tröstete Hackendahl. »Ein Radfahrer holt ihn immer ein …«
Der Mann hatte die Chaussee fast laufend erreicht. Aber nun floh er nicht weiter, er hielt ein paar Männer an, er sprach aufgeregt mit ihnen …
»Ob das seine Spießgesellen sind?« fragte Bubi.
»Wir werden gleich sehen …«, stöhnte Hackendahl atemlos, blaurot.
Die Männer, der Verfolgte in ihrer Mitte, sahen den beiden stumm entgegen.
»Das sind sie!« rief der Mann aus dem Busch, unnötig laut.
Hackendahl trat auf die Straße, eng scharten die Männer sich um ihn und den Sohn, ihre Gesichter sahen drohend aus.
»Meine Herren!« sagte Hackendahl. »Das ist ein …«
»Hören Se mal«, sagte ein junger blaßgesichtiger Mann, »wat haben Se denn da eben an der Bahn jemacht?«
»Der Mann da«, rief Hackendahl und wies mit dem Finger, »hat sich in einem Busch versteckt und Notizen über einen Militärzug gemacht!«
»Ich?!« schrie der andere. »So eine Unverschämtheit! Jetzt kehrt der den Spieß um! Ich habe genau gehört, wie Ihr Rotzjunge die Wagen gezählt hat – Sie Spion, Sie!«
»Sie sind ein Spion!« schrie Hackendahl und wurde noch röter. »Mein Junge hat genau gesehen, wie Sie was Weißes in die Tasche gesteckt haben!«
»Und Sie …?!« schrie der andere. »Wer hat so getan, als pflückte er Blumen? Sehen Sie wie Blumenpflücken aus? Sie sind ja schon ganz rot vor schlechtem Gewissen!«
Verwirrt hatten die Männer die sich steigernden Beschuldigungen angehört. Unschlüssig sahen sie von einem zum anderen, tauschten fragende Blicke.
»Vielleicht sind alles beides Spione?« fragte einer. »Und wissen bloß nichts voneinander?«
»Warum haben Sie sich denn im Busch versteckt?« fragte ein ernster, bärtiger Mann den Blassen. »Das klingt doch sehr verdächtig.«
»Ich habe ein natürliches Bedürfnis befriedigt«, erklärte der Blasse.
»Was Weißes hat er in die Tasche gesteckt!« rief Hackendahl.
»Klopapier!« rief der andere. »Ich trage immer Klopapier bei mir – für alle Fälle!«
Und er wies es vor.
»Und warum hat Ihr Junge die Wagen gezählt?« fragte der ernste Bärtige wieder. »Das klingt doch sehr verdächtig.«
»Aber nur so!« rief Hackendahl zornig. »Jungen machen das immer so!«
»Das ist keine Begründung«, entschied der andere. »Kommen Sie mal mit – in der Frankfurter Allee werden wir schon einen Schutzmann treffen!«
»Aber ich kann mich ausweisen!« rief Hackendahl. »Ich habe Papiere!« Er schlug auf seine Tasche. »Ich war zur Pferdemusterung. Ich bin der Lohnfuhrunternehmer Hackendahl …«
»Zeigen Sie mal her!« Der Bärtige sah die Papiere durch. »Das ist freilich in Ordnung – entschuldigen Sie bitte, Herr Hackendahl.«
»Bitte, bitte! Aber der Kerl …«
»Bitte sehr, ich kann mich auch ausweisen! Ich gehe zur Musterung. Ich bin der Lehrer Krüger.«
Einige lächelten. Andere brummten ernst.
»Entschuldigen Sie auch, Herr Lehrer Krüger. Sie waren also alle beide keine Spione. Geben Sie sich die Hand …«
»Herr Hackendahl, es tut mir sehr leid …«
»Herr Krüger, Sie haben nur Ihre Pflicht getan …«
»Gehen wir doch gemeinsam zurück …«
Sie taten es, alle waren zufrieden, ein wenig gehoben. Nur Heinz zottelte unzufrieden nebenher; daß es nun doch kein Spion gewesen war, wurmte ihn sehr …
9 Otto fährt ab
Als Hackendahl mit Bubi nach Haus kam, wartete ein Zettel auf ihn. Es waren nur ein paar Worte: »Wir rücken heute um zwei aus. Vom Anhalter Bahnhof. Otto.«
Die Mutter war in ungewohnter Bewegung, sie deckte selber den Tisch, was sie seit vielen Jahren nicht mehr getan hatte, nur, damit alle schnell fertig wurden. Eva wirtschaftete in der Küche.
Gerade, als sich alle zu Tisch setzten, kam Erich. Er war den ganzen Vormittag von einer Kaserne in die andere gelaufen, hatte stundenlang warten müssen und war überall zurückgewiesen. »Wir können keine Leute mehr brauchen. Alle Stunden melden sich Tausende. Vielleicht in acht Wochen oder in einem Vierteljahr.«
»Gut, dann wartest du eben so lange und machst unterdessen dein Notabitur.«
Das wollte Erich nicht, er mochte nicht wieder auf die Schule. Die Wochen beim Anwalt hatten ihn verändert, er kam sich erwachsen vor. Es schien ihm unmöglich, noch einmal die Schulbank zu drücken. »Nein, mir hat einer erzählt, in Lichterfelde, bei der Kadettenanstalt, stellen sie ein Ersatzbataillon auf. Da versuche ich es morgen früh.«
»Habe es doch nicht so eilig, Erich«, bat die Mutter. »In einem Vierteljahr ist vielleicht der Krieg aus, und Otto kann auch was passieren.«
Dies war ein etwas wirrer Satz, aber alle verstanden ihn. Erich summte unternehmungslustig: »Wisch ab, Lowise, wisch ab dein Gesicht – eine jede Kugel, die trifft ja nicht …«
»Daran muß man nicht denken, Mutter«, sagte Hackendahl abweisend. »Wenn ein Soldat an so etwas denkt, kann er nicht kämpfen.«
»Wie ich heute um zehn im Fenster liege«, klagte die Mutter, »und die Pferde kommen zurück, ganze fünf von unseren schönen zweiunddreißig, und der Schimmel den Kopf doch wieder so trübselig zwischen den Beinen – da habe ich denken müssen: So kommen die Pferde wieder. Und was kommt von meinen Jungen zurück?!«
Einen Augenblick herrschte betretenes Schweigen. Dann klopfte der eiserne Gustav mit dem Messergriff hart auf den Tisch. »Ruhe, Mutter, nur Ruhe! Wenn du jetzt schon so bist, nehme ich dich nicht mit auf den Anhalter …«
»Ich bin gar nicht so!« rief die Mutter eilig und wischte sich die Augen. »Ich habe es mir nur gedacht, als die Pferde zurückkamen. Aber ich weine bestimmt nicht auf dem Anhalter! Nimm mich mit, Gustav!«
Und sie sah mit einem rührenden Versuch zu lächeln die anderen an.
»Na schön!« sagte der Vater. »Wenn du vernünftig sein willst, sage ich kein Wort. – Aber jetzt müssen wir uns eilen. Anhalter, das hieße nach Frankreich …«
Doch im letzten Augenblick gab es doch wieder eine Verzögerung. Es stellte sich heraus, daß Eva nicht mit wollte. Mit Tränen in den Augen versicherte sie, sie könne wirklich nicht, sie habe rasende Kopfschmerzen, sie sei krank …
»Nichts da!« rief Hackendahl. »Wenn der Bruder in den Krieg zieht, gehst du gefälligst zur Bahn! Da ist man nicht krank, da hat man keine Kopfschmerzen!«
Weinend versicherte Eva, sie könne wirklich nicht, sie falle um auf der Straße …
Aber wie die Mutter ihrer Tränen wegen nicht mit zur Bahn hatte kommen sollen, so mußte Eva trotz der Tränen mit.
»Mach mir keine Geschichten, Mädchen!« Und in plötzlich erwachtem Mißtrauen, sich der Worte Bubis erinnernd: »Du hast wohl einen Bräutigam? Was? Du kommst mir die ganze letzte Zeit schon mächtig komisch vor. Warte, wenn wir zurück sind, sprechen wir miteinander!«
Mißlaunig, gehetzt marschierte die Familie ab. Eva sah den Eugen wartend an einer Straßenecke stehen, sie war von ihm bestellt, sie winkte ihm hilflos ab. Er schien ihr zu drohen, dann verlor sie ihn aus dem Auge …
Sie dachte daran, daß die Wohnung jetzt nur unter der Aufsicht des kleinen Dienstmädchens stand, sie traute Eugen alles zu, alles! Auch einen Einbruch in die elterliche Wohnung. Am liebsten hätte sie kehrtgemacht, aber was hätte das nützen können? War Eugen wirklich in der Wohnung, hielt ihn ihre Anwesenheit auch nicht von einem Diebstahl zurück. Sie hatte gar keine Macht über ihn, er aber jede über sie!
Die Zeit ist bei alledem so knapp geworden, daß sie auf dem Alexanderplatz einsehen: Sie müssen fahren, sonst erreichen sie den Zug nicht mehr. Der leichtfertige Erich schlägt dem Vater eine Autotaxe vor und wird verächtlich angeblitzt. Auch der Vorschlag der Mutter, eine Pferdedroschke zu nehmen, wird als zu teuer abgelehnt. Glücklicherweise kommt ein Pferdeomnibus, in dem sie noch Platz finden. Ruckend, klappernd kommt der Wagen in Gang.
In der Stadt herrscht ein Trubel, wie am ersten Mobilmachungstag. Auf der Straße halten Wagen, junge Burschen werfen ganze Zeitungspacken unter die Leute, zusteigende Passanten bringen die Nachricht in den Omnibus: Der Krieg an Frankreich ist erklärt! Deutsche Truppen haben die belgische Grenze überschritten … Ein kurzes Stutzen, Belgien! Nun auch Belgien …?! Aber es ist keine Zeit für langes Überlegen, schon ertönt überall das Lied: »Siegreich wollen wir Frankreich schlagen …«
Alte Leute brummen unter beifälligem Lachen das Spottlied: »Was kraucht denn dort im Busch herum? Ich glaub, das ist Napolibum! Was hat der rumzukrauchen dort? Frisch, Kameraden, jagt ihn fort!«
Der Omnibus kommt nicht vorwärts im Gewühl. Sie steigen wieder aus, drängen in geschlossener Kolonne durch die Menge. Der Bahnhof, sie müssen doch auf den Bahnhof!
»Entschuldigen Sie, Herr Nachbar, wenn ich Sie getreten habe. Mein Sohn fährt nämlich in den Krieg!«
»Es war mir ein Vergnügen!«
Gottlob, der Bahnhof, endlich der Anhalter! Noch eine Minute … Durch die Halle, hinauf die Treppe – alles ist überfüllt! Von oben klingt Blechmusik. Zwei Uhr eins! Der Zug müßte fort sein, aber: »Solange sie nicht ›Muß i denn‹ spielen, fährt der Zug noch nicht!« keucht Hackendahl atemlos.
Es ist solch ein Trubel, daß sie sogar ohne Bahnsteigkarten durch die Sperre kommen. Der Schaffner ruft ihnen etwas nach, aber Hackendahl schreit: »Frankreich! Paris!« Und lacht. Viele lachen mit. Hackendahl fühlt sich fröhlich, fröhlich aufgeregt. Er rennt dahin im Kreise seiner Familie.
Wie lang der Zug ist! Aus den Fenstern sehen Männer, übereinander, nebeneinander, alle in Feldgrau, die Pickelhelme mit feldgrauen Bezügen, die in Rot die Regimentsnummer tragen. Wie ernst diese Gesichter sind! Wieviel Frauen auf dem Bahnsteig, auch sie ernst, blaß. Blumen, ja, aber Blumen in zitternden, verkrampften Händen. Unendlich viel Kinder, große und kleine, und auch die Kindergesichter sind ernst, manche von den Kleinen weinen …
Die Regimentsmusik spielt, aber die Gesichter bleiben ernst, leise nur wird gesprochen …
»Schreib auch, Vater!«
»Ich schicke dir eine Ansichtskarte aus Paris!«
Kümmerlicher Scherz, für die letzte Minute aufgespart. Blasses Lächeln.
»Und bleib gesund!«
»Du auch – und die Kinder!«
»Um die Kinder sorg dich jetzt man nicht – ich paß schon auf!«
Wo ist Otto?
Sie laufen den Zug entlang. Plötzlich ist es so wichtig geworden, den unwichtigen Otto noch einmal zu sehen, ihm die Hand zu schütteln, ihm zu sagen, daß er gesund bleiben soll.
»Da ist ja die Gudde, die Schneiderin, du weißt doch, Vater, die mein Schwarzes geändert hat. – Mit einem Kind! Seit wann hat denn die Gudde ein Kind? Die hat doch ’nen Buckel. – Es wird wohl das Kind von ’ner Nachbarin sein!«
»Wen haben Sie denn zum Zug gebracht, Fräulein Gudde? Wie heißt du denn, Junge?«
»Guten Tag, Frau Hackendahl. Da ist Otto – ich meine: Herr Hackendahl!«
Sie stürzen sich auf Otto. Die Gudde ist vergessen. Einen Augenblick, bis zur Abfahrt des Zuges, ist der immer übersehene Otto die Hauptperson.
»Mach es gut, Otto!«
»Schreib auch mal, Otto!«
»Hier habe ich dir auch ein bißchen zu essen mitgebracht, Ottchen!«
»Und wenn’s mal Kattun gibt, Otto, denk an deinen Vater! Wenn du das Eiserne Kreuz bekämst, das wäre mir das Schönste! – Hast du schon gehört, ob es in diesem Kriege auch Eiserne Kreuze gibt?«
Otto steht am Abteilfenster. Er ist sehr blaß, sein Gesicht ist grauer als das Feldgrau der Uniform. Er antwortet mechanisch, er drückt Hände, er legt das Essenpaket auf seinen Sitzplatz, wo schon ihr kleines Paket liegt …
Und immer suchen seine Augen die andere, die Einzige, die, die er liebt, mit aller Zärtlichkeit seines schwachen Herzens, und die ihn liebt, mit aller verzeihenden Liebe ihres starken Herzens. Sie sieht ihn an, flammend und zärtlich, ohne Klage und Wunsch … Sie steht da an dem gußeisernen Pfeiler, den Jungen an der Hand. »Nicht weinen, Gustäving! Papa kommt ja wieder …«
Er kann es nicht hören, aber er liest es von ihren Lippen. »… kommt ja wieder.«
Nein, vielleicht kommt er auch nicht wieder – aber, seltsam, das schreckt ihn nicht. Er zieht in einen Krieg, es wird Kampf geben, Handgemenge, Verwundungen und schmerzhaftes, langsames Sterben – aber das schreckt ihn nicht, das macht ihm keine Angst …
Ich werde bestimmt nicht feige sein, denkt er. Und doch bin ich zu feige, es Vater zu sagen …
Er möchte verstehen, warum das so ist, aber er kann es nicht verstehen … Er sieht sie hilflos an, sie alle unter seinem Abteilfenster, die alten bekannten Gesichter, und dann sieht er rasch hinüber zu der gußeisernen Säule, in jenes geliebteste, einzige Menschengesicht … Nein, er kann es nicht verstehen …
»Otto, du hast ja Blumen!« schreit Bubi. »Woher hast du denn die Blumen? Du hast wohl eine Braut?«
Alle lachen bei dem Gedanken, daß Otto, der schüchterne Otto, eine Braut haben könnte. Und auch Otto verzieht das Gesicht zu einem kümmerlichen Lächeln.
»Wo steht sie denn, deine Braut?«
Und alle sehen sich lachend um, suchen ein Mädchen für Otto. »Ist es die im blauen Kleid, Otto? Die sieht schneidig aus, aber wenn sie man nur nicht zu schneidig für dich ist. Die nimmt dir noch die Butter vom Brot!«
Otto lächelt wieder kümmerlich.
»Da steht ja immer noch die Gudde«, flüstert Frau Hackendahl. »Zu wem die wohl gehört? Otto, hast du sie gesehen?«
»Wer? Wen?«
»Die Gudde! Unsere Schneiderin! Du weißt doch!«
»Ja … ich … ich habe nämlich …«
Sie sehen ihn alle an, er wird rot. Aber sie merken nichts.
»Hast du nicht gesehen, zu wem sie gehört?«
»Nein – ich … nein. Ich habe nichts gesehen.«
»Muß i denn …«, spielt die Kapelle, der Zug ruckt an, fährt … Tücher werden gezogen, Hände werden gereicht, noch einmal …
Oh, die einsame Gestalt dort an der Säule! Sie hat kein Tuch gezogen, sie winkt nicht. Aber sie steht dort, als würde sie immer dort stehenbleiben, geduldig, ohne Vorwurf auf ihn wartend, bis er zurückkommt. Seine Augen füllen sich mit Tränen …
»Nicht weinen, Otto!« ruft Vater Hackendahl. »Wir sehen uns ja wieder!« Und sehr laut, denn der Zug hat sein Tempo beschleunigt, und Hackendahl muß zurückbleiben: »Du warst immer ein guter Sohn!«
Am längsten läuft noch Bubi mit, ganz bis ans Ende des Bahnsteigs. Er sieht den Zug entschwinden, die vielen wehenden Tücher verflattern, eine Kurve, die runde, rote Schlußscheibe am letzten Wagen – fort!
Heinz kommt zurück zu seiner Familie.
»Nun aber schnell!« sagt Frau Hackendahl. »Ich muß doch sehen, daß ich die Gudde noch erwische. Das ist doch interessant, was das für ein Kind ist und wen sie zur Bahn gebracht hat …«
Aber Gertrud Gudde ist schon verschwunden, mit ihrem Gustäving.
10 Schwester Sophie will auch fort
Der Oberarzt der chirurgischen Abteilung stand müde in seinem Arztzimmer und wusch sich wie immer, wenn er sehr abgespannt war, die Hände. Ganz gewohnheitsmäßig nahm er die kleine, scharfe Bürste, bürstete die Nägel, wusch mit Sublimatlösung nach, spülte ab und trocknete die Hände.
Er brannte eine Zigarette an, zog den Rauch tief ein, trat an das Fenster und sah gedankenvoll, nichts sehend, in den Krankenhausgarten. Er war müde, er war abgespannt, seit elf Stunden war er auf den Beinen, und es war noch kein Ende abzusehen …
Aber, dachte er, dies ist erst der Anfang. – Dies ist erst der Anfang …, dachte er langsam, und ohne besonders erregt oder verzweifelt zu sein. Dies ist erst der Anfang …
Vier Mobilmachungstage hatten ihm drei Viertel seiner Ärzte fortgeholt: Sie waren gegangen. – »Macht’s gut hier!« hatten sie gesagt und waren gegangen. Drei Viertel der Ärzte fort, von dem Pflegepersonal gar nicht zu reden, und die Belegung war etwas über dem Durchschnitt. Nun ja, dies war also erst der Anfang …
Der Oberarzt legte die Zigarette in einen Aschenbecher, nach dem ersten Zug hatte er keinen weiteren mehr getan. Gedankenlos trat er wieder an die Wasserleitung und fing von neuem an, sich mit der eingelernten, tausendfach beobachteten Genauigkeit die Hände zu waschen und zu bürsten. Er wußte nicht, daß er es tat. Manchmal machte ihn ein Kollege darauf aufmerksam, oder die Operationsschwester sagte: »Sie waschen sich ja schon wieder, Herr Professor. Erst vor zwei Minuten waren Sie an der Leitung.«
Aber jetzt war keiner da, der ihn erinnern konnte. Sorgfältig bürstete er die Nägel …
»Macht’s gut!« sagten sie und gingen. Aber wie konnte man es gut machen, mit knapp einem Viertel des normalen Ärztebestandes? Man mußte es ja schlecht machen, immerzu die Augen zudrücken, über die schrecklichsten Nachlässigkeiten fortsehen …
Es wird Menschen kosten, denkt er müde, und so lange er schon in seinem Beruf gearbeitet, an so vielen Krankenbetten er auch schon gestanden hat, er hat nie das Gefühl dafür verloren, daß da Menschen lagen, keine Fälle: Mütter, deren Kinder zu Haus weinen; Väter, auf deren Leben Glück und Wohlstand eines kleinen Gemeinwesens beruhen.
Es wird Menschen kosten, denkt er. Aber in der nächsten Zeit wird nichts so wohlfeil sein wie Menschenleben. Und es werden nicht nur die Kranken, die Verbrauchten, die Alten sterben – grade die Jugend wird fort müssen, die Jugend, die Gesundheit. Die Kraft des Volkes wird systematisch verringert werden, tagelang, wochenlang, vielleicht monatelang … Und ich stehe hier und jammere, daß ich einen vereiterten Blinddarm eine halbe Stunde zu spät operiere?
Er sieht um sich und horcht. Er steht schon wieder an der Wasserleitung und wäscht sich die Hände. Die Zigarette verschwelt im Aschenbecher, aber das hat ihn nicht aufmerksam gemacht. Langsam kommt ihm zum Bewußtsein, daß es vielleicht geklopft hat, und als er nun »Herein!« sagt, tut sich wirklich die Tür auf, und eine Schwester tritt ein, etwas verlegen.
»Nun, Schwester, was ist denn?« fragt er zerstreut und trocknet sich die Hände am Handtuch. »Ich gehe gleich noch einmal durch die Station. – Oder ist es eine Neuaufnahme?«
Die Schwester schüttelt den Kopf und sieht ihn an. Sie hat merkwürdige Augen, ein wenig scheu und doch trotzig; sie hat auch ein unausgeglichenes Gesicht, jung und doch scharf. Sie hat es wohl nicht immer leicht gehabt.
»Ich habe eine persönliche Bitte, Herr Professor«, sagt die Schwester leise.
»Damit gehen Sie aber besser zu Ihrer Oberin, Schwester. Sie wissen doch, daß Sie Ihrer Oberin unterstehen.«
»Ich war schon bei der Oberin«, sagt die Schwester leise. »Aber die Oberin hat es mir abgeschlagen. Und da habe ich gedacht, Herr Professor …«
»Nein, Schwester, nein«, sagt der Arzt energisch. »Einmal mische ich mich grundsätzlich nicht in die Angelegenheiten der Schwesternschaft. Und dann habe ich jetzt wirklich so viel um die Ohren …«
Er sieht die Schwester abschließend an, seufzt, schiebt die Ärmel hoch und geht zur Wasserleitung.
»Herr Professor hatten sich grade eben gewaschen, als ich hereinkam«, sagt die kleine Schwester mutig. (Der Tick des Oberarztes ist natürlich im ganzen Krankenhaus bekannt.) »Danke schön, Schwester«, sagt der Professor. »Sie können der Operationsschwester – Sie wissen, Schwester Lilli – sagen, daß ich in zehn Minuten wieder anfange.«
Und er läßt sich das Wasser über die Hände laufen.
»Ja, Herr Professor.« Sie sieht ihn zögernd, etwas ängstlich an. »Herr Professor, verzeihen Sie, daß ich noch einmal davon anfange … Es sind heute früh die bestimmt, die mit an die Front dürfen … Und ich – ich soll nicht mit …«
Der Oberarzt macht eine ärgerliche Gebärde. »Es können nicht alle mit!« ruft er. »Es gibt auch hier Arbeit, sehr viel Arbeit, sehr notwendige Arbeit!«
»Herr Professor! Ich muß aber mit! Bitte, Herr Professor, sagen Sie der Frau Oberin, daß ich mit soll. Es kostet Sie doch nur ein Wort, Herr Professor …«
Der Oberarzt dreht sich um und sieht die junge Schwester wutfunkelnd an. »Und wegen solchem Dreck stören Sie mir meine paar freien Minuten?!« ruft er zornig. »Schämen Sie sich was, Schwester! Wenn Sie Abenteuer mit jungen Männern haben wollen, dann brauchten Sie nicht Schwester zu werden! Das konnten Sie an jeder Straßenecke haben! Das ist Ihnen wohl zu langweilig, Ihr Saal mit alten Frauen … Ach, lassen Sie mich zufrieden, Schwester!«
Aber wenn der Oberarzt erwartet hatte, daß die Schwester nach diesem kräftigen und deutlichen Anpfiff nun begossen abziehen würde, so irrte er sich. Die Schwester Sophie stand, ohne zu weichen und zu wanken, vielleicht hatte sich sogar etwas von dem Scheuen in ihrem Auge verloren, und das Kraftvolle, das Trotzige darin war stärker geworden. Der Arzt sah es nicht ohne Interesse.
»Ich will nicht wegen der jungen Männer heraus«, sagte sie beharrlich. »Frau Oberin hat mich doch grade darum zu den alten Omis versetzt, weil ich mich für die Männerstation nicht eigne. Ich mag Männer nicht …«
»Schwester«, sagte der Professor milde. »Sie sollen mir hier keine Vorträge über Ihre Neigungen halten. Das interessiert mich nicht. Machen Sie, daß Sie auf Ihre Station kommen.«
»Jawohl, Herr Professor«, sagte sie mit unüberwindlicher Hartnäckigkeit. »Aber, Herr Professor, ich muß raus, und Sie müssen mir dazu helfen …«
»Himmeldonnerwetter, Schwester!«
»Herr Professor, ich habe nie einen Menschen ausstehen können, ich habe nie einen Menschen gern gehabt, meine Eltern nicht, meine Geschwister nicht. Und auch hier die Patienten nicht …«
»Großartig, Schwester!« spottete der Arzt. »Ganz vorzüglich!«
»Nein, ich habe nie jemand leiden mögen, und auch mich hat nie jemand leiden mögen. Ich habe immer gedacht, man ist ganz unnütz … Und nun plötzlich – bitte, Herr Professor, hören Sie mich nur noch einen Augenblick an –, und nun plötzlich ist das gekommen mit dem Krieg. Ich verstehe nichts von Politik, Herr Professor, ich weiß nicht, wieso und warum. Aber plötzlich denke ich, ich könnt vielleicht doch noch etwas nützen und etwas Gutes tun und nicht ganz umsonst sein auf der Welt …«
Sie sah ihn einen Augenblick an.
»Vielleicht verstehen Herr Professor nicht, was ich meine, ich verstehe es ja selber nicht. Aber ich meine, daß die anderen, die Frauen, meine Schwester und so – die denken, daß sie mal Kinder haben werden und einen Mann, den sie gerne mögen. – Aber ich habe nie so etwas gehabt, Herr Professor! Ich habe mir nie denken können, wozu ich auf der Welt bin. Mein Vater …«
Sie brach ab. Dann: »Herr Professor, denken Sie nicht, daß ich so an junge Soldaten denke, denen man den Kopf hält und Wasser gibt … Nein, ich denke daran, daß ich laufen will und Arbeiten machen, die mir eklig sind, und vom Morgen zum Abend bis zum Umfallen und immer weiter. Und dann, Herr Professor, dann fühl ich vielleicht, daß ich nicht ganz umsonst bin auf der Welt …« Fast mit einem Schluchzen: »Man möchte doch auch ein bißchen mehr gewesen sein als eine Fliege …«
Eine Weile war es stumm zwischen den beiden. Der Arzt trocknete sich mit langsamen Bewegungen die Hände ab, trat dann auf die Schwester zu, hob ihr den Kopf mit dem weinenden Gesicht, sah ihr in die Augen und fragte milde: »Schwester, glauben Sie, daß ein großes Volk darum in einen solchen Krieg zieht, damit – wie heißen Sie?«
»Sophie Hackendahl …«
»… damit Sophie Hackendahl sich nicht mehr überflüssig vorkommt im Leben?«
»Was weiß ich davon?!« rief sie fast wild und befreite mit einer ungestümen Bewegung ihren Kopf aus seiner Hand. »Aber das weiß ich, daß ich jetzt einundzwanzig Jahre auf der Welt bin und nicht eine Stunde das Gefühl gehabt habe, ich bin zu irgend etwas nütze!«
»Vielleicht«, sagte der Arzt überlegend, »ist wirklich auch darum dieser Krieg gekommen, daß der Mensch wieder spürt, er ist zu irgend etwas da im Leben. Vielleicht.« Er sah die Schwester an. »Also, ich will sehen, was ich bei Ihrer Oberin erreiche. Soviel ich weiß, sind Sie bei ihr nicht sehr gut angeschrieben. Aber wie ich jetzt weiß, sind Sie wenigstens in diesem Punkte mit Ihrer Oberin ganz einig …«
Der Arzt lächelte, Sophie lächelte schwach, neigte dankend den Kopf und ging.
Der Oberarzt trat wieder an die Wasserleitung.