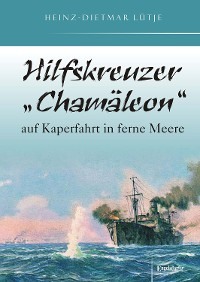Kitabı oku: «Hilfskreuzer „Chamäleon“ auf Kaperfahrt in ferne Meere», sayfa 6
10. Umtarnung und Erprobung
Am 24. Januar war endlich mit ca. 12 Grad südlicher Breite das eigentliche Operationsgebiet erreicht, nämlich der etwa 300 Meilen breite Freetown-Kapstadt Track. Nun befuhren zwar Norweger die Weltmeere überall, trotzdem hielt es der Kommandant in Absprache mit seinem Freund und IO, Graf Terra, für angesagt, dass Schiff umzutarnen. Aus dem reichen Fundus der nach Lloyds Register in Betracht kommenden Schiffe und unter Berücksichtigung kriegsbedingter Umstände wurde entschieden, das Schiff in einen ähnlich aussehenden, annähernd gleich großen Holländer, nämlich die „Ohm Hendrik“ zu verwandeln. Die See war ruhig, unter Anleitung des 2. Offiziers wurden die Bootsmannsstühle über die Bordwände gefiert und entsprechend der Vorlage der Rumpf schwarz angepönt, die Aufbauten ockerfarben abgesetzt, sowie der Schornstein durch Segeltuchstellage verlängert und das Deckshaus vergrößert. Nach zwei Tagen angestrengter Arbeit, an der fast die ganze Besatzung, die nicht durch anderweitige Tätigkeiten unabkömmlich war, eingebunden wurde, sollte das Werk gelungen sein. Kommandant, IO und LI sowie zwei der Sonderführer bestiegen die Kommandantenpinasse und umrundeten zunächst aus der Nähe, dann in einem Kreis von gut einer halben Meile, das Schiff.
„Das haut hin“, ließ sich der LI vernehmen. „Mit dem verlängerten Schornstein und dem vergrößerten Deckshaus gehen wir glatt als die „Ohm Hendrik“ durch.“
„Das sehe ich auch so“, stimmte der Graf zu, „da haben die Jungs eigentlich heute wieder ne’ Pulle Gerstensaft verdient.“
Der Kommandant bestätigte: „Auch 2 pro Nase. Das war harte Arbeit, aber sauber gelungen, meine Herren. Allerdings machen mir die Minen Sorgen. So als Holländer getarnt komme ich beinahe in Versuchung die Bucht von Kapstadt zu verminen. Dieses wird aber nur gelingen, wenn wir vorher angetroffene Gegner nicht funken lassen.“
„Der Sliphaken ist gefertigt, die Aufhängung am Flieger auch, eine Ersatzantenne habe ich auch bereits anbringen lassen“, ließ sich der LI vernehmen. „Wenn es Herrn Kaptän recht ist und die Dünung morgen nicht höher geht, schlage ich vor, die praktische Erprobung in Angriff zu nehmen.“
Während der Bootsteuerer nach einer weiteren Runde um den umgetarnten Hilfskreuzer, der jetzt seinem Namen „Chamäleon“ alle Ehre machte, wieder Kurs auf das Schiff nahm, bestätigte Graf Terra: „Auch Spaß und Schütze haben sich das Werk unseres wackeren LI bereits angeschaut und sind fest davon überzeugt, dass das Kappen der Antennen nach einigen Übungsläufen problemlos gehen sollte. Sie haben auch zugesichert, dass Aufhängung und insbesondere die Stahlschlinge vom LI so präpariert ist, das Gefahr für Flugzeug und Besatzung nicht besteht.“
„Scheun, scheun, (schön) dann mokt we dat“, bestätigte der Kommandant auf platt.
Der nächste Morgen war wie geschaffen für das Unterfangen. Der Bordkran setzte die Arado aus, die Slipeinrichtung war an den Schwimmerkufen mit entsprechenden Sollbruchstücken befestigt um Maschine und Besatzung keiner übergroßen Gefahr auszusetzen, andererseits auch nicht das Risiko einzugehen, dass nicht die Antenne abriss, sondern schon bei geringem Widerstand eher das Slipseil brach und der Start konnte beginnen. Spaß und Schütze hoben den Daumen, der Flugzeugführer gab Gas und die Maschine nahm, gegen den Wind, Fahrt auf. Immer schneller hüpfte die Arado über die kleinen Wellen der fast glatten See und hob schließlich nach etwa 250 m ab. Steil zog der Flugzeugführer die Maschine nach oben, flog eine große Runde um das Schiff und näherte sich dann, wie abgesprochen, vom Heck her. Bis auf Brückenbesatzung und die Ausgucks, die ihre jeweiligen Sektoren im Auge behalten mussten, sowie natürlich die Besatzungsmitglieder, die im Schiff selbst, vor allem in der Maschine zu tun hatten, versammelten sich alle, denen es möglich war, vornehmlich auf dem Achterdeck um sich ja nichts entgehen zu lassen. Neben dem Kommandanten und dem IO hatte sich der leitende Ingenieur mit denjenigen seiner technischen Dienstgrade eingefunden, die nicht auf ihren Stationen unabkömmlich waren. Offiziere und einige Besatzungsmitglieder, die mit den guten Marinegläsern ausgestattet waren, schauten gebannt in die Richtung, aus der sich die Arado annähern sollte.
„Aah, da kommt unsere bordeigene Luftwaffe“, ließ sich der IO vernehmen.
„Hoffentlich geht alles gut … macht bloß keinen Bruch“, meinte der LI.
Die Gläser wurden abgesetzt, nachdem das Flugzeug, schnell größer werdend, an Höhe verlor. Das Motorengeräusch schwoll an und alle Augen hingen gebannt am Flugzeug. Zwischenzeitlich war unter der Plexiglashaube der kleinen Kanzel auch bereits deutlich der Flugzeugführer, Feldwebel Schütze, zu erkennen. Fast sah es so aus, als wollte sich das kleine Flugzeug wie ein Raubvogel auf seine Beute stürzen. „ Rrrrrrrrh “ dröhnte das Motorengeräusch, immer größer und näher und wie es schien, immer schneller, schoss die Arado förmlich heran. Unwillkürlich zogen fast alle die Köpfe ein. Ein, zwei jüngere Seelords warfen sich sogar auf das frisch gereinigte Achterdeck.
„Klack.“ Ein kurzer, trockener metallischer Ton und die abgerissene Antenne wirbelte durch die Luft, das Flugzeug zog steil hoch.
„Uff… Donnerkeil –super gemacht-“ und ähnlich schwirrten die Kommentare. Auch der Kommandant, dem die Anspannung jetzt aus dem Gesicht wich, kommentierte: „Alle Achtung, das hat hingehauen.“
„Allerdings“, bestätigte der LI ob der Erleichterung, dass die unter seiner Anweisung gefertigte Konstruktion gehalten hatte, was er und insbesondere Flugzeugführer und Beobachter sich davon versprochen hatten. Selbst Graf von Terra war beeindruckt: „Meine Herren, LI, das sollten Sie sich patentieren lassen. Oder vielleicht eher der gute Schütze, der ja wohl die Idee gehabt hat.“
„Nun, nun, aber die Ausführung dieser technischen Meisterleistung, die ist ja weitgehend auf meinem Mist gewachsen“, beeilte sich der LI zu bemerken, „was sagen Sie, Herr Kaptän?“
Waldau steckte sich ein Stäbchen an, nahm einen tiefen Zug und meinte, genüsslich den Rauch ausblasend: „Nun mal bloß keine unarische Hast, sich den größten Teil der Lorbeeren zu sichern, Kameraden. Alle Beteiligten haben ihr Bestes gegeben und das soll auch so sein. Alles was Schiff und Besatzung leisten, vollbringen wir auch gemeinsam und das meine ich auch so. Vom jüngsten Seelord bis rauf zum Kommandanten. IO, merken Sie vor, dass Schütze ob dieser Leistung fürs EK vorgeschlagen wird und der LI und seine Mannen bekommen pro Nase ebenfalls ein extra Bierchen.“
11. Schlag auf Schlag
Einige Tage später, Ende Januar 1940, kurz vor Dämmerungsbeginn.
„Funkraum an Brücke, Dete-Gerät meldet Kontakt Steuerbord voraus.“ Die Meldung elektrisierte Bodo Graf Terra, den zurzeit wachhabenden IO. „Frage Entfernung?“
Die Antwort kam sofort. „Am Rande der Ortungsgrenze, geschätzt mindestens 10 Meilen.“
Terra nahm die Mütze ab, fuhr sich mit den Fingern durchs Haar, setzte die Pfeife erneut in Brand und murrte: „Wieso ist der Kommandant noch nicht da? Kurz vor Dämmerung ist er doch jeden Morgen auf der Brücke.“ In diesem Moment betrat der Korvettenkapitän die Brücke. „Was liegt an?“
„Kontakt, Steuerbord voraus, Entfernung vermutlich an die 10 Seemeilen, Herr Kaptän“, meldete der IO seinem Kommandanten. „Soll ich Klarschiff zum Gefecht geben?“
Der Kommandant nickte und sah zum Läufer Brücke. „Ordern Sie mal ne’ Kanne Kaffee und ne’ Dose Milch, Senftleben.“ In diesem Moment gellte auch das Klarschiff-Signal durch die Lautsprecher aller Räume und nach wenigen Augenblicken meldeten alle Stationen Gefechtsbereitschaft. Langsam wich die Dämmerung dem nächsten Tag und angestrengt starrten die Ausgucks, insbesondere die für den Steuerbordvorausabschnitt eingeteilten Mariner und die Brückenbesatzung durch die schweren Gläser. Der Kommandant hob den rechten Daumen und stieß diesen dreimal in die Höhe, worauf Bodo Graf von Terra das Brückentelefon abnahm: „ Krähennest, hier Brücke, Ortung Steuerbord voraus. Sofort Meldung, wenn Sie etwas ausmachen können.“ Die Minuten dehnten sich endlos. Waldau wollte gerade selbst zum Hörer greifen, als das Telefon summte. „Ausguck Krähennest an Brücke“, meldete sich der im obersten Mastkorb, dem sogenannten Krähennest sitzende Ausguck, „Sichtkontakt, hohe Aufbauten, offenbar großer Kasten, möglicherweise Passagierschiff.“ Der Kommandant nahm einen Schluck aus seiner zwischenzeitlich mit belebendem Kaffee, mit einem Schuss Dosenmilch, gefüllten Muck und meinte bedächtig, mit der linken Hand nach Glimmstängel und Feuer in der Tiefe der Hosentasche suchend: „Wecken Sie Spaß und Schütze, alles bereit machen zum Flugzeugstart. Hoheitszeichen überkleben und britische Kokarden anbringen. Wir tarnen als Bordflugzeug eines britischen Kreuzers. Slipeinrichtung vorerst nicht anbringen. Meldung, wenn Start erfolgen kann. Bis dahin folgen an äußerster Sichtgrenze. Der soll uns nicht zu früh mitkriegen!“
Zwei Stunden später war es endlich so weit. Der Start des kleinen Bordflugzeuges gegen den leichten Südostwind klappte wie am Schnürchen. Die Maschine kreiste einmal über dem Schiff und bekam durch Winkspruch bestätigt, dass die deutschen Hoheitszeichen nicht, dafür die britischen Kokarden unter den Flächen umso besser, zu erkennen waren.
„Achtung, da ist er.“ Schütze hatte vor seinem Vorgesetzten und Beobachter, Leutnant Spaß, das unter ihm dahinziehende Schiff bemerkt. Der Leutnant schaute in die angegebene Richtung und sah jetzt auch den immer deutlicher erkennbaren Dampfer. Auf dem Schiff hatte man offenbar von dem Flugzeug noch nichts bemerkt. Der Feldwebel legte die Maschine in eine leichte Kurve um sich dem Schiff nicht zu sehr zu nähern, in der Hoffnung, dass das Motorengeräusch zunächst noch nicht vernommen werden würde um erst einmal Klarheit über Schiffstyp und Nationalität zu erlangen.
„Das ist Gottlob kein Passagierschiff, sondern ein großer Frachter mit Passagiereinrichtung“, meldete sich der Beobachter zu Wort. „Können Sie die Nationalität ausmachen, Schütze? Ahh, jetzt habe ich’s, ein Franzose, ja, da steht es auch, „ Yvonne La Porte.“
„Der hat uns noch gar nicht mitbekommen“, ließ sich der Flugzeugführer vernehmen. „Schlage vor, wir drehen ab und machen Meldung.“
„Ja, zurück zum Schiff.“
Die „Chamäleon“ umkreisend gab Spaß kurz darauf mit der Signallampe die dort mit Spannung erwartete Nachricht durch. Kommandant und IO sowie der NO und der auf der Brücke anwesende Signalmeister lasen den Spruch gleichzeitig. Noch bevor der Signalmeister dem Kommandanten den Spruch mitteilen konnte, signalisierte dieser bereits durch Handbewegung, dass er verstanden habe.
„Geben Sie zurück: Wassern!“ – zum IO gewandt: „LI wahrschauen, Flieger einsetzen, Slipanlage einbauen und Flugzeug enttarnen.“
Eine knappe Stunde später, das Flugzeug war vom Bordkran aufgenommen, die Slipanlage installiert und Kommandant und IO instruierten nochmals die Flugzeugbesatzung: „Also, passt auf, der hat möglicherweise mehr als eine Funkantenne. Genau beobachten, ggf. auch die zweite Antenne möglichst kappen und vorbereitete Nachricht abwerfen. Nehmen Sie vorsorglich zwei kleine Sprengbomben mit.“
Der LI machte sich auf den Weg um zwei kleine 50 kg Bomben unter den Flächen, in die dort vorhandene Bombenabwurfvorrichtung, einzuklinken.
„Passen Sie auf, Spaß und Sie selbstverständlich auch, Schütze. Nach Lloyds Register handelt es sich um die immerhin 20.800 Bruttoregistertonnen große „ Yvonne La Porte.“ Dieser Riesenpott ist uns möglicherweise an Geschwindigkeit überlegen oder zumindest gleichschnell. Sie bleiben aus der Sichtweite des Schiffes, bis wir mit äußerster Kraft herangestaffelt sind. Wenn die Gegnerfahrt wie gemessen bei 12 Seemeilen liegt, sollten wir in drei Stunden auf Schussentfernung heran sein, um nötigenfalls auch Wirkungsfeuer schießen zu können. Wenn Sie uns in entsprechender Entfernung ausmachen können, treten Sie in Aktion – aber erst dann, verstanden! Nachdem Sie die Antennen hoffentlich so gut wie bei der Generalprobe geslipt haben, sorgen Sie dafür, dass der Abwurfbeutel auf Deck trifft. Sollte spätestens 5 Minuten danach die Fahrt nicht wesentlich verlangsamt werden, werfen Sie die erste Sprengbombe unmittelbar vor den Bug des Gegners. Nützt dieses noch nichts, platzieren Sie die zweite mitten vor die Brücke, aber dann im Anflug von vorn.“
„Jawohl, Herr Kaptän“, meldeten sich Spaß und Schütze ab. Das deutsche Kriegsschiff hatte zwischenzeitlich gestoppt. Das neu vollgetankte, mit Bomben versehene und auch hinsichtlich der eingebauten 7,9 mm Maschinengewehre aufmunitionierte, Bordflugzeug startete und die Maschinen des Hilfskreuzers gingen auf volle Fahrt.
Weiter nach Backbord ausholend staffelte „Chamäleon“ an den Franzosen heran.
Auf dem erst 1936 in Dienst gestellten kombinierten Fracht- und Passagierschiff „ Yvonne La Porte“ wurde im Speisesaal für die wachfreien Offiziere, einschließlich Kapitän und die an Bord befindlichen immerhin 56 Passagiere das Essen aufgetragen. Der Kapitän, ein kleiner aber dafür umso agiler wirkender, schwarzhaariger Südfranzose mit Menjoubärtchen, Captaine Jacques Chirace, hatte sich gerade erhoben, um mit einem Glas Rotwein in der Hand allen, vornehmlich aber den bevorzugt an den Kapitänstisch gebetenen mitreisenden jüngeren Damen, einen guten Appetit zu wünschen, als der weiß gekleidete Obersteward auf ihn zu eilte. Dieser beugte sich zum Kapitän hinab und flüsterte ihm etwas ins Ohr, worauf der kleine Franzose mit einem bedauernden Lächeln bat ihn zu entschuldigen, aber er werde auf der Brücke benötigt. Wie es kleine Männer so an sich haben, stolzierte er, im Versuch größer zu wirken, mit wichtigem Gesichtsausdruck aus dem Speisesaal, um über die Innentreppe die 3 Decks höher gelegene Schiffsbrücke zu erreichen. Suzanne Maigret, eine lebhafte, schlanke, dunkelhaarige Südfranzösin stieß ihre Freundin Judith leicht mit dem Ellenbogen an: „Hörst Du das auch? Hört sich fast wie ein Flugzeug an.“
„Dita“, wie Judith Silbermann von Eltern, Geschwistern und auch ihren in Frankreich neu gewonnenen Freunden meist genannt wurde, hatte noch amüsiert dem kleinen Kapitän hinterher geblickt, weil sie es immer wieder schreiend komisch fand, wie dieser sich alle Mühe gab, einige Zentimeter größer zu wirken.
„Was meinst Du … oh ja, jetzt höre ich es auch. Wo soll denn hier mitten auf dem Ozean ein Flugzeug herkommen?“ Mittlerweile waren auch die anderen Gäste aufmerksam geworden, hatten sie doch alle das Motorengeräusch des Flugzeugs vernommen, das nun deutlich die Eigengeräusche des in Fahrt befindlichen Schiffes übertönte.
„Mademoiselle, sehen Sie dort“, deutete ein älterer Mitreisender auf die großen Bullaugen des Speisesaals an der Backbordseite, „da ist auch ein Schiff. Da, sehen Sie!“
Jetzt hielt es die Leute nicht mehr an ihren Tischen, hatten sie doch seit Tagen nur Wasser und sonst nichts mehr in Anblick bekommen – und jetzt erst ein Flugzeug und nun gleichzeitig auch noch ein anderes Schiff. Die Stimmen schwirrten durcheinander. Auch Dita und ihre Freundin Suzanne hatten sich den Platz an einer der großen runden Scheiben gesichert und blickten interessiert auf das, fast auf gleicher Höhe aufkommende, fremde Schiff.
Während die Passagiere der „ Yvonne La Porte“ noch, eigentlich ganz erfreut, ob der Abwechslung im Tagesablauf durch das gleichzeitig aufgetauchte Flugzeug und des Schiffes, rätselten, was dieses zu bedeuten hatte – an ein deutsches Schiff und ein deutsches Flugzeug glaubte trotz des Kriegsausbruchs hier selbstverständlich niemand – sah Kapitän Chirace schon klarer. Nachdem das deutsche Bordflugzeug die einzige Funkantenne locker wie bei der Probe aus ihrer Befestigung gerissen hatte, hatte der Flugzeugführer bereits die Arado eine enge Kurve fliegen lassen und auch den Leinenbeutel mit der Botschaft mitten auf dem Vordeck platziert, der jetzt gerade von einem Besatzungsmitglied dem kleinen Kapitän gereicht wurde. Er riss die Verschnürung des Beutels auf und hielt den, um ein als Beschwerung dienendes Lotblei, gewickelten Papierbogen in der Hand.
„Merde, die Boches“, warf der Kapitän das Lotblei wütend auf den Boden seiner sauberen Brücke und stampfte mit dem Fuß auf. Auch das sich ihm nähernde deutlich als modernes Frachtschiff erkennbare Schiff war ihm selbstverständlich nicht nur selbst aufgefallen, sondern gleich bei Betreten der Brücke gemeldet worden. Hitzig diskutierte der Kapitän mit seinen Offizieren, was zu tun sei. Noch bevor diese zu einer Entscheidung gekommen waren, sahen sie bereits direkt von vorn in etwa 100 Metern Höhe das Flugzeug im Anflug. Ein dunkler Gegenstand löste sich von dem Schwimmerflugzeug, das die französischen Seeleute selbstverständlich auch sofort als Bordflugzeug eines mutmaßlichen deutschen Kriegsschiffes erkannt hatten. Gut abgezirkelt, etwa eine Schiffslänge vor der „Yvonne La Porte“ hob sich eine mehrere Meter hohe wasserdurchsetzte Sprengwolke aus der ansonsten relativ unbewegten See. Zwischenzeitlich hatte der Kapitän eine Entscheidung getroffen.
„Geben Sie Notruf“, wies er seinen ersten Offizier an. Auf der Brücke des Franzosen hatte man bisher noch gar nicht gemerkt, dass die Funkantenne zwischenzeitlich nicht mehr an ihrem Platz, sondern über Bord gewirbelt und im Meer versunken war. Eine enge Kurve fliegend wurde erneut das Bordflugzeug, dicht über die Brücke des Schiffes fliegend, sichtbar, stieg und drehte einige hundert Meter vor dem Schiff, um erneut anzufliegen. Wieder – diesmal etwas näher am Schiff – löste sich erneut ein dunkler Fleck von der kleinen Maschine und flog genau auf die Brücke zu. Kapitän, Offiziere und Brückenbesatzung ahnten was auf sie zukam und nahmen volle Deckung. Wuumm. Mit schmetterndem Schlag schlug der kleine
50 kg Sprengkörper unmittelbar vor der Brücke auf dem Vordeck auf.
Sich gerade wieder erhebend bemerkte Kapitän Chirace, dass das fremde Schiff zwischenzeitlich sehr nah gekommen war und Flaggensignale gesetzt hatte. Zu seinem Entsetzen sah er jetzt auch auf diesem die deutsche Kriegsflagge auswehen.
„Monsieur le Capitaine, er fordert uns auf zu stoppen“, meldete sich der neben dem Rudergänger stehende Wachmatrose zu Wort. In diesem Moment blitzte es auf dem bis auf eine gute Meile herangekommenen deutschen Schiff auf und fast gleichzeitig stieg unmittelbar vor dem Bug des Franzosen eine jetzt deutlich höhere Wasserfontäne, aufgeworfen von der Granate des vorderen 15-Zentimeter Geschützes des deutschen Schiffs, auf und das Spritzwasser benetzte deutlich erkennbar das Vorschiff. Dieses reichte dem französischen Kapitän. Die Hecksee der „Yvonne La Porte“ erstarb mit dem Stoppen der Maschine.
„Madames et Messieurs“, hörten daraufhin Dita, Suzanne und die anderen Passagiere und genauso die Besatzungsmitglieder, die kaum mehr wiederzuerkennende Stimme ihres Kapitäns, „wir werden von den Deutschen gekapert. Halten Sie bitte alle Ihre Papiere bereit, denken Sie an Medikamente und legen Sie vorsorglich bequeme und warme Kleidung bereit und begeben Sie sich vorsorglich zu Ihren Rettungsstationen.“
Im Speisesaal des Franzosen war die zunächst überwiegende Freude der Passagiere, ob des Zusammentreffens mit Flugzeug und Schiff in der Weite des Ozeans, dem blanken Entsetzen gewichen, insbesondere nach dem laut vernehmlichen Krachen der kleinen Sprengbombe auf dem Vordeck des Schiffes und dem anschließenden Schuss des vorderen 15-Zentimeter Geschützes des Hilfskreuzers. Alles schrie wild gestikulierend durcheinander. Bleich geworden klammerte sich Dita an ihre Freundin Suzanne: „Mein Gott, und dafür hat Vater mich jetzt auf die weite Reise zu Tante Louisa geschickt, damit die Nazis mich jetzt hier erwischen.“ Dita merkte gar nicht, wie sie in ihrer Verzweiflung ihre Nägel in Suzannes Oberarme krallte.
„Au, du tust mir weh!“
„Oh, pardon, ich hab’ Angst. Die stecken mich ins Lager … oder sie schmeißen mich gleich hier über Bord … Du weißt doch, ich bin Jüdin“, brachte die nunmehr leicht zitternde Dita hervor und ihre schönen Augen füllten sich mit Tränen.
„Komm, wir laufen erst mal schnell in unsere Kabine, ziehen uns etwas anderes an und packen unsere Sachen, Schmuck, Geld und Papiere,“ Suzanne umschlang jetzt ihre in Tränen aufgelöste Freundin Dita mit beiden Armen und drückte sie an sich, obwohl ihr selbst zum Heulen war. Erwartete doch auch sie von dem Zusammentreffen mit den Deutschen nichts Gutes. Dafür hatte schon die französische Propaganda in Presse und Rundfunk gesorgt, die allen, die in die Hände der blutrünstigen Nazis und selbsternannten Herrenmenschen fielen, wenig Gutes verhieß, sondern Tod, Versklavung und noch schlimmeres. Aus eben diesem Grunde hatte auch der jüdische Juwelier Silbermann, der im ersten Weltkrieg dem deutschen Kaiser noch als Hauptmann der Infanterie diente, vorgesorgt und noch vor der Machtergreifung der Nazis – wenn auch mit viel Verlust – seine Immobilien in Frankfurt verkauft und mit Ehefrau Esther und den beiden Töchtern Ruth und Judith bereits Mitte Januar 1933 – also gerade noch rechtzeitig – seine angestammte Heimat Deutschland verlassen und sich in einem Pariser Vorort eine neue Existenz geschaffen. Wie richtig dies war, sollten die nächsten Jahre erweisen, als nach und nach der Kontakt zu vielen in Deutschland gebliebenen Angehörigen plötzlich einfach abriss, da Briefe nicht mehr beantwortet wurden und Nachfragen erfolglos blieben. Aufgrund seiner guten Verbindungen, auch zu alten Offizierskameraden, erfuhr er einiges mehr, als der durchschnittliche deutsche Volksgenosse und insbesondere die meisten emigrierten Juden. Aufgrund verwandtschaftlicher Bindungen, sowohl nach Frankreich als auch nach Südamerika, Intelligenz, Tüchtigkeit und exzellente Handwerkskunst, sowie eines ansehnlichen geretteten Vermögens, lebte die Familie in sehr guten wirtschaftlichen Verhältnissen. Die älteste Tochter Ruth studierte in Amerika Medizin und auch Dita hatte, nach glänzendem Abitur in Frankreich, ein Medizinstudium an der Pariser Sorbonne begonnen und befand sich mittlerweile im 6. Semester, als sie dann nach Kriegsausbruch auf sehr eindringliches Drängen ihrer Eltern, dem sie sich schließlich nach hartnäckigem Widerstand beugte, veranlasst wurde, dieses in Argentinien, bei ihrer dort lebenden Tante Louisa Stockhausen, fortzusetzen.
Widerstrebend ließ sich Dita schließlich von Suzanne in die von beiden bewohnte Kabine bugsieren, wo diese der immer noch fassungslosen Dita half, sich trotz der warmen Witterung in etwas wärmere Hosen und leichten Pullover, sowie festes Schuhwerk zu werfen, Papiere und Wertsachen in der sicher verschlossenen Handtasche zu verwahren und auch mit warmer Kleidung und Schwimmweste versehen schließlich mit ihr das Kommende abzuwarten.
Zur gleichen Zeit auf dem deutschen Hilfskreuzer.
Dieser hatte sich dem Gegner, nachdem die Fahrt aus dem französischen Schiff gekommen war und dieses in der Dünung sanft rollte, bis auf wenige hundert Meter genähert, wobei die Kanonen und auch die Flawaffen schussbereit auf den Gegner gerichtet waren und gab durch Blinkspruch zu erkennen, dass ein Prisenkommando übersetzen werde und die Schiffsführung aufgefordert wird, keinerlei Widerstand zu leisten, die Schiffspapiere bereitzuhalten und das Prisenkommando ungehindert an Bord kommen zu lassen.
„IO, es dürfte das Beste sein, wenn bei diesem großen Schiff Sie selbst das Prisenkommando führen. Nehmen Sie zwei Offiziere und auch den Sonderführer Manger, der ja fließend französisch spricht, mit sowie den 2. FTO Kurt Pries. Der soll sich mal die Funkanlage anschauen, ob wir da etwas gebrauchen können, insbesondere auch etwaige Funkschlüssel usw. Alsdann Meldung Passagierzahl, Ladung, na ja und Sie wissen schon.“
Die große Motorpinasse wurde ausgesetzt und das Prisenkommando, alle mit Pistole und MP bewaffnet, legte ab. Schon dreißig Minuten später ließ der IO dem Kommandanten durch Blinkzeichen mitteilen, dass das Schiff vollständig in der Hand des Prisenkommandos sei, die Passagiere in ihren Kabinen und die Besatzung auf dem Vordeck versammelt sei und er zur Berichterstattung zurückkommen wolle.
Kurz darauf saß Bodo Graf von Terra seinem Freund Didi Waldau in dessen Kabine gegenüber und öffnete den mitgebrachten vollgestopften Seesack. Nachdem die Schiffspapiere mit Ladelisten sowie die Seemannsbücher der Besatzung und Personalpapiere der Passagiere ausgepackt waren, kramte er breit grinsend noch eine Flasche Schampus sowie eine Stange Camel hervor und machte sich daran die Flasche zu öffnen. Didi guckte erstaunt.
„Willst Du jetzt etwa saufen? Das kann ja wohl nicht wahr sein.“
Terra grinste von einem Ohr zum anderen: „Nicht saufen, aber wohl auf diesen super Fang ein Gläschen edlen französischen Prickelwassers genießen und dazu eine gute amerikanische Camel rauchen. Auch so etwas gibt es auf französischen Schiffen.“ Mit diesen Worten erhob sich Bodo, entnahm dem Schrank seines Kommandanten zwei Gläser und bedeutete diesem, selbst die Flasche zu öffnen und einzuschenken.
„Nun mach schon. Wir haben drüben 55 Passagiere und etwa die gleiche Anzahl Besatzungsmitglieder, also ne’ ganze Menge Leute. Auch die Ladung ist vom Feinsten. Massenweise französischer Champagner, Cognac, Weine, Textilien, Maschinen und und und.“
Während dieses aus Terra nur so hervorsprudelte, brachte er es auch noch fertig, die Flasche schließlich selbst zu öffnen, einzuschenken, die Zigarettenstange aufzureißen, ein Päckchen zu öffnen, seinem Kommandanten eine Zigarette zuzuschnippen und Feuer zu reichen. Nun ging es Waldau völlig gegen den Strich, während der laufenden Operation Champagner zu trinken, wusste er aber auch, dass der Freund um nichts in der Welt hiervon abzubringen sein würde, es sei denn, er würde dienstlich. Dies allerdings schied aus naheliegenden Gründen wohl aus, wenn beste Freunde unter sich sind, was Terra genau wusste.
„Einen nehmen wir noch“, schenkte dieser sogleich nach.
„Und, was sagt unser Handelsschiffer, Sonderführer Manger“, wollte Didi wissen, „können wir das Schiff als Prise ausrüsten und hat es eine Chance in die Heimat durchzubrechen? Dann könnten wir ja auch gleich alle bisherigen Gefangenen abgeben. Schließlich ist der Dampfer ja mit seiner umfangreichen Passagiereinrichtung bestens geeignet.“
„Ja“, versicherte Terra seinem Kommandanten, „aber ein Problem haben wir schon, wir können nicht alle Passagiere an Bord lassen.“
Erstaunt sah Didi Waldau seinen Freund an: „Wieso, sag nur, wir haben einen französischen General oder Wissenschaftler oder so was erwischt?“
„Ne, ne, dass nicht, viel schlimmer!“
„Was denn, nun mal raus damit“, wurde Didi Waldau ungeduldig.
Der Graf öffnete den Mund, besann sich dann aber anders, zeichnete dafür aber mit dem Zeigefinger der rechten Hand einen Stern in die Luft.
„Scheiße“, entfuhr es Waldau, „das muss ja nun nicht sein. Und, was sollen wir deiner Meinung nach tun, die vielleicht hier an Bord holen? Das geht nicht, das gibt Ärger.“
Terra sprang auf: „Was denen in Deutschland blüht, bei Deinem geliebten Führer und seiner kackbraunen Mischpoke, ist Dir wohl klar. Das, mein Freund und Kommandant, vergiss mal lieber gleich!“
Bevor der Kreuzerkommandant antworten konnte, klopfte es an der Kabinentür.
„Gläser weg und die Flasche natürlich auch“, raunzte der nunmehr missgestimmte Kommandant seinen IO an. Dieser sprang auf und tat wie ihm befohlen. Danach ertönte das „Herein“, des Kommandanten und der 2. Offizier, Oberleutnant z. S Uwe Semmler, trat ein und meldete: „Rauchfahne Backbord aufkommend in Sicht, Herr Kaptän!“
„Danke, Herr Semmler, sofort Meldung, wenn Näheres auszumachen ist. Wahrschauen Sie Herrn Schmidt. Dieser soll ein verstärktes, weiteres Prisenkommando mit 20 Mann zusammenstellen, dafür sorgen, dass die Leute alle persönlichen Dinge mitnehmen und sich zum Franzmann drüben auf den Weg machen. Ich will sicher sein, dass uns von dort keine unangenehme Überraschung droht. Ausführung in spätestens 20 Minuten!“
Nachdem der IIO die Tür von außen wieder geschlossen hatte, blickte Waldau seinen Freund, immer noch etwas grantig, jetzt aber voller Erwartung, was sich hinter der Rauchfahne verbarg, an.
„So und jetzt mal Tacheles! Um wen oder was geht es drüben?“
„Zwei jüdische Medizinstudentinnen und den Schiffsarzt. Letzterer und die jüngere der beiden Studentinnen sind emigrierte Deutsche, sowie eine Französin.“
„Okay, Du fährst jetzt sofort mit dem Motorboot rüber, nimmst die Papiere von den Dreien wieder mit und gibst ihnen diese und lässt sie wissen, dass wir tun, was möglich ist. Der Schiffsarzt soll sich eine Krankheit für die beiden ausdenken, irgendetwas ansteckendes. Ach ne, ist ja blöd.“ Der Kommandant für sich durch die Haare und suchte verzweifelt auf die Schnelle nach einer passenden Lösung. Schließlich musste er diese sowohl seinem Offizierskorps an Bord, als auch der Besatzung ggf. einleuchtend darlegen können und evtl. auch später gegenüber seinen Vorgesetzten seine Entscheidung begründen können.
„Pass auf“, hatte er schließlich den, wie er meinte, zunächst jedenfalls rettenden Gedanken,
„Du sagt der Arzt und die beiden sind Medizinstudentinnen und die eine ist fast fertig?“
„Stimmt“, bestätigte Bodo Graf von Terra seinem Freund und Kommandanten.
„Aber ich glaube, ich habe schon die passende Lösung. Was hältst Du davon?“ Er legte eine kurze Kunstpause ein, wohl wissend, dass sein Freund Didi in solchen Momenten dieses gar nicht schätzte, steckte sich eine neue Camel an und brachte schließlich in überzeugendem Tonfall hervor: „ Die beiden Mädels sind Amerikanerinnen. Die Jüngere hat irgendeine merkwürdige Erkrankung, die dort drüben geheim gehalten wurde. Die Ältere ist ihre Begleitärztin. Die beiden sprechen fließend Englisch, das geht also glatt durch. Die passende Krankheit soll sich der Schiffsarzt des Franzosen ausdenken. Die Kleine ist in Frankreich krank geworden, im Pasteur-Institut in Paris behandelt worden und weil die nicht weiter wissen, jetzt auf dem Weg nach Amerika um dort weiter behandelt zu werden und ihre Begleitärztin benötigt dringend den dortigen Schiffsarzt, weil der mittlerweile mit dem Krankheitsbild vertraut ist. Darüber sollte der sich gefälligst Gedanken machen, was da in Frage kommt.“