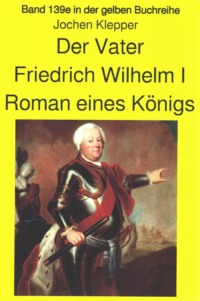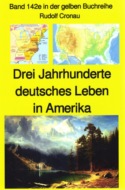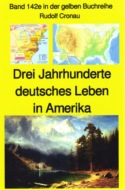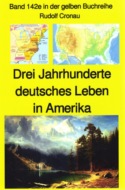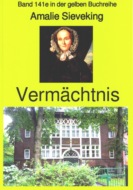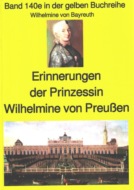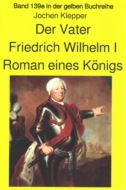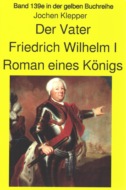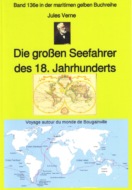Kitabı oku: «Jochen Klepper: Der Vater Roman eines Königs», sayfa 4
Es klang trotz der rauen, abgerissenen Sprechweise der jungen Hoheit nicht unfreundlich.
„Creutz.“ Der einfache Mann verneigte sich mit großer Höflichkeit.
„Creutz“, wiederholte der Prinz. Schon trat er aus der engen Kammer; und Name, Mensch und Schicksal waren ihm eingeprägt. Im Takte seines Rittes dachte er nichts mehr als die eigenen Worte: „Aber das ist wahr – das ist wahr –“
Woher nahm der Vater noch fünfzigtausend Taler für den Goldmacher? Er zahlte seinen Beamten die Gehälter nicht mehr und war seinen Großen tief verschuldet, die ihn ausgesogen hatten. Bei denen, die sich schamlos an ihm bereichert hatten, musste er borgen.
Aber dem Sohne schlug er es mit hochmütigem, mitleidsvollem Lächeln ab, als er ihn bat, seinen kronprinzlichen Etat von fünfunddreißigtausend Talern herabzusetzen. Das sei ein kleiner Etat. Der Kronprinz von Preußen müsse doch Tafel halten. Der erste Kronprinz von Preußen dürfe doch nicht derart bürgerliche Wäsche, Manschetten und Krawatten tragen. Von seiner Tafel, heiße es, stehe man manchmal hungrig auf.
Ach, über Tafel und Krawatten! Er brauchte sein Geld zu Wichtigerem; und dies war nun sehr seltsam: Genau die fünfzigtausend Taler hatte der Kronprinz gespart, die der Goldmacher vom König verlangte. Er hatte sie gespart, obwohl der eigene Vater ihm, noch als er Knabe war, schon über dreißigtausend Taler schuldete. Er hatte sie gespart, obwohl er gewaltige Mengen seines Knabentaschengeldes immer wieder in seine Miliz gesteckt hatte. Die war so angewachsen, dass er seine Leute in den Scheunen verstecken musste, kam der Vater König einmal nach Wusterhausen hinaus.
Er war bereit, seine Ersparnisse dem König zu leihen – zu solch harter Kur. Er wollte auch nur eine einzige Garantie von ihm: den Sturz der drei Minister, den Sturz vor allem Graf Wartenbergs. Denn der war Oberkämmerer, Erster Staatsminister, Generalpostmeister, Generalökonomiedirektor, Oberhauptmann der Schatullämter, Oberster Stallmeister aller Gestüte, Protektor der Akademien und Erbstatthalter der oranischen Erbschaft; er war es ohne jede Kontrolle und mit unumschränkter Verfügungsgewalt. Die Gräfin – einst die Frau des Kammerdieners Bidekap und im Packwagen aus Emmerich mitgebracht – schickte Geld nach England, denn sie traute Preußens Zukunft nicht recht; der Graf kaufte Güter in der Pfalz. Ihre Tafel kostete mehr als die königliche.
Der König dankte. Der König lehnte ab. Der Kronprinz investierte über zwanzigtausend Taler in „Bau Wusterhausen, Garten und Landmiliz“. So hatte die Preußische Krone ein schuldenfreies Gut. Der König pochte vor den Gläubigern auf seine oranische Erbschaft, gab dem Goldmacher Versprechen und hoffte.
* * *
Friedrich Wilhelm ersuchte den König um seine Entfernung vom Hofe.
Friedrich I. fand seinem Sohn gegenüber nur noch müde Gesten. Dabei war es doch durchaus kein ungebräuchliches Mittel, sich eines etwas schwierigen jungen Herrn für eine Weile dadurch zu entledigen, dass man ihn auf Reisen schickte. Aber selbst an diese Erwägung knüpften sich unangenehme Erinnerungen. Denn war der Kronprinz vielleicht auf die Große Tour gegangen, wie sie für Fürstensöhne üblich war? Hatte er sich etwa durch das Leben an fremden Höfen verfeinern lassen? Über Holland war er überhaupt nicht hinausgekommen. Und in Amsterdam hatte er lediglich die Polizei, die Armenhäuser, die Gefängnisse, Schiffe und Magazine besichtigt, in Leiden nur die Anatomie aufgesucht!
Aber gut, gut; mochte er doch wieder reisen auf seine Art. Im Augenblick war seine Abwesenheit nur zu genehm. Was er nur wünschte an Urlaub, Ermächtigungen, Empfehlungen, sollte ihm zugebilligt sein.
Aber der Kronprinz wollte gar nicht reisen. Er wollte in den Krieg nach Flandern; und in der Verfechtung dieses Planes entwickelte er eine rhetorische Gewandtheit, die man bis dahin noch nicht an ihm wahrgenommen hatte, dass er dem Vater seinen Willen klarzumachen suchte in dessen eigener Sprache und von der Fürstentragödie redete, die um die spanische Erbfolge aufgeführt werde: Das entschied den Erfolg seiner Bitte.
Die überraschenden Redewendungen gefielen dem Herrscher. Sie wären nicht bäurisch, wie so vieles an dem Sohn. Die Majestät raffte ihren Mantel zusammen und erhob sich. „Reisen Sie meinethalben auch nach Flandern – ich gewähre es Ihnen gern. Reisen Sie zu meinen Truppen – nur quälen Sie mich nicht mit Ihrer Engherzigkeit, Verzagtheit, Ihrer Kleingläubigkeit.“ Er wollte den aussichtslosen Kampf gegen seinen Sohn nicht weiterführen.
Die Kronprinzessin fand es angebracht, dass der Kronprinz sich nach der Taufe des Stammhalters nun auch den Truppen zeigen wollte. Solche Besuche bei der Armee waren abwechslungsreich und ungefährlich. Das wusste die junge Fürstin von Vater und Bruder, dem Kurfürsten und Kurprinzen von Hannover.
König Friedrich aber wurde plötzlich wieder besorgt um den einzigen Sohn; nirgends und niemals war er des vollen Einsatzes fähig. Er ließ dem Kronprinzen schriftlich einen Befehl zugehen, nach welchem er ihn zum Besuch der verbündeten Heerführer ins flandrische Hauptquartier entsandte, keineswegs aber in seiner Eigenschaft als Chef des Kronprinzenregimentes. Schreibend blieb der schwache Vater fest; der Begegnung mit dem Sohne wich er aus.
Der gesamte Hof glaubte, sobald der Aufbruch des Kronprinzen zur Armee bekannt geworden war, die junge Hoheit von dem Goldmacher in die Flucht geschlagen. Wer konnte ahnen, dass der neue Regimentsschreiber in der Wusterhausener Truppe des Kronprinzen ein Spürhund gegen Gaëtano war. Wer konnte wissen, wer der Schreiber Creutz war, wie sein junger Herr ihn fand und was er von ihm hielt.
* * *
Friedrich Wilhelm fügte sich den Wünschen des Vaters und Königs. Er hatte ja auch wirklich eine Fürstlichkeit im flandrischen Lager zu besuchen, freilich gerade einen großen Herrn, der am Berliner Hofe verfemt war: Herrn Leopold von Anhalt-Dessau.

Leopold von Anhalt-Dessau
Er hatte begonnen, all die Verbitterung zu verstehen, durch die sich der Fürst in den Kreisen des Hofes gar so unbeliebt gemacht hatte. Er fing an zu ahnen, warum der große General sich als Freiwilliger bei den brandenburgischen Truppen herumtrieb, obwohl ein Rangjüngerer das Kommando führte. Was noch groß war an Brandenburg, schien unlösbar an den Fürsten Anhalt-Dessau gebunden; er wollte nicht von seinem Werke lassen, die Truppen, die er vierzehn Jahre, in vierzehn Feldzügen für Brandenburgs Reichsdienst geführt hatte, ruhmreich zu machen. Er wollte nicht Berührung haben mit dem neuen Königshofe.
Der „Kronprinz in Preußen“ und Kurprinz von Brandenburg brach nicht zur Armee auf, nur weil es ihm verdrießlich war, lediglich dem Titel nach Regimentschef zu sein. Der Kronprinz in Preußen ging, den Dessauer zu suchen. Vielleicht sah der mit seinen Augen, hörte der mit seinen Ohren, redete der mit seiner Zunge. Einer musste doch noch sein! Man hielt sie voneinander getrennt!
Der Fürst von Anhalt-Dessau fuhr Friedrich Wilhelm entgegen.
* * *
Je mehr sie sich dem Lager näherten, desto stärker spürten der ältere und der jüngere Mann ihre Übereinstimmung.
Den letzten Teil der Reise hatten sie gemeinsam zurückgelegt. Der Kronprinz hatte nur wenig Kasten und Truhen als Gepäck bei sich. Er hielt sich nicht an das Feldlagerzeremoniell.
Dem Dessauer war es recht, wie der Thronfolger kam: zerstreut, wortkarg, noch ganz gefangen im Berliner Ärger. So, genau so, pflegte auch er selbst jedes Mal vom neuen Königshofe zu kommen!
Aber heute war des Prinzen schlechte Laune bald wie weggefegt.
Der Tag war da, an dem sie nun die ersten Truppen sahen. Sie waren noch nicht sechs Stunden gefahren. Es war gegen Mittag. Eine breite, blitzende Welle kam ihnen den Hang einer Erhebung entgegen, dichte Reihen von Soldaten. Fern hinter ihnen wehten schmale Wimpel von hohen Lanzen, Zeichen der Zelte, deren graue Spitzen vor dem Horizont der Ebene zum Gebirge wurden.
Man schien dem Frühling näher. Über den Stämmen der kahlen Bäume war ein feuchter, grüner Schimmer, Hauch des Frühlings über altem Holz. Der Schnee war getaut.
Die Mannschaften scharten sich zu schmalen Kolonnen, als sie am Reisewagen der Fürstlichkeiten vorbeimarschierten. Der Fürst und der Kronprinz lehnten sich aus dem Schlag. Den Dessauer erkannte jeder Soldat. Aber die Ordnung der Gruppen durfte durch die Begegnung nicht gestört werden. Darauf achtete der Fürst; das wussten sie und wollten keine schlimme Begrüßung.
Nur den Marsch des Dessauers stimmten sie an, den Marsch der Schlacht am Ritorto und des Sieges von Cassano:
„So leben wir, so leben wir –“
Der Zug war lang. Andere Lieder des Feldzugjahrzehntes folgten.
„Prinz Eugen, der edle Ritter –“

Prinz Eugen, der edele Ritter,
wollt' dem Kaiser wied'drum kriegen
Stadt und Festung Belgerad.
Er ließ schlagen einen Brucken,
dass man kunnt' hinüber rucken
mit d'r Armee wohl in die Stadt.
„Marlborough s'en va-t-en guerre, mironton, mirontaine –“
„Auf ein Lied, das Ihnen gilt, Hoheit.“ Der Dessauer beugte sich in den Sitz zurück und kramte eine Reiseflasche mit Schnaps hervor. Sie tranken ohne Becher, der Kronprinz nach dem Fürsten; dann wechselten sie ab. Friedrich Wilhelm hob die Reiseflasche wie ein schönes Glas.
„Für ein solches Lied gäbe ich alle Titel, Fürst.“

Eugen von Savoyen
Der Trinkspruch des Dessauers griff dem Prinzen ans Herz.
Aber niemals ist ein Lied auf Friedrich Wilhelm gesungen worden.
An der Tafel begrüßte Prinz Eugen von Savoyen den jungen Prinzen und den großen General mit höflicher Rede. Er stellte den Dessauer dem jungen Brandenburger hier draußen im Lager gleichsam von neuem vor: „Der Fürst von Anhalt-Dessau hat mit den brandenburgischen Truppen Wunder gewirkt. Kein Preis ist zu hoch, wodurch ich ihr Ausharren erkaufen kann.“
Der Kronprinz wandte keinen Blick von dem herrlichen Manne, der so begeistert von des Dessauers Heerschar redete – dem Manne, den der Sieg wie ein Schatten begleitete. Nun sah er ihn, der nur in Feldlagern Hof hielt: Prinz Eugen, den edlen Ritter – den heldischen Zwerg! Oh, es war etwas anderes, als unter Höflingen zu weilen!
Aber wenn Prinz Friedrich Wilhelm glaubte, auch den Fürsten von Anhalt-Dessau im Lager aufleben zu sehen, wie er selbst es tat, so täuschte er sich. Der Fürst wirkte plötzlich sogar ungemein ernüchternd auf ihn.

Der alte Dessauer – Fürst Leopold
Sein braunes Gesicht war faltiger, als seine Lebensjahre glauben ließen. Seine grauen Augen beobachteten mehr, als dass sie feurig strahlten, wie man immer pries. Mit seinem anliegenden, knapp zusammengebundenen frühen Grauaar und dem – an den Rang- und Standesgenossen gänzlich ungewohnten – kurzgeschnittenen Schnauzbart erschien Fürst Leopold fast streng und unfreundlich. Da begann der Kronprinz nachzuspüren und von Stunde zu Stunde mehr zu begreifen, wie die Heerführer auch im Felde noch an ihren Höfen litten, wie sie von Spionen ihrer Kabinette umgeben waren und, selbst wenn sie einig waren im Kriegsrat, der Verräter wegen einander zum Scheine widersprechen mussten wie Prinz Eugen und der Dessauer. Der Kronprinz sah den erschlichenen Sieg der héros subalternes über die Tapferen und Großen.
Gewiss, es klang überwältigend: England, Holland, Portugal, Dänemark, das Reich – von zwei Verrätern abgesehen – sind vom Kaiser zu einem gewaltigen Bündnis zusammengeschlossen gegen den vermessensten König, der je auf Frankreichs Thron saß!
Aber als Truppenkörper war eine solche Fülle der Nationalitäten schwierig zu lenken. Nach erschöpfenden Feldzugsjahren waren die Söldner jedes Heeresteiles zudem nur noch Hergelaufene aus aller Herren Ländern – auch die Offiziere; und Deutsche kämpften gegen Deutsche um Spaniens Thron: die Kurfürsten von Bayern und Köln hielten es mit dem König von Frankreich! Der junge Brandenburger stand verwirrt im Treiben des Lagers. Er fühlte, dass er keinem etwas galt: den großen Heerführern, den Fürsten alter Häuser nicht – den Offizieren seines Vaters am wenigsten.
Die bitterste Stunde aber kam für ihn, als sich in seiner Gegenwart zwei Offiziere der Verbündeten unendlich beleidigend darüber streiten durften, ob der „König in Preußen“ wohl fünfzehntausend Mann auf den Beinen halten könne.
„Mein Vater“, rief der Kronprinz voller Zorn und Scham, „kann, wenn er nur will, dreißigtausend Mann halten!“ Und er verschwieg: Wenn er nur dem Dessauer und mir seine Sache in die Hand gibt –. Ach, es genügt mir nicht, dass ich von fern ein wenig für die Verwundeten der letzten Schlachten sorge; dass ich Sonderentlohnungen vermittle; dass ich mir unentwegt berichten lasse; wahrhaftig, es ist nicht genug für einen Fürstensohn in dieser Zeit.
Er war verdammt, zu warten. Die Bäume wurden grün; und wo das Kriegsvolk nicht das Land zerstampfte, keimten Halme, ungleich und verstreut, aus Körnern, wie sie ohne Aussaat im Erdreiche lagen; aus Körnern, wie sie der Wind in den ängstlichen Ernten kriegerischer Vorjahre verwehte. Bauern hatten diese Felder nicht bestellt. Das Land gehörte den Söldnern.
* * *
Außer vom König empfing der Kronprinz auch sonst zahlreiche Post, wie jeder der großen Herren im Lager; nur dass die Schreiben, die ihm ausgehändigt wurden, nicht immer nur hochgestellte Absender hatten.
Gewiss, auch die Kronprinzessin teilte mit, sie habe sich seit Karnevalsbeginn an den Hof ihres Vaters nach Herrenhausen und Hannover begeben. Friedrich Wilhelm war von einer Last befreit, die ihn wochenlang bedrückt hatte. Der Kleine musste also gedeihen! Wie wäre die junge Mutter sonst zum hannoverischen Karneval gereist!
Aber auch der einfache Mann Creutz (Ehrenreich Bogislaus Creutz – 1670 – 1733) schrieb, und der Kronprinz war erstaunt, wie der neue Sekretär seiner Wusterhausener Landmiliz diese Kunst beherrschte, die im Volke nur sehr selten anzutreffen war.
Der königliche Münzmeister, so stand in dem Brief, habe in letzter Zeit einen Aufwand getrieben, der ihm vor des Conte Gaëtano Zeiten nicht möglich gewesen sei.
Der Graf aber habe sich, bevor er nach Berlin kam, in München den Umstand zunutze gemacht, dass nach der Schlacht von Höchstädt ein Volksaufstand ausgebrochen war. Ohne alle Papiere hatte er die Stadt verlassen; eine Flucht war es, keine Abreise. Der Kurfürst von Bayern, um unermessliche Summen von ihm betrogen, war gerade daran gewesen, ihn festsetzen zu lassen.
Creutz hatte auch sehr selbständig nachgeforscht, woher der Italiener nach München gekommen war: Er hatte am pfälzischen Hofe und bei dem Herzog von Savoyen Goldmacherdienste getan, und der Herzog, als er sich in den Händen eines Gauners und Gauklers sah, war so tief beschämt, dass er ihn dem verdienten Gericht nicht übergab, sondern mit allen erforderlichen Ausweisen nur heimlich des Landes verwies. Er hatte keine Sühne verlangt; er hatte sich nur mit der Zusicherung begnügt, dass Gaëtano in fremden Landen an keinem anderen Fürsten ähnliche Verbrechen begehen würde.
Aus solcher Scham des Herzogs von Savoyen flössen das Unglück und die Schande des ersten Königs von Preußen. Und die Schande erschien dem Thronfolger umso größer, je tiefer er mit seinem neuen Schreiber in die Vorgeschichte des Italieners eindrang. Der Kronprinz ließ es sich viel Reisegeld kosten. Der arme Mann Creutz sah die Welt. Aber er kam immer weiter von den Städten fürstlicher Höfe ab, drang in immer abgeschiedenere Gefilde, bis er es endlich wusste, dass Domenico Manuel Gaëtano der Sohn eines armen Bauern aus Petrabianca, weit hinter Neapel, war; ein kluger Sohn, ohne Frage, denn er hatte das feine Goldschmiedehandwerk gelernt und zudem, um das Lehrgeld bezahlen zu können, von Taschenspielereien sein Leben gefristet. Da fiel er einem Alchimisten auf; der wollte von dem gar so geschickten Burschen kein Lehrgeld; der bot ihm Löhnung und Kost.
Nach einem Jahre musste der Adept Gaëtano seine Heimat verlassen, und die Landreiter waren noch an der Grenze hinter ihm her. In Madrid war er schon kein Adept mehr. Dort begann er gleich mit eigener Alchimistenküche; dort wurde er auch gleich Betrüger genannt. Dafür trug die Frau, die mit ihm durch die Länder reiste, für eine halbe Million Taler Juwelen auf dem Leib und war doch nur eine Fleischerstochter aus einer so armen, dunklen Gasse, wie sie des hungrigen Mannes Creutz Jugend überschattet hatte.
* * *
Der dritte Kurier für den Kronprinzen kam mit Eilpost aus Hannover. Der Sohn war tot, die Kronprinzessin nach Berlin zurückgekehrt. Endlich versicherte noch ein Handschreiben König Friedrich I., die Trauerfeierlichkeiten würden bis zum Eintreffen des tiefbetrübten Vaters aufgeschoben werden, ihm eine Tröstung und Erhebung zu geben.
„Ich habe hier nichts zu suchen.“ Mit solchen Worten nahm der Kronprinz Abschied vom Dessauer. „Es war keine Schlacht. Es ist auch keine Schlacht in Vorbereitung. Man hält Reden, die Unfrieden stiften sollen im Reich. Ich werde dem König sagen, dass hier sein und aller Fürsten Geld vertan wird nur für Habsburgs Träume.“
Er ging vom flandrischen Lager weg, sein totes Kind zu sehen. Er hatte im Krieg nicht einen Toten erblickt.
Die Kinderfrauen beteuerten, was sich beteuern ließ. Die Ärzte wussten viele lateinische Gründe für den Tod seines Sohnes. Die Kronprinzessin hatte keinerlei Ahnung gehabt. Nun war sie leidend, sprach kaum mit dem Gatten.
Als man Friedrich Wilhelm zu der einbalsamierten Leiche des Kindes führte, wusste er, warum sein Sohn gestorben war.
Der Knabe Fridericus Ludovicus war aufgebahrt im schweren Purpurmantel, die Krone auf dem schwachen Haupt, Zepter und Reichsapfel in seinen welken Händen, das Band des Schwarzen Adlerordens über der Brust, den Stern über dem schweigenden Herzen. Die Schweizergarde hielt die Totenwacht, mit siebenhundert silbernen Trommeln. Vor Schloss und Dom standen die Kanonen bereit, gelöst zu werden zum Trauersalut.
Der König hatte einen Sarg von Gold anfertigen lassen; am Fußende war ein mächtiger Adler ausgebreitet.
Vom Morgen bis zur Dämmerung durfte das Volk vorüberziehen und die Aufbahrung bewundern. Dem Kinde kam Ehre zu. Es war als der nächste Thronfolger begrüßt und ein Glück des Geschlechtes genannt worden. Der Kronprinz sprach nicht. Nur bat er die Ansbacher Brandenburgerin, sich seiner Frau anzunehmen.
* * *
Der Dessauer hatte ihn dringend zurückgerufen. Als er ihn am Wagenschlag empfing, stürzte sich der Prinz in seine Arme.
Der Dessauer legte die Arme um ihn, ohne allen schuldigen Respekt. Er war ja selbst ein söhnereicher Vater.
„Mein Sohn lag in einem goldenen Sarge“, stöhnte Friedrich Wilhelm auf.
Da schauerte es den Dessauer. Und das geschah selten.
Niemand erschien seinem klaren Sinn geheimnisvoller als der junge Königssohn, von dem es an den Höfen immer nur hieß, dass er gewalttätig, eigenwillig und beschränkt sei und keine andere Bildung habe als die der Kaserne, keine andren Formen des Umgangs kenne als Kommandieren und Order parieren. Er müsse künftig einmal, so hatte es immer bei Hofe geheißen, die Minister für sich regieren lassen, denn er scheue ja die geringste geistige Anstrengung; er werde Verwicklungen herbeiführen und den Staat nicht schützen können. Wie sollte der Fürst von Anhalt-Dessau damit vereinen, was er nun im Lager sah!
Mit welchem Trübsinn grübelte der Prinz jetzt manchmal des Abends dem Fluch des eigenen Horoskopes nach; vielleicht dass Gott in seinen Sternen doch ein Zeichen gab! Das Zeichen der Unfruchtbarkeit war seinem Horoskope eingegraben.
Der Dessauer lachte den Prinzen aus, aber sein Lachen fand keinen Weg zum Herzen des trauernden jungen Vaters. Der Dessauer ließ nicht ab. Was hatte es denn mit Unfruchtbarkeit zu tun, wenn ihm sein erstes Kind starb! Er sollte doch einmal Umschau halten in den Häusern der Fürsten, der Bürger, der Bauern! Und war nicht seinem kurfürstlichen Großvater und selbst dem königlichen Vater das gleiche widerfahren, den ersten Sohn und ersehnten Thronfolger zu verlieren?
Der Kurprinz von Brandenburg beurlaubte sich vom Heer und reiste zu seiner Gattin, die sich im Kreise der Ihren in Hannover trösten ließ. Er fand sie in banger Sorge darüber, dass ihre Stellung am Berliner Hofe jetzt erschüttert sein könne. Er weilte einen Tag in stummer Anklage und Trauer bei ihr, und aus einer Nacht voller Fruchtbarkeit und Schwermut brach er wieder zu den Truppen auf.
Der unerfahrene Oberst Friedrich Wilhelm von Hohenzollern vertraute dem großen General Leopold von Anhalt-Dessau. Der hatte von der Schlacht gesprochen; nun würde sie sein.
Die Schlacht und der eigene Tod mochten kommen. Vielleicht wuchs schon der neue Sohn heran. Dachte der junge Fürst an die Schlacht, so war sein Gedanke nicht Sieg, sondern Tod.
Furchtbares musste sich vorbereiten: Aufruhr und Ausgleich neun kranker Jahre verschleppten und verrotteten Krieges. Der Kronprinz sah bereits mit des Dessauers Augen; er erkannte, dass Bündnis Handel war und Traktat nur Geschäft und Heer nur Söldnerhaufe; und Kampfgenossen waren die Rivalen ihrer Höfe. Tod musste wachsen, reif geworden in neun faulen Jahren. Er zwang sich, nicht an die neun Monate und das Reifen des neuen Kindes zu denken. Monat um Monat kämpften der Fürst und der Kronprinz vergeblich um den rechten Augenblick der Schlacht.
* * *
Dann, als es ein sehr zartes Mädchen war, ein Kind des Sommers, strafte Friedrich Wilhelm alles Gleichnis Lüge, verlachte die Horoskope und war den hohen Sommer hindurch guter Dinge und nur, wie mancher junge Vater es gewesen wäre, eine Kleinigkeit enttäuscht, dass es ein Mädchen war. Jedes der Eltern gab dem Kinde seinen Namen: Sophie die Mutter, Friederike Wilhelmine der Vater. Die Kronprinzessin blieb in den Sorgen, welche Politik sie nun, da kein Sohn geboren war, einzuschlagen habe, allein. Nur Briefe aus Hannover vermochten ihre Befürchtungen zu zerstreuen. Dann lenkten die Feiern sie ab. Mitten im großen Kriege Europas standen drei Könige Pate: Der „in“ Preußen. Der von Polen. Der von Dänemark.
Man machte viel Redens davon, dass alle drei den Namen Friedrich trugen und dass jeder einen einzigen Sohn besaß. Sie losten um den Vorrang. Der Hofdichter der preußischen Majestät malte – gegen einen Ehrensold von tausend Dukaten – die Allegorie aus und schrieb von den Heiligen Drei Königen und ihrer Myrrhe, ihrem Weihrauch und Gold.
Der Kronprinz hörte aus den üblen Versen nur den Kehrreim: Gold.
Weil es ein Mädchen war, trug das Kind bei der Taufe keine Krone, kein Zepter, keinen Reichsapfel, weder Ordensstern noch Purpur. Sie brachten ihm nur Gold zur Gabe: Die drei Könige, die drei mächtigen Minister, der Goldmacher.
Der Goldmacher und das Dreifache Weh hielten Friedrich Wilhelms zweites Kind mit den Königen über die Taufe, im zehnten Monat nach der Nacht der Fruchtbarkeit und Schwermut.
Im elften Monat war die Schlacht die blutigste des jahrelangen Krieges.
Bei Malplaquet war alles Heer zusammengezogen, und jede der Armeen, die hier miteinander ringen sollten, war über hunderttausend Mann stark.
Am Morgen lag der Nebel der Ebene und des Herbstes um die Zelte. Die Männer, die das Nebelmeer durchschritten, schienen über irdische Maße groß. So kamen, wie die Helden eines höheren Reiches, in dem ersten Lichte des Septembertages die Generale von Tettau und von Derschau vor das Zelt des Kronprinzen und nahmen der Ordonnanz ihren Dienst ab, den Sohn ihres Königs zu wecken. Der von Tettau stand zu Füßen des Feldbettes, im offenen Eingang des Zeltes. Schon schimmerte die Sonne in dem Nebel, und ein fahler Glanz umgab ihn.
„Ich komme Abschied zu nehmen“, sagte der von Tettau.

Julius Ernst von Tettau
Und Friedrich Wilhelm gab zurück: „General, wir reiten zusammen.“
Er war ganz wach, in einem Augenblick.
Der von Tettau schüttelte den Kopf. „Gebe Gott, dass wir nicht zusammen reiten. Mein Ritt geht in den Tod.“
Da stand die Sonne über dem Gebirge der Zelte, der Nebel wich, der Tag war da.
„Wer kann den Tod wissen?“ fuhr der Kronprinz auf und dachte daran, wie arm die Ahnungen und Zeichen der Menschen sind. Hatte sein Söhnlein nicht eine Krone getragen?
„Ich habe keine Zeit mehr zu reden“, sprach der von Tettau sanft, „ich habe nur noch etwas zu ordnen. Ihres Vaters Majestät hat mich im geheimen beauftragt, stündlich auf Ihr Wohl zu achten. Aber nun habe ich nur noch eine Pflicht und kann auf Sie nicht mehr achten.“
Friedrich Wilhelm hatte sich im Feldbett aufgesetzt. Er lächelte, jedoch in Unruhe. „Ich werde auf Sie achtgeben, General.“
„Keiner, Hoheit, kann uns bewahren“, griff nun der von Derschau ins Gespräch ein, „und niemand soll es. In uns ist keine Furcht.“
Der Kronprinz wandte sich um. Er suchte den von Derschau. Der stand zu Häupten seines Lagers. Der Kronprinz redete mit einer Heftigkeit, die fast etwas gequält schien. „Ja, ja, ja – alles kann sein. Die Schlacht wird kommen und wie jede Schlacht Tote bringen. Dies kann man sehr wohl vorher wissen. Aber wer es sein wird, vermag der Mensch nicht zu ahnen.“
Der von Tettau sagte: „Wenn Gott es will – ja.“
Und der von Derschau sprach nach: „So fest, dass kein Zweifel ist.“
Friedrich Wilhelm sprang aus dem Bett. Er goss sich aus seinem Ledereimer das Wasser über das Gesicht, die entblößten Schultern und Arme, griff nach dem Rock und den Stiefeln. Er wollte hinaus, noch einmal zum Prinzen Eugen, zum Herzog von Marlborough, in letzter Stunde alles vor ihnen zu wiederholen, was er seit Tagen immer wieder vorgehalten hatte: dass es nun, nach so vielen versäumten Monaten zu spät war für die Schlacht. Man werde aller Voraussicht nach siegen, ja und abermals ja, aber die Opfer seien zu groß; niemand könne solche Verantwortung auf sich laden.
Er hat den Herzog von Marlborough, er hat den Prinzen Eugen nicht erreicht. Sie waren für die jungen Herren aus großem Hause nicht zu sprechen. Sie hielten ihn hin. Zwei breite Ströme, wälzte sich nun das Heer gegen Mons und Malplaquet. Zur Rechten sangen sie vom „Edlen Ritter“, zur Linken klang „s'en va-t-en guerre ...“ Vom jungen Prinzen, der allein die rechte und die schlechte Stunde dieser Schlacht erkannt hatte, sang kein Grenadier, kein Kanonier, kein Reiter.

Schlacht bei Malplaquet – 1709

Schlacht bei Malplaquet – 1709
Niemand hat an diesem Tage Rat oder Tat von ihm gefordert, obwohl er sich in der Schlacht beständig bei den beiden hohen Feldherren hielt. Aber der Tod wollte Antwort von ihm auf mancherlei Frage.
Ein Sattelknecht des Prinzen von Savoyen ritt hinter Friedrich Wilhelms Pferd, ganz dicht.
Nur dass sich des Sattelknechts Pferd, ganz nahe an seiner Seite, bäumte: dann verlor es sich herrenlos im Gewühl, und Rappen und Schimmel sprengten über den Leichnam des Burschen. Die beiden Ordonnanzen des Kronprinzen sprengten heran, ihn von dem gefährdeten Platze wegzuholen. Mit aufgehobenen Händen wehrte Friedrich Wilhelm ab: „Nicht näherkommen – nicht näher!“
Da sanken sie unter die Hufe, beide im gleichen Augenblick.
„Wir müssen über tausend Mann verloren haben“, rief der Adjutant des Herzogs von Marlborough dem Kurprinzen von Brandenburg zu, als es wie eine Pause war im Pfeifen der Kugeln.
So begann das Zählen, die grausige Rechnung des Sieges. Die Stunden des steigenden Tages nahmen die Tausende und aber Tausende hin; sechzigtausend mussten sterben, ehe das letzte große Heer des Sonnenkönigs geschlagen war. Der ungenannte Sieger neben dem Prinzen Eugen und dem Herzog von Marlborough war der Fürst von Anhalt-Dessau mit der Truppe, die er nicht befehligen durfte, weil die Höflinge den hellen Klang seines Namens nicht mehr ertrugen.
Als der von Derschau und der von Tettau tot am Sohne ihres Herrn vorübergetragen wurden, war der Sieg schon entschieden, nur dass die Völker und die Fürsten und die Söldner um seine Sinnlosigkeit noch nicht wussten. Der Kaiser wollte nicht den Frieden. Er wollte den greisen Sonnenkönig dazu zwingen, gegen den eigenen Enkel zu Felde zu ziehen.
Der Erbe Brandenburgs ritt aus der Schlacht, ein Grübler.
Sein anklagender Hass gegen den Bourbonen und den Habsburger wurde sehr groß. Das Amt eines Landesherrn wurde ihm noch größer. Die Fragen, die auf ihn einstürmten, setzten sich in ihm fest für immer, nicht nur für die Nacht von Malplaquet.
Der Königssohn trat seine Pilgerfahrt an durch die Nacht des Todes, die Söhne des Landes zu suchen, dessen Fürst er einmal werden sollte.
Aber hier blieb er schon bei einem Dänen stehen; dem bettete er den Kopf auf den Mantel, den er einem Toten ausgezogen hatte. Und dort befreite er einen ächzenden Portugiesen, der sich nicht vom Fleck bewegen konnte, von der Last des über ihn gestürzten Pferdeleichnams. Mehr vermochte er nicht zu helfen. Doch lernte er in dieser Stunde die Milde roher Männer kennen. Überall suchten sie mit flackernden Laternen das Feld ab, in Gebüschen, unter Kanonentrümmern, bei zersplitterten Bäumen. Überall stützten sie Sterbende, tränkten sie Verdurstende, verbanden sie Blutende; und als vermöchte es eine Linderung des Geschickes zu bedeuten, strichen sie den Toten über die Lider. Als er einsah, dass es kein Helfen gab in dieser Nacht des Leidens, hockte er sich auf einen Baumstumpf und sah den Lichtern nach. Was der Morgen ihm enthüllen würde, machte ihn zur Nacht schon frösteln. Er wollte hin zu den Laternen. Er ging den Trägern nach. Vier Männer schleppten einen, voran schritt einer mit dem Stalllicht. Sie hatten ein Haus am Feldrand entdeckt. Die Dörfer waren fern, und ihre geringe Zahl vermochte das Heer der Verblutenden nicht zu fassen.
Das nahe Gehöft war eine Schenke. Es ging hoch her in ihr. Sie feierten den Sieg; nur Männer, nur Soldaten fand er vor. Sie hatten das längst von Wirt und Frau und Knecht und Magd Und Kind verlassene Haus aufgespürt. Der Stall war niedergebrannt; das Haus stand beinahe unversehrt. Am Brunnenschwengel war ein Kalb angebunden gewesen, und in dem Keller hatten heil die Fässer flämischen Weines gelegen.