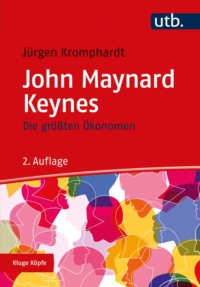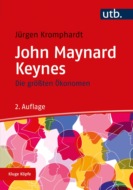Kitabı oku: «John Maynard Keynes», sayfa 2
Ein streitbarer Politökonom (Vom 1. Weltkrieg bis zur Weltwirtschaftskrise)
Berater und Repräsentant des Schatzamtes
AWeltwirtschaftskriseuch für Keynes brachte der 1. Weltkrieg einschneidende Änderungen. Seine fundierten Kenntnisse der internationalen Finanz- und Währungsprobleme veranlassten das britische SchatzamtSchatzamt (die „TreasuryTreasury“), ihn als Berater einzustellen; binnen kurzem war er für die Finanzierung der Kriegsausgaben Großbritanniens und seiner Verbündeten zuständig und steuerte die Verhandlungen über DarlehenDarlehen der USAUSA an GroßbritannienGroßbritannien einerseits und von Großbritannien an die mit ihm verbündeten Staaten auf dem Kontinent andererseits. Sein Überblick und sein Argumentations- und Verhandlungsgeschick ließen ihn rasch zu einer einflussreichen Person im Schatzamt werden.
Keynes schrieb zahlreiche Memoranden und persönliche Briefe, die den Band. 16 seiner „Collected Writings“ (1971ff.) füllen, die lange nach seinem Tod von der „Royal Economic SocietyRoyal Economic Society“ herausgegeben wurden (zur Zitierweise siehe S. 181f).
So war es folgerichtig, dass Keynes nach dem Ende des Krieges in der britischen Delegation als Vertreter des Schatzamtes an der Pariser Friedenskonferenz teilnahm und zum offiziellen Repräsentanten des britischen Empires im „Supreme Economic Council“ bestimmt wurde. Er befasste sich nicht nur mit der Frage der Reparationszahlungen Deutschlands und seiner Verbündeten, sondern auch mit dem Problem, wie mit den Forderungen und Verbindlichkeiten umzugehen sei, die durch die KriegsfinanzierungKriegsfinanzierung zwischen den Allierten entstanden waren.
Keynes kämpfte für einen Friedensschluss, in dem die ReparationenReparationen, die insbesondere DeutschlandDeutschland zu zahlen hatte, auf eine Größenordnung beschränkt wurden, die Deutschland zu leisten in der Lage wäre, ohne dass seine Wirtschaft darunter zusammenbricht.
Nachdem er sich nicht durchsetzen konnte, schied er nach fünf Monaten harter Arbeit am 5. Juni 1919 aus der britischen Delegation aus.
Kasten 3: Wichtige Schriften von Keynes bis 1929
Indian Currency and Finance (1913). CW, Vol. 1
Treatise on Probability (1921). CW, Vol. 8
The Economic Consequences of the Peace (1919). CW, Vol.2Deutsch: Die Wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrages (1920)
A Revision of the Treaty (1922). CW, Vol. 3Deutsch: Revision des Friedensvertrages (1924)
A Tract on Monetary Reform (1923). CW, Vol. 4Deutsch: Ein Traktat über Währungsform (1924)
Does Employment Need a Drastic Remedy? (1924). CW, Vol. 19,1.
The Economic Consequences of Mr. ChurchillChurchill (1925). CW, Vol. 9Deutsch: Die wirtschaftlichen Folgen von Mr. Churchill (Keynes, 1956)
Am I a Liberal? (1925). CW, Vol. 9Deutsch: Bin ich ein liberaler? In: Reuter, Norbert (2007) sowie in: John Maynard Keynes Ausgewählte Abhandlungen (1956)
Can Lloyd George Do it? (1929). CW, Vol. 9
Die wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrages
Voller Zorn über die Uneinsichtigkeit und teilweise Borniertheit der Siegermächte schrieb Keynes in den vier Monaten nach seinem Ausscheiden das Buch „Die wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrags“ (1919/1920).
Keynes verband seine Analyse mit einer ziemlich drastischen Kritik an den führenden Vertretern der damaligen Siegermächte, insbesondere an Georges ClemenceauClemenceau und an dem US-amerikanischen Präsidenten Woodrow WilsonWilson Das Buch hatte einen immensen Erfolg und machte Keynes mit einem Schlag weltweit berühmt. Schon im Laufe des Jahres 1920 wurde es in 10 Sprachen übersetzt (darunter ins Russische und ins Chinesische); bis 1922 wurden insgesamt 140.000 Exemplare verkauft. Keynes machte sich zugleich bei vielen politisch Verantwortlichen sehr unbeliebt, besonders in FrankreichFrankreich und den USAUSA.
Die deutsche Übersetzung ist eine um ca. ein Viertel gekürzte Fassung. Sie erschien 1920 mit dem Titel „Die wirtschaftlichen Folgen des Friedenvertrags“ im Verlag Duncker & Humblot. 2006 ist sie unter dem Titel „Krieg und Frieden. Die wirtschaftlichen Folgen des Vertrages von Versailles“ mit einer neuen längeren Einleitung vom Verlag Berenberg (Berlin) erneut veröffentlicht worden.
Die grundsätzliche Einstellung von Keynes zum Friedensvertrag wird aus folgender Passage deutlich: „Durch krankhafte Täuschung und rücksichtsloses Selbstbewußtsein getrieben, stürzte das deutsche Volk die Fundamente, auf denen wir alle lebten und bauten. Aber die Wortführer des französischen und des britischen Volkes haben das Wagnis unternommen, den Umsturz zu vollenden, den DeutschlandDeutschland begann, durch einen Frieden, dessen Verwirklichung das empfindliche, verwickelte, durch den Krieg bereits erschütterte und zerrissene System, auf Grund dessen allein die europäischen Völker arbeiten und leben können, noch weiter zerstören muß, statt es wiederherzustellen.“ (1919/2006, S. 39)
Zur Fundierung seiner Kritik versucht Keynes unter Heranziehung aller Informationen über die Produktion wichtiger Rohstoffe (insbesondere Kohle) und Produkte sowie über den Außenhandel abzuschätzen, welche ReparationsleistungenReparationsleistungen DeutschlandDeutschland maximal erbringen kann. Er unterstreicht, dass Deutschland auf Dauer nur Reparationsleistungen erbringen kann, wenn es entsprechende Überschüsse in der Leistungsbilanz erwirtschaftet, wenn ihm das Ausland mithin genügend hohe Exporte ermöglicht, indem es seine Märkte für deutsche Waren öffnet. Auf solche Überlegungen nimmt der Friedensvertrag von Versailles keine Rücksicht. Stattdessen legten es seine Vorschriften darauf an, Deutschlands Wirtschaft am Boden zu halten – was auch die Prosperität der europäischen Siegermächte beeinträchtigen und die Quelle von Hungersnot und politischer Unruhe sein werde.
Drei Jahre später veröffentlicht Keynes einen Folgeband (Revision of the Treaty, 1922). In diesem Band, von Keynes selbst als Folgeband zu den „Economic Consequences of the Peace“ bezeichnet, konzentriert sich Keynes auf die Entwicklung der Reparationsfrage in den zwei Jahren nach dem Friedensvertrag von Versailles, dessen Bestimmungen er 1919 so heftig kritisiert hatte. Keynes berichtet, dass die ungeklärte Reparationsfrage nach wie vor die politische und ökonomische Situation in Europa belaste, zumal es für DeutschlandDeutschland unmöglich sei, die ursprünglich geforderten Zahlungen zu leisten. Er macht weitreichende Vorschläge, die zu einer drastischen Reduktion der Reparationsforderungen geführt hätten, verbunden mit einem Verzicht der USAUSA und Großbritanniens auf Rückzahlung ihrer im Krieg gewährten Kredite an ihre Verbündeten (USA vor allem an GroßbritannienGroßbritannien, dieses wiederum vor allem an FrankreichFrankreich). Erfolg hatten diese Vorschläge leider nicht.
Daher äußerte sich Keynes weiterhin zur Reparationsfrage und insbesondere zu der Frage, wie und mit welchen Konsequenzen die in deutscher Währung an die Reparationsagenten der Siegermächte geleisteten Zahlungen in Devisen transferiert werden können. Seine Auseinandersetzung mit Bertil Ohlin ist in Band. 11 der Collected Writings nachzulesen und seine sonstigen Artikel, Memoranden und Briefe dazu füllen den Band. 18.
Erst 1931 in der WeltwirtschaftskriseWeltwirtschaftskrise, als es ökonomisch und vor allem politisch zu spät war, wird auf der Konferenz von Lausanne ein Ende der Reparationszahlungen vereinbart.
Keynes nutzte auch in anderen Bereichen sein hohes Renommee, um die öffentliche Meinung und die Entscheidungen der Träger der Wirtschaftspolitik zu beeinflussen. Zu diesem Zweck schrieb er nicht nur zahlreiche Beiträge und Leserbriefe an die führenden Zeitungen, sondern kaufte 1923 zusammen mit Gleichgesinnten die Wochenzeitung „The Nation and AthenaeumNation and Athenäum“, deren Leitung er übernahm und für die er regelmäßig Beiträge schrieb. Zwei Themenkomplexe standen dabei neben der Reparationsfrage im Vordergrund: Zum einen seine Forderung, die Währungspolitik solle zu einem stabilen Preisniveau beitragen; zum anderen die pragmatische Neuausrichtung der liberalen Partei. Diese hatte sich Ende 1918 gespalten, was ihren Niedergang einleitete. Nachdem sie nach den Wahlen 1922 stark geschwächt in die Opposition gehen musste, wurde eine Erneuerung ihres Programms sehr dringlich.
Kampf für eine preisniveaustabilisierende Währungspolitik
Schon in seinem Buch über Indiens Währung und Finanzen hatte die Frage, wie der Außenwert der indischen Rupie im Verhältnis zum PfundPfund und zum GoldGold festgesetzt werden sollte, großen Raum eingenommen. Die entsprechende Frage stellte sich nach dem Kriegsende für das britische Pfund selbst, jetzt im Verhältnis zum Gold und damit zu allen anderen an das Gold gebundene Währungen. GroßbritannienGroßbritannien hatte im 1. Weltkrieg den GoldstandardGoldstandard suspendiert. Viele Politiker strebten dahin zurück, und zwar zur alten Vorkriegsparität, obwohl sich britische Erzeugnisse seitdem stark verteuert hatten.
In seinem „Tract on Monetary Reform“ aus dem Jahre 1923 (in deutsch erschienen als „Ein Traktat über Währungsreform“, München 1924) verabschiedet sich Keynes von der traditionellen Orientierung der Geld- und Währungspolitik am Außenwert der Währung und fordert ihre Ausrichtung am Binnenwert und spricht sich damit für eine Stabilisierung des Preisniveaus aus. Er begründet dies mit den unerwünschten Folgen von InflationInflation und DeflationDeflation:
„Jeder Prozeß, die InflationInflation und die DeflationDeflation in gleicher Weise, hat schwere Schäden angerichtet. Jeder hat eine Wirkung, indem er die Verteilung der Güter auf verschiedene Klassen beeinflußt; und darin ist die Inflation der schlimmere von beiden. Jeder hat auch eine Wirkung, indem er die Erzeugung von Gütern steigert oder hemmt, obschon hier die Deflation die schädlichere ist (1923/1924, S. 4).“
Die InflationInflation schade den Sparern, begünstige die Unternehmen und sei wahrscheinlich vorteilhaft für die Lohnbezieher. Die Ungerechtigkeit gegenüber den Sparern vermindere deren Spartrieb (diesen sieht Keynes damals offenbar noch uneingeschränkt positiv). Die DeflationDeflation dagegen schade vor allem den Unternehmen, die ihre Produktion einschränken, und den Arbeitnehmern, die Arbeitsplätze verlieren.
Im Traktat argumentiert Keynes mit der QuantitätstheorieQuantitätstheorie, derzufolge eine Erhöhung der GeldmengeGeldmenge langfristig zu einem gleich großen Anstieg des Preisniveaus führt: Die mengenmäßige Produktion ist durch die vorhandenen, stets ausgelasteten Ressourcen an Arbeit und Kapital begrenzt, kann also nicht steigen. Auch die von der Bevölkerung und den Unternehmen gewünschte KassenhaltungKassenhaltung in Relation zu ihrem Einkommen ist von der Geldmenge unabhängig. Daher führt eine Verdopplung der Geldmenge auf Dauer zu einer Verdopplung des Preisniveaus (Kasten 4).
Kasten 4: Zur QuantitätstheorieQuantitätstheorie
Diese altehrwürdige Theorie basiert auf einer Definitionsgleichung, die GeldmengeGeldmenge (M), PreisniveauPreisniveau (p), reales Volkseinkommen (X) und Kassenhaltungskoeffizient (k) in Beziehung zueinander setzt:
M = k · p · X
Der Parameter k lässt sich nicht unabhängig ermitteln; er ist als Restgröße definiert, sodass Gleichung (1) immer erfüllt ist.
Im 2. Schritt wird angenommen, k und X seien langfristig gegeben (unabhängig von der GeldmengeGeldmenge). Dann müssen sich M und p proportional entwickeln.
Diese Behauptung wird von dem führenden deutschen Monetaristen Manfred J.M. NeumannNeumann (2012, S. 9) deutlich abgeschwächt: „(Es) wird nicht behauptet, dass es in jedem Fall zu einer InflationInflation kommen müsse, wenn die GeldmengeGeldmenge stärker wächst, oder gar, dass die Entwicklung des Preisniveaus mit der Geldmenge hochgradig korreliert sein müsse. Nur im Verlauf von Hyperinflationen, also Inflationsprozessen mit Zuwachsraten von mehr als 50 Prozent pro Monat, ist das eindeutig beobachtet worden, …“
Im 3. Schritt wird angenommen, die GeldmengeGeldmenge sei exogen, das heißt, sie werde von außen (insbesondere von der Zentralbank) bestimmt. Daher sind Änderungen der Geldmenge die Ursache der Änderungen des Preisniveaus.
Keynes (1923/1924, S. 76) stimmt dieser Aussage als langfristiger Beziehung zu: „Diese Theorie ist grundlegend. Ihre Übereinstimmung mit den Tatsachen ist fraglos“. Er betont aber, dass sie nur langfristig gelte. Kurzfristig könne der Kassenhaltungskoeffizient schwanken, und das müsse bei der politischen Anwendung berücksichtigt werden. Man dürfe sich nicht auf die Langfristbeziehung beschränken. Keynes begründet dies mit seinem berühmtesten Ausspruch (S. 83): „Die lange Sicht ist ein schlechter Führer in bezug auf die laufenden Dinge. Auf lange Sicht sind wir alle tot. Die Volkswirtschaft (-slehre – JK) macht es sich zu leicht und macht ihre Aufgabe zu wertlos, wenn sie in stürmischen Zeiten uns nur sagen kann, daß, nachdem der Sturm lang vorüber ist, der Ozean wieder ruhig sein wird.“
Keynes’ Sorge vor den negativen Folgen einer DeflationDeflation für die Verteilung und für die Beschäftigung führte zu seiner Ablehnung der Pläne, zum GoldstandardGoldstandard und zur Vorkriegsparität des Pfundes gegenüber dem GoldGold zurückzukehren. Dieser Schritt würde nämlich die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der britischen Industrie beeinträchtigen. Zwar könne man dies durch eine allgemeine Lohn- und Preissenkung vermeiden. Aber Keynes sah keinen praktischen Weg, eine solche Lohn- und Preissenkung herbeizuführen.
Keynes präsentierte seine Kritik in zahlreichen Aufsätzen und Vorträgen (nachzulesen im Band. 19 seiner „Collected Writings“). Nachdem Winston ChurchillChurchill als britischer Schatzkanzler trotz der Einwände von Keynes Ende April 1925 die Rückkehr zum GoldstandardGoldstandard und zur Vorkriegsparität angekündigt hatte, fasste Keynes seine Position in drei Artikeln im „Evening Standard“ zusammen, die er unverzüglich auch als Streitschrift im Verlag seiner Bloomsbury-Freunde mit dem provokanten Titel „The Economic Consequences of Mr. Churchill“ veröffentlichte.
Keynes stützte sich vor allem auf ein Argument: Soll die Wettbewerbsfähigkeit der britischen Industrie erhalten bleiben, müssen die Preise ihrer Produkte gesenkt werden und als Voraussetzung dafür die Löhne. Dafür gäbe es zwei Wege: Entweder müssen Arbeitgeber und Regierung diese gegen die einzelnen Gewerkschaften durchsetzen, ohne dass es eine Garantie für ein faires Ergebnis gibt, oder die Zentralbank verfolgt eine sehr restriktive GeldpolitikGeldpolitik, welche die InvestitionenInvestitionen abwürgt, die ArbeitslosigkeitArbeitslosigkeit erhöht und dadurch den Widerstand der Gewerkschaften schwächt.
Dabei befasste sich Keynes auch mit dem Problem, dass bestimmte Industriezweige (vor allem die metallverarbeitende Industrie) besonders stark betroffen waren, und er beteiligte sich an Plänen zur Umstrukturierung einzelner Branchen (z.B. der Baumwollindustrie) – siehe dazu im Einzelnen den Band. 19 seiner „Collected Writings“.
Keynes machte ChurchillChurchill nicht persönlich verantwortlich, sondern vermutete, dass seine Berater ihn in die Irre geführt hätten. Und warum? Sie unterschätzten das Ausmaß der erforderlichen Preisanpassung und die Schwierigkeit ihrer Durchsetzung. Vor allem aber glaubten sie an die automatische und schnelle Anpassung des Preisniveaus durch eine „gesunde“ Politik der englischen NotenbankNotenbank, wodurch die Kosten in Form höherer ArbeitslosigkeitArbeitslosigkeit gering blieben.
Keynes’ Sorgen erwiesen sich als berechtigt: Zum einen brach alsbald ein langer Streik der Arbeiter im KohlenbergbauKohlenbergbau gegen Lohnkürzungen aus, und zum anderen blieb die ArbeitslosenquoteArbeitslosenquote in GroßbritannienGroßbritannien bis zur WeltwirtschaftskriseWeltwirtschaftskrise ziemlich unverändert bei rund 10 %. Die hohe ArbeitslosigkeitArbeitslosigkeit erwies sich nicht als eine vorübergehende Fehlentwicklung, wie dies von der herrschenden Theorie behauptet wurde. Keynes erkannte dies, aber es sollte noch viele Jahre dauern, bis er seine eigene Theorie zur Erklärung von Arbeitslosigkeit entwickeln konnte (siehe dazu die drei nachfolgenden Kapitel ab S. 33).
Unterstützung der „Liberalen Partei“ bei ihrer programmatischen Erneuerung
LiberaleDie beharrlich hohe ArbeitslosenquoteArbeitslosenquote und die damit verbundenen sozialen Probleme veranlassten Keynes, der als Liberaler zwischen den Konservativen und der Labour-PartyLabour-Party stand, eine Neuausrichtung der Liberalen ParteiLiberale zu fordern. Diese war umso nötiger, als diese Partei ihre frühere Bedeutung in den Wahlen von 1925 völlig verloren hatte.
In einem in der „Liberal Summer School“ im August 1925 gehaltenen Vortrag „Am I a Liberal?“, den er in demselben Monat in zwei Artikeln in „Nation and AthenaeumNation and Athenäum“ veröffentlichte, präsentierte Keynes (1925/2007) seine Vorstellungen von einer erneuerten liberalen Partei: Die Konservative Partei biete ihm nichts. Sie sollte eine Version des Individualkapitalismus entwickeln, die den veränderten Umständen angepasst ist. Dazu sei sie nicht in der Lage: „Die Schwierigkeit liegt … darin, daß die kapitalistischen Anführer in der Geschäftswelt und im Parlament unfähig sind, neue Maßnahmen zum Schutz des Kapitalismus von dem zu unterscheiden, was sie Bolschewismus nennen“ (1925/2007, S. 106). Daher werden notwendige Anpassungen jedenfalls von ihrem reaktionären Flügel abgelehnt.
Bei der „Labour Party“ sehe es nicht besser aus. Sie werde immer einen starken Flügel haben, der den Kapitalismus stürzen will. In GroßbritannienGroßbritannien sei dieser Flügel zahlenmäßig sehr schwach. Trotzdem durchdringt seiner Ansicht nach ihre Philosophie in einer abgeschwächten Form die Arbeiterpartei (ebda, S. 106/7).
Dazwischen sollte – so Keynes – eine Partei existieren, „die unvoreingenommen zwischen den Klassen stehen und frei sein könnte, die Zukunft sowohl unabhängig vom Einfluss des Reaktionismus als auch von dem der Zusammenbruchsdoktrin zu gestalten, die die Grundlage des jeweils anderen ruinieren wollen“ (S. 107). Welche Positionen sollte eine solche liberale Partei vertreten? Sie müsse sich vom altmodischen Individualismus und von Laissez-FaireLaissez-Faire in strenger Form verabschieden und sich den Fragen zuwenden, die heute von vitalem Interesse und vorrangiger Bedeutung sind (Über „The End of Laissez-Faire“ hatte Keynes schon 1924 einen Vortrag gehalten, den er 1926 in der Hogarth-Presse veröffentlichte).
Im Vordergrund stünden fünf Gruppen von Fragen: 1. Friedensfragen (Keynes spricht sich für Pazifismus aus). 2. Rolle und Ordnung des Staates (Keynes spricht sich für halbautonome Körperschaften aus). 3. Geschlechterfragen. (Keynes fordert die Lockerung rigider Gesetze, z.B. bzgl. der Geburtenregelung) 4. Grenzen des Verbots von Rauschmitteln, insbesondere Alkohol und 5. Wirtschaftliche Fragen. Hier fordert Keynes den „Übergang von wirtschaftlicher Anarchie zu einem Regime, das bewusst auf eine Überwachung und Lenkung der wirtschaftlichen Kräfte im Interesse von sozialer GerechtigkeitGerechtigkeit und gesellschaftlicher Stabilität zielt“ (S. 112). Dies „wird enorme technische wie politische Schwierigkeiten mit sich bringen. Dennoch behaupte ich, daß es die wahre Bestimmung des Neuen Liberalismus ist, hier die Lösung zu suchen“ (S. 113).
Einen Ansatz für eine solche Lösung hatte Keynes (1924) in einem Beitrag in der Zeitschrift „The Nation and AthenaeumNation and Athenäum“ skizziert. Dort forderte er zur Bekämpfung der hohen ArbeitslosenquoteArbeitslosenquote eine Kooperation zwischen Staat und Wirtschaft, um langfristig notwendige InvestitionenInvestitionen zu finanzieren, vor allem in den Bereichen Wohnungsbau, Verkehrsinfrastruktur und Stromversorgung. Auf diese Weise sollen die privaten Finanzmittel, die bislang in den Kauf ausländischer Papiere fließen, in produktive inländische Projekte gelenkt werden, und damit zugleich die Beschäftigung erhöhen.
Die von Keynes angesprochenen Fragen wurden in und außerhalb der liberalen Partei heftig diskutiert. An der Diskussion der wirtschaftlichen Fragen nahm Keynes intensiv teil. Eine Gelegenheit und Notwendigkeit, die von ihm geforderten neuen Maßnahmen und Instrumente zu präzisieren, ergab sich, nachdem Lloyd GeorgeGeorge, der Vorsitzende der Liberalen ParteiLiberale, für die Unterhauswahlen 1929 in seinem Wahlprogramm ein Programm öffentlich finanzierte Maßnahmen vorsah. Dieses sollte jährlich 100 Mio. PfundPfund Sterling kosten und 500.000 Arbeitnehmern eine Beschäftigung verschaffen.
In GroßbritannienGroßbritannien hatte die ArbeitslosenquoteArbeitslosenquote in der Zeit nach dem 1. Weltkrieg in jedem Jahr (außer 1924) bei oder leicht über 10 % gelegen; im April 1929 entsprach dies 1,14 Mio. Arbeitslosen. Für die Arbeitslosen wurden jährlich Unterstützungen von ca. 50 Mio. PfundPfund Sterling ausgegeben. Angesichts solcher Verschwendung produktiver Ressourcen befürworteten Keynes/HendersonHenderson (1929) unter dem Titel „Can Lloyd GeorgeGeorge do it?“ dieses Programm, und die Autoren wendeten sich gegen die zwei verbreitesten Gegenargumente, nämlich:
Die vom Staat dafür aufgenommenen Finanzmittel verringern nur das Kapitalangebot für die Privaten.
Kreditfinanzierte StaatsausgabenKreditfinanzierte Staatsausgaben führen nur zu InflationInflation.
Das erste Argument entspricht dem ominösen „Treasury ViewTreasury View“, den der britische Schatzkanzler in seiner Budgetrede so formulierte: „Es ist die immer mit Festigkeit vertretene Lehre des Schatzamtes, dass durch Staatsverschuldung und StaatsausgabenStaatsausgaben … sehr wenig zusätzliche Beschäftigung und keine dauerhafte Beschäftigung bewirkt werden kann“ (Keynes/HendersonHenderson, 1929/1956, S. 186).
Dieses Argument entbehre jedoch jeder Grundlage. Dafür spreche schon, dass es auch für kreditfinanzierte InvestitionenInvestitionen der privaten Unternehmen gelten müsste. Dann gäbe es jedoch keinen Weg, durch mehr private Investitionen Arbeitslose in Beschäftigung zu bringen, was aber niemand behaupte.
In Wirklichkeit gebe es drei Quellen, um ErsparnisseErsparnisse für neue, beschäftigungssteigernde InvestitionenInvestitionen bereitzustellen:
1 Die Summen, die jetzt für die Arbeitslosenunterstützung ausgegeben werden.
2 ErsparnisseErsparnisse, die nicht den Weg zu InvestitionenInvestitionen finden, weil die BankenBanken keine entsprechenden Investitionskredite vergeben.
3 ErsparnisseErsparnisse, die bislang für Auslandskredite verwendet werden.
In der detaillierten Beweisführung zu (Punkt 2) betonen Keynes/HendersonHenderson den Unterschied zwischen SparenSparen und InvestitionenInvestitionen: „Ein Land wird nicht durch die rein negative Handlung einer Person, nicht alles Einkommen für den laufenden Verbrauch auszugeben, bereichert. Bereichert wird es durch die positive Tat des Gebrauchs dieser Ersparnisse zur Vermehrung der Kapitalausrüstungen des Landes“ (ebenda, S. 191).
Hiermit wenden die Autoren sich gegen die auch damals weit verbreitete Gleichsetzung von SparenSparen und Investieren sowie von Sparern und Investoren, obwohl diese zumeist unterschiedliche Personen sind.
Gegen das zweite Argument, kreditfinanzierte StaatsausgabenKreditfinanzierte Staatsausgaben führten nur zu InflationInflation, erwidern Keynes/HendersonHenderson, dies gelte erst, wenn in einer Phase der Hochkonjunktur VollbeschäftigungVollbeschäftigung fast oder ganz erreicht sei, nicht aber bei UnterbeschäftigungUnterbeschäftigung. Diese für die makroökonomische Analyse zentrale Unterscheidung zwischen der Situation der Vollbeschäftigung und der Unterbeschäftigung findet sich also bereits hier. Die herrschende Theorie ging dagegen seit RicardoRicardo, der laut Keynes (1936/2009, S. 27f) „England so vollständig erobert (hat) wie die Heilige Inquisition Spanien“, stillschweigend von einer Situation der Vollbeschäftigung aus.
Die Unterstützung durch Keynes’ Pamphlet half Lloyd George zu wenig. Die Liberale Partei erhielt zwar 23 % der bei der Parlamentswahl von 1920 abgegebenen Stimmen, doch die Wahlen gewann die Labour Party, die der ArbeitslosigkeitArbeitslosigkeit und vor allem der bald danach (im Herbst 1929) ausbrechenden WeltwirtschaftskriseWeltwirtschaftskrise hilflos gegenüber stand. Premierminister wurde MacDonaldMacDonald, der zwei Jahre später zurücktrat und eine Koalitionsregierung aller drei Parteien bildete, die – wie in DeutschlandDeutschland Reichskanzler BrüningBrüning – mit Steuererhöhungen und Sparmaßnahmen den Staatshaushalt auszugleichen versuchte, damit aber nur die Krise verschärfte.