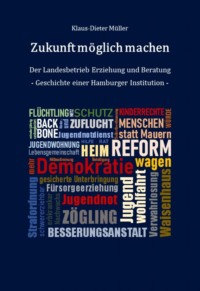Kitabı oku: «Zukunft möglich machen», sayfa 5
Das Gesetz entstand in einer für die Reichsregierung und das Parlament höchst schwierigen Zeit. Politische Umsturzversuche und die Nachkriegsnot der Kriegsheimkehrer und weiter Teile der Bevölkerung, die schleichende und später galoppierende Inflation waren die Probleme, die das politische Handeln in den beginnenden 1920er Jahren beherrschten. Es verwundert daher nicht, dass das Gesetz überhaupt nur durch eine überparteiliche Initiative von Frauen zustande kam{88} und 1922 zwar verabschiedet wurde, aber erst mit einem Vorlauf zur Vorbereitung auf die neuen Aufgaben am 1. April 1924 in Kraft trat.
Es war vor allem ein Gesetz zur Organisation der Jugendbehörden, zur Festlegung ihrer Aufgaben und Kompetenzen und der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel. Auf kommunaler Ebene waren Jugendämter zu schaffen, auf Landesebene Landesjugendämter und im Bereich der Reichsverwaltung ein Reichsjugendamt.
Die bisherigen Entwicklungen in der Jugendhilfe der Länder des deutschen Reiches wurden dabei aufgegriffen. Offenbar war die Hamburger Jugendbehörde ein Vorbild für die gesetzlichen Regelungen, wie eine Abhandlung über die wirtschaftliche Lage Hamburgs aus dem Jahr 1921 zum Entwurf des Gesetzes bereits feststellte: Der Satz `Jedes deutsche Kind hat ein Recht auf körperliche, geistige und sittliche Erziehung‘ stamme von Dr. Petersen, der das erste Jugendamt in Deutschland schuf. Es sei nun das Vorbild für „etwa 1000 Jugendämter in Deutschland.“{89}
Das Gesetz enthält die in Hamburg bereits praktizierten Regelungen zum Schutz der Pflegekinder, zur Rolle des Jugendamtes im Vormundschaftswesen sowie zur öffentlichen Unterstützung hilfsbedürftiger Minderjähriger und speziell zur Schutzaufsicht und Fürsorgeerziehung. Die Länder wurden befugt, Ausführungsgesetze zu erlassen. Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation zum Zeitpunkt des Inkrafttretens, wurden durch eine Notverordnung vom Februar 1924 Vorbehalte zur Durchführung des Gesetzes zur finanziellen Entlastung auf der Länder- und Kommunalebene formuliert.
Hamburg hat hiervon keinen Gebrauch machen müssen, denn die behördlichen Strukturen der Jugendhilfe entsprachen hier bereits im Wesentlichen denen, die im neuen Reichsgesetz vorgesehen waren. In der Schrift „Öffentliche Jugendhilfe in Hamburg“ aus dem Jahr 1925 heißt es dazu:
„So ist die Behörde für öffentliche Jugendfürsorge ausgerüstet mit großen Erfahrungen und mit dem gut organisierten Apparat, der zu ersprießlicher Arbeit nötig ist, im Jahre 1924 aufgegangen in Landesjugendamt und Jugendamt, ohne das Gesicht nach außen viel zu verändern, da im großen und ganzen – mit Ausnahme einiger Aufgaben des Landesjugendamtes - die heutigen Aufgaben der Jugendwohlfahrtsbehörden schon durchgeführt waren.“ {90}
Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG) und das Hamburgische Ausführungsgesetz legten als landesjugendamtliche Aufgabe fest, dass die Erziehungsanstalten vom Landesjugendamt zu überwachen waren. Bereits 1925 beschloss der Senat in einer Verordnung Grundsätze der Überwachung der Anstalten, die durch die zeitgleich erlassenen Richtlinien des Landesjugendamtes inhaltlich weiter ausgeführt wurden. Die „Heimaufsicht“ war ins Leben gerufen worden.
In der Geschäftsstelle des Landesjugendamtes waren 1925 in 7 Abteilungen etwa 230 Beamte und Angestellte tätig, im Jugendamt einschließlich der Anstalten sogar 580.
Doch nicht nur in Bezug auf die Verwaltungsstrukturen waren die Bedingungen in Hamburg für den Start des Reichjugendwohlfahrtsgesetzes sehr gut. Auch die Aufgabenwahrnehmung war bereits weiter fortgeschritten als anderswo. So gab es in Hamburg zum Beispiel bereits ein Mütterheim, das Marthahaus, in dem junge Mütter mit ihrem Kind aufgenommen werden konnten. „Nicht nur, daß dem Kinde hier in der Regel der Vorteil der Brustnahrung zu Teil wird: vor allem lernen Mutter und Kind sich hier eins fühlen, wenn sie einige Wochen im Heim waren.“{91}
Hamburg war damals wie heute eine spannende Groß- und Hafenstadt, die junge Menschen, “seien es Arbeitsuchende oder Abenteurer und Bummler“, anzog. Für die in der Stadt gestrandeten männlichen Minderjährigen unter 18 Jahre stand eine Jugendherberge mit 870 Betten für den vorübergehenden Aufenthalt bereit, bis sie in ihre Heimat zurückgeführt oder in Arbeit vermittelt wurden. Zwischen 1920 und 1924 waren es immerhin 12721 jugendliche Zuwanderer, derer sich das Jugendamt annahm. Im Mädchenheim Alstertwiete fanden Mädchen Aufnahme, „die um Schutz nachsuchen oder die des Schutzes bedürfen.“{92} Der Aufenthalt sollte nur von kurzer Dauer sein und diente der Klärung der Situation und der Perspektive, die in der Rückführung in das Elternhaus oder dem weiteren Schutz in einer Einrichtung bestand. Im Jahr 1924 war diese Einrichtung mit 45 Plätzen der Zufluchtsort für 800 Mädchen. Damit verfügte Hamburg bereits über Anlaufstellen für junge Menschen in gefährdenden Lebenssituationen, die man heute als Notdienste bezeichnen würde.
Eine weitere Besonderheit in Hamburg waren die Lehrlingsheime, in die Fürsorgezöglinge aufgenommen wurden, wenn sie eine Ausbildung begannen. Hamburg war mit seinem Ausführungsgesetz zum RJWG auch den Schritt gegangen, dass die Erziehungsberechtigten ihr Kind dem Jugendamt auf Antrag und ohne Gerichtsbeschluss zur Erziehung übergeben konnten. Die Strukturen der Fürsorgeerziehung hatten sich allerdings seit den Reformjahren nach 1900 nicht wesentlich geändert. Die Einrichtungen aus der damaligen Zeit waren noch immer in Betrieb, teilweise sogar ausgeweitet worden. So wurde 1927 das Gut Wulfsdorf als Erziehungsanstalt für männliche Jugendliche in Betrieb genommen, dazu die Zweigestellen des Waisenhauses in Bergedorf und Besenhorst. In Hamburg wurde die „Anstaltserziehung“ mit wenigen Ausnahmen in Einrichtungen der Behörde durchgeführt. „Dadurch unterscheidet sich Hamburg von den meisten deutschen Ländern und preußischen Provinzen, die in sehr ausgedehntem Maße die Anstalten der freien Liebestätigkeit, namentlich der konfessionellen in Anspruch nehmen. Vorteile und Nachteile sind klar: Sehr wesentlich ist doch der Vorteil, auf den Geist der Anstalt einen Einfluss zu besitzen.“{93}
Und diesen Einfluss versuchte die Jugendbehörde auch geltend zu machen. Voraussetzung hierfür war eine reformfreudige Leitung. Mit Dr. Wilhelm Hertz als Direktor und dem zweiten Direktor August Hellmann waren gute Voraussetzungen gegeben, ab Mitte der 1920er Jahre die Jugendhilfe und insbesondere die Anstaltserziehung fachlich fortzuentwickeln. So wurde auch der Stachel im Fleisch der pädagogischen Praxis, die Erziehung durch Strafe, erneut auf die Tagesordnung gesetzt: Hertz verdeutlichte 1928 in den von ihm formulierten Leitsätzen den Vorrang der Erziehung vor anderen Maßnahmen: „Jede Erziehung wird sich bemühen, ohne Strafen auszukommen. Sie wird auch die Androhung von Strafen nach Möglichkeit zu vermeiden suchen. (…) Die Erziehung will den jungen Menschen ermutigen. Muss aber eine deutliche Missbilligung seines Verhaltens eintreten, so darf die Form des Tadels nicht verletzen. Ironische Behandlung ist ganz zu vermeiden, weil sie den pädagogischen Bezug stört. Vorhalte, die unter vier Augen gemacht werden können, sind dem Tadel vor der Gemeinschaft (Klasse, Gruppe) vorzuziehen.“{94} Den weiteren Ausführungen zufolge sollten Arreststrafen nicht mehr zulässig sein, sondern waren durch Einzelerziehung mit Absonderung von der Gruppe zu ersetzen. Als härteres Disziplinierungsmittel waren zusätzliche Arbeitsleistungen vorgesehen. Dabei sollte die Atmosphäre des Arrestes vermieden werden. Damit verblieb vor allem der Entzug von Vergünstigungen als mögliches Mittel, auf Fehlverhalten, wie man es damals verstand, zu reagieren. Drei Jahre zuvor hatte die Behörde bereits die „Briefsperre“, also das Zurückhalten von Post an die Betreuten, aus den Strafordnungen der Erziehungsanstalten gestrichen. Diese Entscheidung schloss aber nicht aus, „bedenkliche Briefe oder Briefteile dem Zögling vorzuenthalten.“{95} Die Achtung der Privatsphäre war dabei weniger der Grund als vielmehr der, dass die Briefsperre von den jungen Menschen als besonders hart empfunden wurde und außerdem – so die Aktenlage - seit Jahren kaum noch angewendet wurde.
Die Leitung des Jugendamtes ging 1930 noch einen Schritt weiter, indem sie das Beschwerderecht in einer Richtlinie verankern und einen „Vertrauensausschuss der Zöglinge“ einführen wollte. Überliefert ist das Protokoll einer behördlichen Besprechung zu diesem Thema, in dem sich die Anstaltsleitungen und Vertreter des Personals äußern konnten. Das Spektrum reichte von Ablehnung bis hin zu konstruktiven Vorschlägen. Direktor Schallehn von der Knabenanstalt befürchtete eine Verunsicherung der Erzieher im täglichen Umgang mit den Betreuten, wenn Beschwerderichtlinien verbrieft seien. Sie würden „wie eine Aufforderung zur Beschwerdeführung wirken“{96}. In die Diskussion wurde auch eingebracht, dass in den Anstalten der Grundsatz gelten sollte, „dass zwischen Erzieher und Zögling unmittelbares Vertrauen besteht.“ Es sei „zweifelhaft, ob wir weiterkommen, wenn wir den Zögling das Verhältnis als ein Rechtsverhältnis sehen lernen.“ Der zweite Direktor der Jugendbehörde entgegnete, dass die „Möglichkeit, das Verhältnis zwischen Anstalt und Zögling nur familiär und patriarchalisch aufzufassen“ an der Tatsache scheitere, “dass am Anfang der Fürsorgeerziehung doch der direkte Zwang steht.“ Schließlich wurden die Richtlinien im Grundsatz mehrheitlich befürwortet. Allerdings wünschte man sich, die Beschwerderichtlinien in die Heimordnungen einzuarbeiten, um eine bessere Ansprache der Zöglinge zu ermöglichen und Besonderheiten der Heime berücksichtigen zu können. Der Vorstoß, einen Vertrauensausschuss der Betreuten in den Anstalten einzuführen, stieß allerdings auf Skepsis. Die Erziehungsanstalt für Knaben „würde der Gefahr einer Revolte“ ausgesetzt werden. Die Direktorin der Mädchenanstalt, Margarethe Cornils, die der Oberin Rothe 1926 im Amt folgte, hielt dagegen im Einklang mit ihren Erzieherinnen einen Vertrauensausschuss „für einen fruchtbaren und gebotenen Fortschritt.“ Am Ende wurde ein kleiner, weiterer Reformschritt erreicht: „Herr Direktor Hellmann bemerkt abschließend, dass die Hineinnahme der Richtlinien etc. in eine Heimordnung, sowie eine kindertümliche Wortung wohl ermöglicht werden kann. Der Zeitpunkt der Einrichtung der Vertrauensausschüsse kann noch offen gelassen werden.“ In der Akte ist das Schicksal der beiden Reformvorschläge leider nicht überliefert. Die Hinweise auf die Praxis in den Anstalten lassen erahnen, dass eine zügige Umsetzung in den letzten Tagen der Weimarer Republik wohl, wenn überhaupt, nur in Ansätzen erfolgte. Denn Direktor Hertz musste noch im selben Jahr klarstellen, dass „das Kahlscheren entwichener Zöglinge (…) als geeignete Strafe oder Erziehungsmaßnahme nicht anzusehen“{97} ist. Weiterhin sollten Kollektivstrafen unterlassen werden: „Eine Bestrafung von Mitzöglingen derselben Gruppe wegen Entweichens eines Zöglings soll nicht stattfinden, es sei denn, dass die Mitwirkung oder Begünstigung seitens der betreffenden Mitzöglinge anzunehmen ist.“ Auch sei die „Gruppenstrafe“ als „Mittel zur Herbeiführung von Aussagen (…) ungeeignet.“ Heute ist bekannt, dass die Reformideen die Praxis der nachfolgenden Jahrzehnte nicht erreicht haben.
Zur Bürgerschaftswahl 1927 gab der sozialdemokratische Verein eine Bilanz des „Kampfes [der SPD] um die Staatsmacht“ {98} heraus und stellte für die öffentliche Jugendhilfe fest: „In den Anstalten ist Schritt für Schritt ein freier Geist eingezogen. Eine der ersten Taten der neuen Leitung ist die Abschaffung der körperlichen Züchtigung gewesen. Die Mädchenanstalt ist von innen heraus umgewandelt.“ Das „kirchlich-konfessionelle“ Erziehungsverständnis, die „muffige, veraltete Luft“ habe einem modernen Verständnis von Erziehung Platz gemacht. Dieser allgemein gehaltene Hinweis wird im Jahresbericht des Jugendamtes von 1927 aufgeklärt: „Als besonders bedeutungsvoll hat sich der im Jahre 1926 eingetreten Wechsel in der Leitung der Erziehungsanstalt für Mädchen herausgestellt.“ Mit der neuen Leiterin, Margarethe Cornils, habe sich eine „neue und andersartige Arbeitsauffassung“ eingestellt. Die „äußere und allzu straff gehandhabte Disziplin“ sei gelockert worden und habe ein besseres Klima geschaffen, so dass „manche Reibung ausgeschaltet und ein ruhigeres, zwangloseres Leben eingeleitet“ worden sei.{99} Der Reform in der Mädchenanstalt wurde im Jahresbericht ein sehr breiter Raum gegeben, schien sie doch ein Lichtblick in der damaligen Zeit gewesen zu sein. Wie die Erziehungsdirektorin Cornils allerdings die ihr anvertrauten Mädchen sah und darauf ihre Pädagogik aufbaute, stellte sie in einem, im Jahr 1931 gehaltenen Vortrag beim AFET über das „Problem der Schwererziehbaren in der Fürsorgeerziehung – gesehen von der Arbeit an weiblichen Jugendlichen“{100} dar. Für sie war schon eine „begriffliche Klarlegung“, was die Schwersterziehbaren ausmacht, nicht möglich. Vom pädagogischen Alltag aus könnten die „Zerstörer der Gemeinschaft“ und die „Jugendlichen, deren Persönlichkeit keinen Ansatzpunkt für aufbauende Arbeit bietet oder konsequent ausweicht“ unterschieden werden. Zu den ersteren zählte sie Aggressive, Intriganten, übersteigerte Individualisten und Homosexuelle. Dem „zweiten Typ“ ordnete sie „Schwachsinnige“ und „schwere Psychopathen“ zu. Außerdem fielen in diese Gruppe: „völlig Haltlose“, „Willensschwache und Antriebslose“, die „Frühsexualisierten“, die „Abgesperrten“, womit sie vor allem die „Dirnen“ meinte, die „Dauerläufer“, die permanent entweichen und unter denen sich die „Kokainistinnen, Morphinistinnen und Trinkerinnen“ befanden, und schließlich die Aufsässigen, die „von den Eltern oder sonstigem Anhang (Cliquen, Parteien) gegen das Heim, seine Ordnung und seine Forderungen verhetzt werden“. Dieser bunte Strauß an unterschiedlichen Persönlichkeiten war für sie der Ausgangspunkt für den Vorschlag, für unterschiedliche Gruppen auch jeweils eine spezielle Pädagogik vorzusehen, wobei sie „Sonderheime für Schwersterziehbare“ ablehnte. Sie stellte sich eher unterschiedliche Gruppen in Heimen vor, die Übergänge ermöglichten. Wenn Schwersterziehbare allerdings trotz dieser besonderen pädagogischen Herangehensweise sich als nicht tragbar herausstellen würden, seien sie „Psychopathenheimen und Bewahranstalten zuzuführen“. Insoweit sprach sie sich auch dafür aus, dass „in engster Tuchfühlung mit dem Psychiater“ gearbeitet werden müsse. Für sie war es wichtig, dass pädagogisch qualifiziertes Personal in den Heimen arbeitet, das die in der Gruppe sich vollziehende „Gemeinschafts- und Freizeiterziehung“ betreibt: „Sport, Spiel, Wanderungen, Tanz, Gesang, Handfertigkeit, Handarbeit usw.“. Daneben trat sie für die die „intensive Arbeits- bezw. Berufserziehung“ ein. Wenige Jahre nach ihrem Amtsantritt, war sie sich der Grenzen ihres Anspruchs an ihre Arbeit bewusst: „Bei den Schwererziehbaren wird man bescheiden“, lauteten die abschließenden Worte des Vortrags, auch und gerade, wenn sie sich mit Revolten äußern: „Die Schwer- und Unerziehbaren dürfen uns keine Last sein. Sie sind für uns eine ganz wertvolle Korrektur und Kritik unserer Maßnahmen.“ Die Fachwelt sollte „den Jugendlichen zu Dank verpflichtet“ sein, „daß sie sich aufgelehnt haben gegen das, was ihnen nicht gerecht wurde.“ Wirft man einen Blick auf die nachfolgenden Jahrzehnte, so sind diese pädagogischen Grundsätze der Heimordnung und der Gestaltung des Heimalltags im Mädchenheim Feuerbergstraße erkennbar. Cornils legte Wert auf handwerkliche, sportliche und musische Erziehung. Mit dieser Art erreichte sie aber immer nur einen Teil der Mädchen. Die anderen mussten mit Zwang im Zaum gehalten werden.
In den 1920er Jahren gingen Impulse für eine Reform der Fürsorgeerziehung auch von der psychoanalytischen Theorie aus. Sie öffnete den Blick für die Entwicklung einer Persönlichkeit durch Beziehungen und insbesondere denen in der Familie. Sie fand Eingang in reformpädagogische Ansätze für die Praxis der Erziehungsberatung und Heimerziehung. Zu den Reformpädagogen gehörte etwa der Wiener Psychologe August Aichhorn. In einer 1925 veröffentlichten Vorlesungsreihe für Erzieherinnen und Erzieher führte er sein Publikum in die psychoanalytischen Leitgedanken für ein Fallverstehen und die sich daraus ergebende pädagogische Praxis ein. Als Leiter einer Erziehungsanstalt verfügte er auch selbst über Erfahrungen mit den neuen, von ihm eingeführten Erziehungsmethoden, die sich ganz wesentlich von den herkömmlichen unterschieden. Aichinger benutzte auch den damals verwendeten Begriff der Verwahrlosung in dem Sinn, dass damit alle normabweichenden Verhaltensweisen, „dissoziales Verhalten“, gemeint waren. Also ein Begriff, der Erscheinungen beschreiben sollte, aber nicht die Ursachen. Und als verwahrlost galt Vieles: vom Schulschwänzen über kleinere und größere Lügen, Diebstahl, Aufsässigkeit in Familie, Schule und Arbeitsleben, „Arbeitsscheu“ bis zu den als gefährdend anzusehenden Kontakten zu Erwachsenen. Für Aichinger und die von ihm vertretene Schule war die Verwahrlosung „Ausdruck für Beziehungen zu Personen und Dingen, die andere sind, als die Sozietät sie dem Einzelnen zubilligt.“{101} Das pädagogische Handeln müsse darauf eingehen und dies bedeute auch, dass das Anstaltsmilieu ein ganz anderes sein müsse, als es bisher sei. In seinem Vortrag fügte er eine Beschreibung einer „alten Besserungsanstalt“ ein:
„Überall nur scheue haßerfüllte Blicke von unten herauf. Nirgends ein offenes, freies Ins-Gesicht-Schauen. Das fröhliche, oft kraftüberschäumende Wesen der normalen Jugend fehlt vollständig. Was an Heiterkeit zu sehen ist, stimmt den Besucher traurig. Lebensfreudige Äußerungen sehen ganz anders aus. Man kann sich eines Schauers über den vielen Haß, der in diesen jungen Menschen aufgespeichert ist, kaum erwehren. Es kommt in diesen Anstalten nicht zur Lösung, verdichtet sich noch mehr, um später in der Gesellschaft entladen zu werden.“{102}
Die in den Anstalten geltenden Regeln würden deutlich werden lassen, „welche Gewalt da Tag für Tag aufgewendet werden mußte, um einen Zustand aufrecht zu erhalten, der kindlichem Verhalten so zuwiderläuft, dem dissozialer Jugend um so mehr. Den Zwang des sozialen Lebens haben sie nicht ertragen und durch solchen Anstaltszwang sollen sie wieder sozial werden?“{103} Er schildert danach die Herangehensweise in einem neu ausgerichteten Heim, das er leitete. Dort kam es auf den analytischen Blick der Erziehenden an. All die täglichen Konflikte, auch jene mit der Nachbarschaft des Heimes, waren zulässig, um sie schließlich für das Erreichen des Erziehungszieles nutzbar zu machen: „Wir gewähren den Verwahrlosten im lustbetonten Milieu unsere Zuneigung, bedienten uns also der Liebesprämie, um einen versäumten Entwicklungsprozess nachzuholen: den Übergang von der unwirklichen Lustwelt in die wirkliche Realität.“{104}
Die Erziehenden mussten für diese Art der Sozialarbeit eine ganz andere Haltung gegenüber den Betreuten einnehmen als in den herkömmlichen Besserungsanstalten. „Keinem von uns war je eingefallen, in ihnen Verwahrloste oder gar Verbrecher zu sehen, vor denen die Gesellschaft geschützt werden müsse; für uns waren es Menschen, denen das Leben eine zu starke Belastung gebracht hatte (…) für die daher ein Milieu geschaffen werden mußte, in dem sie sich wohlfühlen konnten“{105}, schilderte Aichinger in seinem Vortrag.
Solchen und ähnliche Erfahrungen und Einsichten haben die Reformbestrebungen der Hamburger Jugendbehörde vielleicht auch inspiriert. Anspruch und Wirklichkeit lagen in den Anstalten jedoch noch weit auseinander. Die Praxis der Erziehung mit Mitteln der Strafe sollte sich auch in den nächsten Jahrzehnten kaum ändern. Die Änderung der Bezeichnung „Anstalt“ in „Heim“ und pädagogische Richtlinien setzten dabei zumindest symbolische Akzente, die eine Aufbruchsstimmung signalisierten und sicherlich die Reformkräfte in der Praxis stärkten. Die Sicht auf die jungen Menschen war jedoch in weiten Teilen nicht von Verständnis und Empathie geprägt. Es gab keine Einsicht, dass übermäßige Ordnung und Strafe sowie schematische Erziehungsmethoden die Gewaltspirale anheizten. Das Erziehungsversagen wurde vielmehr den jungen Menschen angelastet. Sie galten als unerziehbar, wenn sie sich nicht einfügten.
Ende der 1920er Jahre wurde an der Fürsorgeerziehung in Anstalten auch in der Öffentlichkeit Kritik laut. Anlass waren bekannt gewordene Erfahrungsberichte aus Anstalten und Anfang der 1930er Jahre Misshandlungen und Revolten in zwei Heimen, die auch zu strafrechtlicher Verfolgung des Personals führten. Dies hat den Fachverband „Allgemeiner Fürsorgeerziehungstag“ (AFET) 1931 zu einer Positionsbestimmung durch seinen Vorsitzenden, Pastor Wolff, veranlasst, die mit den Worten beginnt:
„Wir befinden uns in einer Kampflage. Seit die ersten Revolten in Erziehungsheimen bekannt wurden, seit Lampel sein Buch „Jungen in Not“ schrieb und das Stück „Revolte im Erziehungshaus“ über die Bühnen aller großen Städte Deutschlands ging, seitdem die Prozesse um Rickling und Scheuen [Anstalten, in denen Misshandlungen öffentlich wurden, KDM] die Öffentlichkeit beschäftigt haben, sind wir nicht mehr zur Ruhe gekommen.“{106} In einem Ritt durch die aktuellen Themen stellte Wolff nach einem Lob für die Leistungen der Fürsorgeerziehung die Herausforderungen der Zukunft dar. Dies seien die Sicherstellung der wirtschaftlichen Grundlagen der Anstalten, die Qualifizierung des Personals, die Lebensweltnähe der Erziehungsorte, die menschenwürdige Behandlung der jungen Menschen, aber auch der Schutz des Personals vor Übergriffen der „Zöglinge“, um zuletzt bei einem Thema zu landen, das damals die Fürsorgeerziehung besonders beschäftigte:
„Eine letzte wichtige Aufgabe der Zukunft bleibt die sorgfältige Trennung der Schwerst- oder Unerziehbaren von denen, bei denen die erzieherischen Bemühungen noch Erfolg versprechen.“ Bei feineren „Verteilmethoden“ könne die Zahl dieser Gruppe sehr geringgehalten werden, jedoch „bleibt schließlich ein Rest übrig, und diese Gruppe muß allerdings von den übrigen Kindern und Jugendlichen getrennt werden.“ Wolff verweist schließlich auf das bereits von weiten Teilen der Fürsorgeerziehung „ersehnte Bewahrungsgesetz“, nach dem die als Schwerst- und Unerziehbaren aus der Jugendhilfe ausgesondert würden und man damit „die Fürsorge für die hier bezeichneten Zöglinge den Pädagogen abnimmt.“{107}
Dieser Wunsch der Aussonderung war weit verbreitet und wurde durch einen maßgeblichen Teil der Kinder- und Jugendpsychiater unterstützt. In der damals in der Medizin verbreiteten Eugenik galt die Auffassung, dass die „Verwahrlosung“ junger Menschen als genetisch bestimmt und daher als „angeboren“ zu betrachten sei. Eine pädagogische oder psychiatrische Einflussnahme sei daher zwecklos.
Diese Auffassung vertrat auch der damalige leitende Arzt beim Jugendamt in Hamburg, Dr. Werner Villinger. Der 1887 in Besigheim am Neckar geborene Villinger studierte von 1909 bis 1914 Medizin, wurde dann zum Kriegsdienst eingezogen und setzte nach 1918 seine ärztliche Laufbahn fort. Ab 1920 leitete er die neu eingerichtete kinderpsychiatrische Abteilung an der Universitätsklinik in Tübingen. Mit dieser Erfahrung in einem „klinischen Jugendheim“ bot er sich im Jahr 1926 für die Berufung zum ersten hauptamtlichen Kinder- und Jugendpsychiater in der Hamburger Jugendbehörde an. Er wirkte in Hamburg zugleich als beratender Oberarzt an der Psychiatrischen Klinik der Universität Hamburg, hielt Vorlesungen über Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters und unterrichtete an Bildungsinstituten für Erzieher und Lehrer. 1932 übertrug man ihm eine Professur an der Universität Hamburg.{108} Als Arzt des Jugendamtes war er in der Beobachtungsstation tätig und entwickelte bereits dort eine biologische Auslesediagnostik und den Vorschlag einer Zwangssterilisation der als unerziehbar geltenden Kinder und Jugendlichen. In den späten 20er Jahren wurden diese Ideen im Hamburger Jugendamt und in der Reichsgesetzgebung noch nicht aktiv aufgegriffen. Der Bericht des Hamburger Jugendamtes für das Jahr 1927 enthält aber bereits einen breiten Raum für die psychiatrische Klassifizierung der Zöglinge: „Vom Jugendamtspsychiater sind im Berichtsjahr 1274 Fälle untersucht und begutachtet worden.“ Diagnostiziert wurden etwa „Schwachsinn der verschiedenen Grade“ mit 46% der Fälle oder „Psychopathie und Schwachsinn“{109} mit 12%. Im Bericht folgt dann unter anderem die Feststellung, dass „die Hilfsschulen sich immer noch mit einem Schülermaterial belasten, das infolge seines intellektuellen Tiefstandes nicht in die Hilfsschule, sondern in die Schwachsinnigenanstalt gehört.“{110}
Mit seiner Tätigkeit im Jugendamt und in der Lehre trug Villinger dazu bei, dass der Boden für eine rassenbiologische Ideologie in der Gesellschaft und in der Fürsorgeerziehung im Besonderen bereitet wurde.{111}