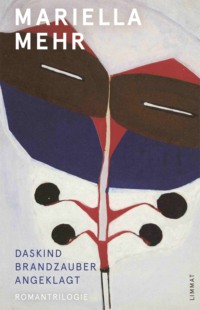Kitabı oku: «Daskind - Brandzauber - Angeklagt», sayfa 2
An wuchernden Berberitzen und Sanddorn vorbei nehmen sie den Abstieg. Den schwierigeren Weg, sagt Kari Kenel, der sei ihm lieber. Der Weg führt einer Schlucht entlang. Aus dieser Schlucht soll der Teufel gekommen sein, um die sündige Mächlerin zu holen. Tief unten im Gestein orgelt der Bach, schleift sich durch den Fels dem Dorf zu, wo er, seiner Gewalt beraubt, die Bewohner mit seinem reichen Fischbestand erfreut.
Langsam setzt Kari Kenel Fuß vor Fuß. Hier im Schattloch bleibt der Saumpfad den ganzen Sommer über nass und glitschig. Es ist also trotz der genagelten Militärschuhe Vorsicht geboten. Leichtfüßig hinter ihm Daskind. Macht sich ein Spiel daraus, möglichst nah am Abgrund zu gehen. Hört das Orgeln des Bachs als ein grünes Gebet. Lästergebet, Lichtfressergebet. Hört die Brunstschreie der Mächlerin und die des Entsetzens. Greift nach dem Rücken des Mannes vor ihm, der, auf den Stoß nicht gefasst, auf dem nassen Waldschlick ausgleitet, stolpert und schwer in die Zweige über dem Abgrund fällt. Eine Ewigkeit Erschrecken in den Augen Kari Kenels, der – von den Zweigen aufgehalten – erst in den Abgrund unter ihm und dann ins Gesicht des Kindes starrt. Dunkel ist das Grau vom Erschrecken. Schaut Daskind durch die Angst hindurch mit festem Blick bis zum jubelnden Schrei der Mächlerin, zum Schrei, der ein Tier ist in eisiger Nacht. Kind Ohnegrund. Kann den jetzt unbewegten Himmel über sich einatmen. Und die Angst des Mannes im Gezweig. Könnte zutreten, die Hand, ins Holz verkrampft, zertreten. Müsste fallen, in jene Nächte zurückfallen, aus denen es emporgestiegen ist, in jene eisigen Nächte, die Daskind bewohnt und schon immer bewohnt hat. Wäre Ordnung für lange im Kind.
Aber einer wie Kari Kenel ist ein Widergänger. Bannt den Blick des Kindes trotz der Angst, überrascht das Kind mit stiller Ergebung. Schon löst sich das Bild auf, wird zum Schatten, als der Mann die Hand ausstreckt und dann wieder auf festem Boden steht. Neben dem Kind. Die Hand des Kindes in der Hand des Mannes. Das weint jetzt, Daskind. Hat einen neuen Schmerz gefunden.
3
Aufmerksam betrachtet Daskind die Kiesel. Der Dorfbach macht hier keine großen Sprünge, sanft umspült er Stein um Stein. Umsichtig beleckt er die Wurzeln der Butterblume, sättigt großzügig das blühende Moos. Bunt leuchten die Kiesel im Bach, vom Wasser zurechtgeschliffene Werkzeuge, deren das Kind bald bedarf.
Im Rücken des Kindes das Haus der Waldfrau. Unter dem Giebel haben wie jedes Jahr Schwalben genistet. Daskind weiß nicht, wann die jungen Schwalben verschwanden, aber das aufgeregte Flattern und Jammern des Vogelpaars war tagelang zu hören. So ist’s im Wald, sagt die Waldfrau, frisst jeder jeden, je nach Bedarf. Sie greift ins Innere des Hasen, tastet nach Lungen und Herz. Legt das stumme Hasenherz zu den zierlichen Nierchen auf einen Bakelitteller. Füllt den nun leeren Hasenbauch mit Kräutern und Knoblauch, streicht ihm sanft über die prallen Schenkel, ehe das Tier im Ofen verschwindet. Die Lunge landet hinter dem Haus im Brombeergestrüpp. Für den Waldschrat, lacht die Waldfrau. Daskind will nichts hören vom Schrat, denkt, wenn die Frau lacht, dass sie den Wald mit dem Waldschrat teilt und ihn mit der Lunge des Hasen zufrieden stimmt, damit er unsichtbar bleibt. Grad so wie der Immergrüne im nächtlichen Dunkel verschwindet, wenn er mit dem Gewicht seines Körpers die Lungen des Kindes zerquetscht und den Schleim zwischen die magern Schenkel des Kindes gespuckt hat.
Daskind könnte auf das Hausdach der Waldfrau klettern, sich einfach und heiter hinunterfallen lassen. Das wäre ein Staunen im Auge des Immergrünen, sähe er die gebrochenen Schenkel, die zerfetzte Haut. Könnte Daskind auflachen, jubeln vor Freude. Hätte Daskind eine Frist zu nutzen. Doch Gott sieht alles, sagen sie im Dorf, wenn eines der Kinder Schlechtes treibt, und dass ihnen der Leib von Gott gegeben, der allein ihn zurücknehmen darf. Am Herzen Jesu bergen. Das Herz Jesu will keine gebrochenen Schenkel, keine zerfetzte Haut, keinen besudelten Leib. Lacht da der Immergrüne und jubelt.
Endlich findet Daskind den Stein. Der graue Kiesel liegt gut in der Hand. Zärtlich betrachtet Daskind die Maserung, misst mit geübtem Blick die Rundung des Funds. Mit Schleuder, Stein und Ziel zu verwachsen, hat es gelernt, dann verwittert das Herz nicht beim Schuss. Und dass das Ziel eines ganz bestimmten Steins bedarf.
Daskind wandert mit dem Stein und der Schleuder in den Wald. Ums Kind wimmelt’s von Absicht. Da ist ein Leben und Leben im Wald, das zueinanderdrängt und findet. Dornige Ranken zerkratzen die nackten Beine des Kindes. Vögel schrecken auf und fliegen hoch aus dem Niedergehölz. Das Beben der Luft will überall sein, ein Überallbeben berührt Daskind. Das ist nun im Wald aufgehoben, mit sich und mit dem Stein in der Hand.
Das klare Gesicht des Waldes verdunkelt sich zur Waldmitte. Hier stehen sie, Stamm an Stamm, die hohen, schlanken Tannen. Das kräftige Wurzelwerk ist unter dem Nadelteppich zu sehen. Eine feuchte, dunkle Weiblichkeit erfüllt diesen Teil des Waldes, den Daskind Nimmerwald nennt, im Gegensatz zu den andern Waldgegenden, die fürs Kind keine Namen haben. Die Waldfrau hingegen nennt den Ort Feenrausch, weil die Waldfeen an dieser Stelle vor langer Zeit ihre Feste gefeiert haben sollen. Trunken vom Nektar, hätten sie sich im Reigen gewiegt und gesungen. Die Tannen, bei Festen immer zugegen, hätten sie mit ihrem Rauschen begleitet. Doch einmal seien die Feen vom Tanz in die Ekstase nicht mehr zurückgekommen, obwohl die Tannen zur Rückkehr mahnten. Seither habe niemand mehr die Feen gesehen. Traurig seien die Tannen allein in den Wald zurückgekehrt. Seither herrsche der Schrat im Wald, mit dem sei nicht zu spaßen. Die Bäume aber seien zum Himmel gewachsen, um ab und zu einen Glanz auf den Flügeln der Feen zu erhaschen.
Daskind umarmt den traurigen Baum. Das kann es verstehen, dass da eine Trauer ist, die nie mehr vergeht, wenn keine Feen im Feenrausch tanzen. Das kann es verstehen, Daskind, dass da keine Freude ist, wo die Feen fehlen und der Schrat sein Unwesen treibt. Es ist an der Zeit, flüstert Daskind. Da ist der Stein in der Hand und die Schleuder. Daskind hat sein Geschick, kann nicht aus der Haut. Jetzt hört es die Amsel im Gezweig des Baums, hört im Gezweig das Necken und Rufen. Nimmt still die Schleuder zur Hand. Fühlt die Kraft im Arm, als es langsam den roten Gummi spannt. Denkt, dass es verwachsen muss mit dem Stein und der Schleuder, dem Ziel. Tut es probeweise, hält inne, nimmt sich Zeit. Moosbewachsene Zeit zieht ins Kind ein, in den Bauch, macht ihn weich und fügsam. Warm.
Fest Jetzt Die Hand Ums Gegabelte Holz Spannt Jetzt Den Schlauch Fühlt Ziel In Der Hand Im Stein Liegt Gut In Der Hand Im Leder Der Schleuder Spannt Fester Noch Fester Fühlt Stein Fühlt Hand Die Schleuder Das Ziel Kann Jetzt Das Sirren Des Steins Und Zugleich Das Locken Der Amsel Kann Das Hören Fühlen Schwarz Explodiert Sonne Im Bauch Und Ein Ziehen Das Sirren Lauter Dann Dumpf Und Schneller Der Fall Still Liegt Vogel Tot Kann Nicht Fragen Kein Vogelfragen Hat Stille Daskind Hat Stille Im Wald Daskind Kehrt Zurück Moosgrüne Zeit.
Kind Ohneschuld, eingesponnen in eine feuchte Träumerei, beachtet den Vogel nicht, braucht den nutzlosen Kadaver nicht, um das Träumen in Schwung zu halten. Sitzt unter den Tannen, die Hände im Schoß gefaltet, lauscht es dem fernen Gesang der Feen, weiß sich vorm Schrat beschützt. In seinem Traum sind alle Vögel unterwegs, trennen mit ihren Schnäbeln die Welt vom Rumpf der Nacht.
Im Chalet sah man die Spaziergänge des Kindes zur Waldfrau nicht gern. Eigentlich waren sie verboten, aber dem Kind wurde nie gesagt, weshalb. Über die Waldfrau, Kari Kenels ledige Schwester, wurde ohnehin nicht mehr gesprochen, seit sie die Eltern verließ und in den Wald zog. Das war nach der Zeit, als Kari Kenel, den der Krieg in die Heimat zurückrief, die Störschneiderin Frieda Rüegg ehelichte und ihr das Chalet Idaho baute. Die Eltern starben kurz nach seiner Heirat, gramgebeugt, wussten die Dörfler, weil ihnen die Tochter die geschuldete Treue verweigerte. Das hatte es im Dorf noch nie gegeben, dass eine unverheiratete Tochter Haus und Herd verließ, um allein in einer alten Holzerhütte zu leben. Doch die Waldfrau, die Leni, habe ja vom Schaffen nie viel gehalten. Die habe beizeiten vom Schaffen nicht viel gehalten. Oft habe man sie am Waldrand sitzen sehen, gefaulenzt habe sie, obwohl das Gras hochgestanden sei und die Säue in den Koben vor Hunger schrien. Umso mehr hätten die betagten Eltern zugepackt, auf den Sohn sei ja auch kein Verlass mehr gewesen. Der mit seiner Auswanderei und den teuren Postkarten, die er von drüben schickte. Der Hof ging an Neuzuzüger, an Ambachs aus dem Nachbardorf, weil die Leni nicht zu bewegen gewesen sei, ihn wenigstens an einen Einheimischen zu verpachten. Auch der Kari habe seine Stelle als Vorarbeiter in der Aluminiumfabrik nicht aufgeben und den Hof nicht bewirtschaften wollen. So sei der Leni ein stattlicher Batzen ausbezahlt worden, mit dem sich’s gut leben lasse. Aber dass da eine dem Herrgott die Zeit stehle, das sei ein Ärgernis. Die hause im Wald, als sei sie vom Bessern.
Andere wussten von den Spaziergängen der Waldfrau zu berichten. Kraut um Kraut nehme sie zur Hand, einige trage sie gebündelt nach Hause. Man könne nur ahnen, was daraus zusammengebraut werde. Gescheites könne es nicht sein, bei so einer.
Andere wollten sie bei Vollmond im Wald gesehen haben. Oft mit nackten Füßen und nur in ein weißes Hemd gekleidet. In so einem Dorf wird halt viel geredet, wer weiß schon, was an den Geschichten wahr ist, die sich die Frauen beim Warten aufs Anprobieren in Frieda Kenels Nähstube erzählen.
Daskind wusste von den Erzählungen. Ging hin, auch wenn es verboten war.
Das erste Mal hatte sich Daskind verirrt. Es war aufgebrochen, die Puppe zu suchen, seine Puppe, die Frieda Kenel in den Dorfbach geworfen hatte. Die Puppe war ein Geschenk der Kellers nebenan. Eigentlich kein Geschenk, eher ein Lohn, denn für die Stoffpuppe musste Daskind der Keller Marie wöchentlich dreimal das lange, wirre Haar bürsten. Vorsichtig hatte es durch das Haar zu fahren, vorsichtig Knoten um Knoten zu lösen, bis das Haar glatt und glänzend über die Schultern des Mädchens floss. Das Haar roch nach Kakao und Kuchen. Wenn Daskind unvorsichtig wurde und an den hellen Haaren riss, schlug Marie es ins Gesicht oder – noch schlimmer – Marie weinte so lange, bis die Keller vom Laden hochkam und Daskind laut schimpfend aus dem Haus jagte. Oder Anton Keller selbst kam und nahm Marie in den Arm. Nach dem Bürsten besah sich Daskind seine Hände. Nie hatte das Gold des Haars Spuren hinterlassen, die Handteller blieben weiß.
Einmal hatte es das Haar der Keller Marie besonders vorsichtig gebürstet. Seidenweich war es anzufühlen. Marie ließ sich und ihre Haarpracht kokett bewundern. Da griff die Keller in eine Spielzeugtruhe und holte die Puppe hervor. Da nimm, armes Ding, und dass du morgen wiederkommst.
Die Stoffpuppe wurde in die Überlebensstrategie des Kindes eingebaut. Von allem Überflüssigen befreit, schien sie dem Licht zugehörig, in das die Tannen getaucht waren, wenn sie dem Glanz der Feenflügel nachtrauerten. Dann war auch jenes dunkle Rauschen zu hören, das jetzt Daskind beim Anblick der Puppe zu hören glaubte. Vorsichtig löste es den schwarzen Faden aus dem Stoff, an dem vermutlich das eine Auge befestigt war. Dann kratzte es die rote Farbe weg, die einmal ein Lippenpaar markierte. Der Mund, nur noch eine zarte, kaum sichtbare Kerbe in der unteren Hälfte der runden Gesichtsscheibe, lächelte weltentleert.
Die Hände und Füße der Puppe zeigten Zerfallserscheinungen. Finger und Zehen fehlten ganz. Wolle quoll aus den Wunden hervor, Daskind stopfte sie in die Öffnungen zurück. Der Rumpf war in ein Tuch von undefinierbarer Farbe eingenäht. Lose baumelten die Beine am Rumpf. Daskind schwang die Puppe im Kreis, bis es im Schultergelenk knackte. Dann riss es der Puppe die baumelnden Beine in den Spagat und bohrte mit dem Zeigefinger ein Loch in den brüchigen Stoff. Schließlich fand es einen geeigneten Knebel, um Kellers Geschenk aufzuspießen, und lief, die Trophäe hoch erhoben, nach Hause.
Wenn mich die Keller Marie jetzt schlägt, werde ich der Puppe Nadeln ins Gesicht stecken, dort, wo die Augen waren. Und ins Herz, in den Bauch. Ich werde keine Stelle auslassen, denkt Daskind. Keine Stelle, auch nicht die Stelle mit dem Loch.
Und auf dem Stuhl im Grünenzimmer werde ich an die Puppe denken, denkt Daskind, und nachts, wenn der Immergrüne … Dann auch.
Aber nun war die Puppe weg, und Daskind machte sich auf, sie zu suchen. Nachts zuvor war wieder der Immergrüne ins Kind eingebrochen. Daskind hatte lange die Puppe gequält und sie schließlich an einen Nagel gehängt, dass der Stoff im Rücken riss.
Weggeworfen. In den Bach, hatte die Pflegemutter gesagt. Also lief das Kind zum Bach. Es war ein schwieriges Suchen, denn Daskind wusste nicht, an welcher Stelle Frieda Kenel die Puppe in den Bach geworfen hatte. Auch konnte der Bach die Puppe mitgenommen haben, davongetragen wie die Äste und Steine, die er nach Gewittern auf die Dorfstraße spülte.
Daskind trottet dem Bach entlang dem Wald zu. Es weiß, wo die Pflegemutter die wilden Beeren holt, die sie für den Winter zu Kompott verarbeitet. Im Keller stehen die Gläser auf den rohen Holzbrettern. Nach einiger Zeit sind sie von klebrigem Staub überzogen, dann sieht man die Schrift nicht mehr und muss an der Farbe des Eingemachten erraten, was man auf Geheiß der Pflegemutter in die Küche hochschleppt. Ist es das Falsche, muss Daskind wieder in den Keller steigen, obwohl es sich fürchtet vor dem Dunkel und den großen Spinnen. Oft glaubt es, die Spinnen auf dem Gesicht zu spüren oder Spinngewebe, das von der Decke hängt. Dann schreit es laut im Dunkel des Kellers, weil es den Lichtschalter nicht berühren darf. Das hat die Pflegemutter verboten, dass Daskind Licht macht, wenn es in den Keller hinuntersteigt. Das hat sie verboten, und dass Daskind schreit. Aber Daskind kann nicht aufhören zu schreien, obwohl es Angst hat, dass ihm eine Spinne in den Mund klettert und dort ein Netz spannt, an dem Daskind ersticken muss.
Jetzt hat es die Stelle erreicht. Hier ist der Bach ein friedliches Gemurmel, schön anzuschauen mit den bunten Steinen und den Blumen, die am Bachrand blühen: Dotterblumen, weiße Waldanemonen und Engelwurz. Ein gelbes Licht verzaubert das Gebüsch, Frieda Kenels Gebüsch, Frieda Kenels Beeren, die sie in kleinen Körben nach Hause trägt. Daskind muss die Puppe finden. Starrt angestrengt in den Bach. Sucht mit weiten Augen das Wasser ab, das Ufer. Im Moos liegt die Puppe, der Bach hat sie nicht fortgetragen, hat sie achtlos ans Ufer gespült, wo sie sich in abgebrochenen Zweigen verfing. Von den Zweigen gehalten, liegt sie im Moos, sanft gleiten kleine Wellen über ihren Stoffkörper, manchmal verschwindet der Kopf in den Wellen. Daskind klettert vorsichtig die Böschung hinunter, greift nach der nassen Puppe, zieht sich wieder hoch. Mustert die Puppe, schüttelt sie und schwingt sie in der Luft. In den Wassertropfen bricht sich das Licht, kleine, regenbogenfarbene Kugeln, ein lebendiger Kreis um Daskind und die Puppe.
Aber Daskind verlässt den Kreis, will nicht vom Regenbogen, nicht vom Licht und den Farben gefangen werden. Nimmt einen dicken Prügel und die Puppe, läuft hastig in den Wald. Dort, weitab vom Bach, haut Daskind auf die Puppe ein, langsam, entschlossen. Blind. Findet den Rücken der Puppe blind. Schreit und haut. Jedem Schrei folgt ein tiefes Knurren aus dem Innern des Kindes. Prügelt die Puppe in den weichen Waldboden. Kann nicht aufhören, muss und muss. Schreit und knurrt. Das hat es von den Wölfen gelernt, dass da kein Erbarmen ist, wo Blut fließt. Schlägt jetzt schneller, Daskind, verbeißt sich im Stoff, zerreißt den Fetzen Stoffleib, bis nicht mehr zu sehen ist, was es war.
Pocht das Herz rasend.
Ist ein Zorn im Kind.
Zittert Daskind.
Schreit weiter, Daskind.
Bis eine Hand es streift und seine schreiende Stimme in der ruhigen Stimme der fremden Waldfrau verschwindet.
Starren sich an, die Frau und Daskind. Fremdlinge im Wald, der ein Tor ist zu den Gesängen der Fee. Führt eine Einsamkeit die andre durchs Tor, ein Fremdling den andern, eine Not die andere Not, führt eine Hand die andere tief in den Wald, wo das Holzhaus steht. Jetzt beide stumm.
Kocht die Waldfrau Kakao. Stellt Kuchen auf den Tisch. Bittet das Kind zuzugreifen. Nie hat jemand Daskind um eine Gefälligkeit gebeten, nicht am Tisch und nicht in der Nacht ohne Sinn. Daskind stopft sich den Kuchen ins Maul. Schluckt süß und süß, will wiederkommen. Bald.
4
Ein Frostflaum auf den Lippen des Kindes. Auf der Suche nach dem ordentlichen Leben wandert es zum Friedhof, der hinter der Michaelskirche liegt. Kann sich selbst nicht gelingen, wenn es die Toten zu lange meidet. Der Friedhof, für Daskind die siebente Tür, hinter der das Paradies sich befindet. Von der Welt abgenabelt, liegen sie unter der Erde, harren geduldig der Zersetzung durchs Gewürm. Das muss das Paradies sein, diese passive Art, sich des lästigen Körpers zu entledigen. Die einzige Möglichkeit, dem Herrn die Macht über das gewesene Fleisch zu stehlen, sich zurückzuholen, was ihm angeblich gehört. Weil keine Maden zur Hand sind, legt sich Daskind rote Regenwürmer auf die nackten Beine, hofft es auf die Gier der roten Fresser und bietet ihnen seine Haut bedingungslos zum Fraß. Aber die wollen nichts vom Kind, fallen vom Bein, verschwinden in der Erde. Bedauernd verfolgt Daskind ihren Rückzug.
Im hintern Teil des Friedhofs, unweit der Friedhofsmauer, die alte Eibe. Der Baum wächst in den Himmel wie die Tannen. Daskind weiß nicht, was für ein Schmerz so hoch hinauf zwingt, wie viel Glanz man ihm genommen oder welchem Gesang er sich so verzweifelt entgegenstreckt. Jedenfalls scheint er ein trauriger Baum zu sein. Daskind streicht mit den Händen über die rötlich braune Rinde, umfasst den Stamm, um das Herz schlagen zu hören. Mit den Bäumen kennt es sich aus. Und die Bäume mit dem Kind. Dieser hier ist nicht nur ein trauriger Baum, in der Blüte wird er ausgesprochen freundlich, wenn sich ein Mensch in seinen Schatten legt. Das tut Daskind im Frühling, wann immer es kann, denn auch für die Friedhofspaziergänge muss man sich davonschleichen, Frieda Kenel überlisten, das Haus ungesehen verlassen und dafür sorgen, dass die Gartentür nicht knarrt. Bleibt der Weg durchs Dorf, an Kellers Laden vorbei zum Italiener, der in seinem Schaufenster Kämme, hübsche Frauenfrisuren, Scheren, Rasiermesser, Seifen und dicke Pinsel aus Dachshaar feilbietet. Dann der Hauptstraße entlang zur alten Schule, wo jetzt im Dachgeschoss die zwei Lehrerinnen wohnen, Nonnen in schwarzen Gewändern und Schleiern. Schwester Guido Maria betreut die erste Klasse, Schwester Eva die zweite und dritte, die höheren Klassen werden von Lehrern unterrichtet.
Die unteren Stockwerke des alten Holzbaus dienen nicht mehr als Schule. Daskind liebt diese Räume, die knarrenden Bretter unter den Füßen, das weiche Licht, wenn die Sonne die langen Fensterreihen mit den staubigen Scheiben bescheint. Die niedrigen Bänke sind mit Nachrichten vollgekritzelt; Bruno libt Mari, die Vreni den Josef, auch: Rösi ist eine tume Kuh, Zahlen, pfeildurchbohrte Herzen, Gedächtnisstützen, Fratzen und Karikaturen. In den Tintenfässern vertrocknet die Tinte zu unansehnlichen Klümpchen, da und dort liegen noch angekaute Federhalter, gebrauchte Löschblätter, alte Schulbücher. An den Wänden hängen Zeichnungen, das Papier schon etwas vergilbt und brüchig.
Der blau gekachelte Holzofen ist nicht ausgeräumt. Niemand hat sich nach dem Umzug die Mühe genommen, die Schulräume zu reinigen. Als hätten die Kinder in letzter Minute flüchten müssen, alles zurücklassend, was nicht unbedingt notwendig war, so sieht es aus, und das liebt Daskind, das nicht flüchten kann.
Den Kiesplatz vor dem neuen Schulhaus durchquert Daskind im Laufschritt. Das rhythmische Knirschen unter den Sohlen nicht achtend, huscht es an den blank geputzten Fensterreihen vorbei und übersieht die glotzenden Kinder hinter den Scheiben. Dann ist das Schulhausportal zu überwinden, wo der Schulwart mit der Pfarrhaushilfe plaudert und mit der Faust droht, wenn Daskind zu nahe kommt. Das Schulhaus, den Schulwart und die Pfarrhaushilfe im Rücken, streicht es auf Zehenspitzen der Rosenhecke des Kirchgartens entlang, am schlafenden Köter des Sigristen vorbei, dringt zur St. Michaelskirche vor und nähert sich endlich dem Friedhofstor. Das heisere Geräusch des eisernen Tors zerschneidet Stille und Zeit, dem Kind fällt das Dorf ab, es ist für die Eibe bereit.
Die Freundlichkeit des Baumes liegt in seinem Duft, den er großzügig verströmt. Ein bitterer, schwerer Geruch, der sich zuerst auf Gaumen und Nasenschleimhäute legt und das Irdische in den Gedanken begrenzt. Nach einem leichten Brechreiz und einer kurzen Dumpfheit in Gehirn und Gliedmaßen füllen sich die Lungen mit weicher, leicht salziger, fließender Luft. Diese Luft nimmt dem Körper die Schwerkraft und gibt ihm die Bedürfnislosigkeit der Zeit im mütterlichen Bauch zurück. Der Duft der blühenden Eibe bemächtigt sich der Haut, macht sie fügsam und willig, dringt in die Poren vor, in jene Bereiche, die selbst Liebenden verborgen bleiben. Mit unsichtbaren Händen streichelt er die Haut und das Verborgene, beruhigt das gequälte Geschlecht, Daskind lächelt im Schlaf.
Abgestorbene Nadeln der Eibe bedeckten die am nächsten gelegenen Gräber und das grüne Band hinter der Friedhofsmauer. Hier waren des Kindes liebste Toten zu Hause, die Selbstmörder, Verbrecher und die Ungetauften. Ihre Leichen wurden im Morgengrauen verscharrt. Kein Pfarrer war zugegen, wenn der Ochsner Toni den schmucklosen Sarg in das Loch versenkte. Das war es ja gerade, was man den Unglücklichen vorenthalten wollte, den Segen der Kirche. Schweigend ließen der Sigrist und der Ochsner Toni die Särge ins Loch gleiten, schütteten das Grab zu und bedeckten die im Morgengrauen dampfende Erde mit den vorher ausgestochenen Grassoden. Dann klopften sie sich die Hände an den Hosen sauber, gingen wortlos davon.
Solche Begräbnisse sind selten. Seit Daskind ins Dorf geholt wurde, musste man nur drei Menschen hinter der Friedhofsmauer verscharren. Wenn die Frauen im Dorf davon sprachen, bekreuzigten sie sich und murmelten amen. Einmal wurde ein Neugeborenes verscharrt, der Sarg war so klein, dass ihn der Ochsner Toni wie ein Postpaket unter den Arm geklemmt trug und dabei nicht einmal ächzte.
Nachts scheinen die Pflegeeltern schwerhörig zu sein. Nichts stört ihren Schlaf in der Kammer gegenüber der Küche. Hören nicht das leise Knarren der Treppenstufen, nicht die vorsichtigen Schritte des Kindes, wenn es das Haus verlässt. Beim Gartentor angekommen, hält Daskind atemlos inne. Die Straßenlaterne verschluckt die Sterne.
Die Nacht des Kindes ist ein undefinierbarer Ort. Ungeduldig zehrt die Nachtluft von der Wärme am Kind.
Ein schwaches Licht beleuchtet die Stelle, wo das Neugeborene begraben werden soll. Ein bescheidener Hügel ausgehobener Erde ist nötig, um dem kleinen Holzsarg Platz zu schaffen. Bald werden sich Maden und Würmer an das Ungetaufte heranmachen, werden es von innen her zersetzen, bis nichts mehr bleibt als ein paar Knöchelchen und ein winziger Schädel. Sogar ein Neugeborenes kann sich der Allmacht Gottes entziehen, denkt das Kind, dem Herzen Jesu, der das unbesudelte Fleisch erbarmungslos zu sich holt.
Die Männer können das lauernde Kind nicht sehen. Gleichmütig gehen sie ihrer Arbeit nach. Daskind kauert fröstelnd an der Mauerstelle, wo ein faustgroßes Loch den Blick auf den verwunschenen Ort freigibt. Dem Kind entgeht nichts, nicht die blinde Sicherheit der arbeitenden Hände, das rohe Holz des Kindersargs, der dampfende Schlund der Erde.
Durch die Tannenbretter hindurch sieht Daskind das Kind.
Will weinen.
Spürt die rätselhafte Wärme des Unglücks.
Ragt mit seinen Antennen fürs Tote in die Friedhofsnacht, mit nichts als einer Sehnsucht bekleidet.
Als der kleine Sarg in den dampfenden Schlund gesenkt wird, sinkt auch Daskind. Hat die Nacht ein Rechteck Klarheit ausgespart, in dem Daskind versinkt, langsam, unterm Arm des Ochsner Toni, der ein großer Tröster ist, ein Erzengel, dem Herz Jesu trotzend.
Im Kind schneit es, wird es weiß und nachgiebig.
Tief gräbt eine Scherbe sich dem Kind in die Haut, als das Bamert Anneli begraben wird. Ein Höhepunkt im Leben der kleinen Dorfgemeinde. Das Unglück wird während Wochen besprochen, nicht nur in der Nähstube der Schneiderin Frieda Kenel, auch an den Stammtischen der Dorfvereine, selbst in der Sennhütte konnten sie sich nicht satt reden an dem Geschehen. Obwohl niemand genau wusste, was sich an jenem Tag tatsächlich ereignet hatte, als sich Louis Schirmer, auf dem schweren Motorrad vom Vorderberg kommend, und das Bamert Anneli, das Fahrrad den Stutz hinaufschiebend, am frühen Morgen auf halber Höhe am Vorderberg begegneten. Keiner ahnte, was Louis Schirmer, ein reicher Bauernsohn aus der Nachbargemeinde, um diese Zeit auf dem Vorderberg zu suchen gehabt hatte, und der Umstand, dass sich die Bamert Anni just an jenem Morgen eine halbe Stunde später als sonst auf den Weg zum Vorderbergseppli gemacht habe, verweise geradezu schreiend auf einen Plan des Teufels. Ein Goschmar sei es, mit oder ohne des Teufels Hilfe, wisperte die Freudenstau über den Ladentisch der Kellers, wobei sie das O so raffiniert in die Länge zog, dass aus dem Wort fast ein Jodel wurde.
Anni Bamert hatte das Wärchen früh lernen müssen. Der kleine Hof der Bamerts warf kaum etwas ab. Vater Bamert hatte sich außerdem mit dem Kauf einer elektrischen Baumsäge so hoch verschuldet, dass er beim Wuchermoritz vorstellig werden und ein Darlehen erbetteln musste. Der, mit richtigem Namen Schirmer, Vater ebenjenes Louis Schirmer, bot Hand zum Handel und setzte einen derart unverschämten Zins fest, dass auch der Hinterletzte begriff, weshalb man ihn Wuchermoritz nannte. Wuchermoritz, von ungetrübter Habgier, lachte sich nach dem Handschlag ins Fäustchen; hatte er doch den Bamert soeben zum Pächter seines eigenen Hofes gemacht.
Kaum aus der Schule, verdingte sich die Bamert Anni dem ledig gebliebenen Vorderbergsepp als Magd. Schließlich hatte man vom Herrgott zwei Hände bekommen, die anpacken konnten. Mägde waren noch billiger zu haben als Knechte, darum erledigte das Anneli zusätzlich zur Hausarbeit auch die Arbeiten im Stall, nachdem der Sepp in der Frühe die Kühe gemolken und, wenn es die Jahreszeit erlaubte, am steilen Hang ein paar bescheidene Schübel Gras gemäht hatte. Der Sepp hätte die Anni gerne geheiratet, aber da war der beträchtliche Altersunterschied, das Gespött und Gerede hätten nicht lange auf sich warten lassen. Der Sepp, ein Sonderling, im Dorf nur einmal jährlich gesehen, während des Jahrmarkts auf Schättis Viehweide. Da stand dann der Sepp mit einem melancholischen Staunen in den Augen vor den gut genährten Kühen mit ihren prallen Eutern, staunte noch mehr ob der geballten Kraft der Stiere, deren Felle, in schönes Licht getaucht, seidig glänzten. Wehmütig dachte er an das magere Vieh auf dem Berg. Das würde er sich nie leisten können, nicht eine einzige dieser Kühe, nicht einmal einen Ochsen, der ihm einen Teil der Arbeit abnehmen könnte.
Ein Auge auf das Bamert Änneli hatte auch Louis Schirmer geworfen. Der, gewohnt zu bekommen, was er begehrte, strich dem Mädchen nach. Kein Ort im Dorf, wo sich Anni vor seinen Nachstellungen hätte verstecken können. Louis spürte es selbst in der Kirche auf. Bei der Kommunion, wenn sich Frauen und Männer aus ihren Bänken zwängten und beide in getrennten Reihen, aber nebeneinander, nach vorne schlurften, um den Heiland zu empfangen, schaffte es Louis Schirmer, neben Anni Bamert an den Altar zu treten, um, wiewohl ungläubig, in gotteslästerlicher Weise vor dem heiligen Sakrament das freche Maul aufzureißen. Der Triumph war nicht zu übersehen, wenn er, das hilflose Änneli im Visier, an der Hostie lutschte und an ihrer Seite ins Kirchenschiff zurücktrat. In der er als nicht Einheimischer eigentlich nichts zu suchen hatte. Die Nachbargemeinde hatte schließlich ihren eigenen Pfarrer in der eigenen Kirche, aber das kümmerte Louis Schirmer nicht.
Von Schirmers Nachstellungen eingeschüchtert, wurde Anni Bamert immer stiller. Im Dorf flüsterten sich die Frauen mitleidig zu, dass selbst ihr Schneewittchenhaar an Glanz verloren habe und die milchweiße Haut noch durchsichtiger geworden sei. Scheu und niedergeschlagen machte sie die täglichen Einkäufe für den Vorderbergsepp. An den wenigen Tanzanlässen im Schwanen fehlte sie ebenso wie in der Frauenriege. Wenn es ihre Aufgaben nicht erforderten, mied sie das Dorf.
Von der Kanzel wetterte Pfarrer Knobel über die Abtrünnigen, drohte ihnen Tod und Hölle an, wenn sie nicht in den Schoß der Kirche zurückfänden, aber Anni Bamert war nicht mehr zu bewegen, die Michaelskirche zu betreten, so groß war die Scham, Gegenstand eines solch unverschämten Begehrens zu sein.
Nach dem Unglückstag meinte mancher, man habe das arme Kind schmählich im Stich gelassen. Wenn jetzt die Anni zusammen mit ihrem Freier außerhalb der Friedhofsmauer liege, könne sich der eine oder andere ruhig ins Gewissen schreiben, dass die Geschichte auch wegen der Bigotterie der Dörfler ein schlimmes Ende gefunden habe.
An diesem Tag vergaß der Vorderbergbauer seine Grundsätze, die ihm verboten, den Hof mehr als einmal jährlich zu verlassen. Noch nie war es vorgekommen, dass die Anni nicht pünktlich zur Arbeit erschien. Er hätte seine Uhr nach ihr richten können. Beunruhigt zerrte Sepp sein verrostetes Motorvelo aus dem Schuppen und schwang den Hintern unbeholfen auf den speckigen Ledersitz. Dem stotzigen Hang entlang fuhr er zur Stelle, wo der Waldweg in seinem kargen Weideland endete, in der Erwartung, hinter der ersten Wegbiegung Anni entgegenkommen zu sehen, die sich, kann ja einmal vorkommen, nur verspätet hatte. Als er Anni nicht antraf, fuhr er vorsichtig den schmalen Waldpfad hinunter in Richtung Dorf.