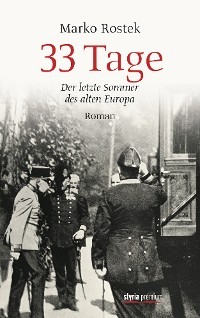Kitabı oku: «33 Tage», sayfa 2
„Mein verehrter General“, beginnt Berchtold und lehnt sich dabei in seinem Sessel zurück, „wie Sie wissen, können wir gegen Serbien nicht vorgehen, ohne dass Russland, bei seinen traditionellen Beziehungen zu diesem Balkanstaat und ohne einen ungeheuren Verlust an Prestige, unserem Vorgehen tatenlos zusehen kann. Und was das bedeutet, brauchen wir nicht näher zu erläutern! Die Folgen des russischen Eingreifens liegen doch offen zutage …“ „Die Folgen des Attentates liegen ebenfalls offen zutage, Herr Minister!“, unterbricht ihn Conrad. „Die seit Langem zu beobachtenden nationalistischen Strömungen der südslawischen Rasse können auch Sie nicht wegleugnen und wir haben die Wahl, ob dieser angestrebte Zusammenschluss der Slawen innerhalb der Monarchie auf Kosten Serbiens oder außerhalb der Monarchie auf unsere Kosten erfolgen wird. Ich“, Conrad hebt seine Stimme, „habe schon oftmals betont, dass mit dem Verlust der südslawischen Länder nicht nur ein Territorial-, sondern auch ein enormer Prestigeverlust für die Monarchie entstehen könnte. Österreich würde zu einem Kleinstaat verkommen!“
Conrad ist aufgestanden, ihm schaudert bei dieser Vorstellung. Klein beizugeben, entspricht so gar nicht seinen Wesenszügen. Er ist immer Klassenbester gewesen, von der Kadettenzeit bis zur Militärakademie, immer auf ein Ziel ausgerichtet: Meister seines Faches zu sein. Jetzt, da er die für seine Begriffe verspätete Chance gekommen sieht, am Balkan endlich für klare Verhältnisse zu sorgen, will er sich nicht ein weiteres Mal von den Bürokraten vorführen lassen. Er steht auf, blickt fest entschlossen auf Berchtold hinunter und erwartet dessen Reaktion. Berchtold, ohnehin schon sorgfältig platzierte Büroutensilien zurechtrückend, lässt einige Augenblicke verstreichen, um die erhitzte Atmosphäre zu beruhigen. Dann antwortet er, Conrad mit der rechten Hand auf den Sitz zurückdeutend, mit sanfter Stimme: „Mein lieber Conrad, setzen Sie sich wieder. Natürlich kennen wir alle Ihre Denkschriften und wir haben sie oftmals erörtert, aber …“, Berchtold macht eine Gedankenpause, „Aktionen ohne Rückversicherungen können bei der aktuellen Mächtekonstellation ebenfalls das Ende der Monarchie bedeuten. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Ich gebe Ihnen allerdings recht, dass wir diesmal den nun eingetretenen Moment zur Lösung der serbischen Frage nicht ungenutzt verstreichen lassen dürfen. Seine Majestät ist ebenfalls heute aus Ischl zurückgekehrt und ich habe morgen eine Allerhöchste Audienz hierzu. Um die Gunst der Stunde in unserem Sinne und vor allem gegenüber den Mächten zu nutzen, müssen wir, verehrter General, außerdem den Ausgang der Untersuchungen in Sarajevo abwarten.“
„Die Moslems und Kroaten der Monarchie sind gegen die Serben“, entgegnet Conrad, während er sich wieder hinsetzt. „Und die Russen müsste man mit dem Hervorheben des Antimonarchischen dieser Tat beruhigen. Das ist die Aufgabe Ihrer Dienststelle, Herr Minister. Die politische und militärische Außenwirkung der Monarchie muss einheitlich sein. Wir können uns keinen Gesichtsverlust mehr leisten!“ Conrad hebt abermals seine Stimme und blickt auf das Porträt des Amtsvorgängers von Berchtold, Graf Aehrenthal. Dann fährt er fort: „Wir können am 1. Juli mobilisieren und Serbien ohne weitere Verhandlungen zur Rechenschaft ziehen. Wenn man eine giftige Natter an der Ferse hat, schlägt man ihr den Kopf ab und wartet nicht auf den tödlichen Biss!“
Den letzten Satz hat der General dem Minister voller Polemik entgegengeschleudert. Berchtold, der weiß, dass Conrad auf die nur mit Mühe abgewickelte bosnische Annexionskrise sowie seine, Berchtolds, zweifelhafte Außenpolitik während der beiden Balkankriege 1912 und 1913 anspielt, entgegnet mit Bedacht, um die Geduld nicht zu verlieren: „Wir werden angemessen reagieren. Ich habe mir ein Vorgehen zurechtgelegt, wie wir auf diesen barbarischen Akt reagieren werden. Zum einen müssen wir den Ausgang der Untersuchungen in unsere Reaktion mit einfließen lassen, zum anderen ist es unsere Pflicht, die Haltung unseres Bundesgenossen zu erfragen … Ja, bitte?“ Berchtold wird von einem vorsichtigen Klopfen unterbrochen und blickt zur Tür. Ein Mitarbeiter tritt mit dem Hinweis auf den bevorstehenden Ministerrat ein und unterbricht auf diese Weise das Gespräch. Berchtold bedankt sich bei dem Mann, der mit einer Verbeugung den Raum verlässt. Sich an Conrad wendend, fährt Berchtold fort: „In 30 Minuten beginnt ein Sonderministerrat, in dem wir die weitere Vorgehensweise erörtern werden. Ich werde auch Ihren Standpunkt einbringen, Herr General. Morgen bin ich, wie gesagt, bei Seiner Majestät zur Audienz und danach, so schlage ich vor, unterbreite ich Ihnen die Ergebnisse beider Zusammenkünfte. Ich ersuche Sie, mir ebenfalls über die Entwicklungen Ihrer Termine und vor allem bezüglich der Ereignisse in Sarajevo Bericht zu erstatten.“ Conrad und Berchtold stehen auf, verabschieden sich kurz mit höflichen Floskeln und Conrad von Hötzendorf verlässt entschlossenen Schrittes das Büro.
Nachdenklich setzt sich Leopold Berchtold wieder an seinen Schreibtisch. Der Handlungsspielraum für die Monarchie ist ausgesprochen begrenzt, denn wie auch immer die Reaktion auf diesen Mord ausfallen wird, die Konsequenzen könnten fatal sein. „Vom militärischen Standpunkt aus hat Conrad recht“, denkt sich Berchtold. „Aber trotzdem: Ein Krieg gegen Serbien, in den höchstwahrscheinlich Russland eingreifen wird, ist die letzte Alternative, bevor wir nicht wissen, wie sich Deutschland dabei verhält! Wir stehen doch mit dem Rücken zur Wand!“ Berchtold blickt auf die Uhr. Bis ins Parlament braucht er zu Fuß etwa 15 Minuten, also hat er noch einen Augenblick Zeit. Als Leiter des Auswärtigen Amtes muss er in diesem tragischen Fall die Richtung vorgeben und entsprechend selbstbewusst auftreten. Er geht zum Spiegel, richtet sich Kragen und Schlips, zupft an seinem Jackett und wirft einen Blick auf die Schuhe. Ein Taschentuch zückend, bückt er sich und entfernt die Staubschicht von seinen schwarzen Schuhen. Dann richtet er sich wieder auf und blickt prüfend in den Spiegel. Seine makellose Erscheinung entlockt ihm den Anflug eines zufriedenen Lächelns. Er dreht sich um, sortiert die Arbeitsunterlagen vom Schreibtisch in die Aktentasche und eilt raschen Schrittes die Korridore des Ministeriums entlang.
DIENSTAG, 30. JUNI
Oskar Potiorek steht vor einer Zellentür des Stadtgefängnisses von Sarajevo und zögert. Er ist unrasiert, müde, unausgeschlafen. Seine Augen, mit schwarzen Ringen untermalt, liegen in tiefen Höhlen und versuchen, irgendwo an der Zellentür Halt zu finden. Langsam und behäbig nähert sich der Feldzeugmeister der Tür und gibt dem Wachmann schließlich doch ein Zeichen, sie zu öffnen.
***
Für den 61-jährigen Potiorek, General der Kavallerie im Rang eines Feldzeugmeisters, waren die Stunden nach dem Attentat ein einziger Albtraum. Rund um die Uhr trafen Telegramme, Depeschen, Telefonanrufe aus der gesamten Monarchie und aus dem Ausland in Sarajevo ein. Es waren Hunderte. Die Männer im Telegraphenbureau musste man im Dreistundenrhythmus wechseln, länger hielt ihre Konzentrationsfähigkeit nicht an. Die Heerschar der Reporter und Berichterstatter, die über die Stadt hereingefallen war, wuchs rasch, nachdem sich die Unglücksmeldung seit Sonntag verbreitet hatte. Neben den beiden Toten stand Oskar Potiorek im Mittelpunkt des Interesses. Alle Anfragen und Auskunftsersuchen hatten einen ähnlichen Inhalt: Wie war der Hergang des Attentats? Wer sind der oder die Täter? Wie konnte das überhaupt geschehen? Wer trägt die Verantwortung? Immer wieder wurde die Frage nach Ursache und Verantwortung vorgebracht. Mit schonungsloser Gewalt forderten die Wissbegierigen Antworten.
Potiorek hatte die Tragweite der Katastrophe im Laufe der ersten Nacht nach und nach realisiert. Jede anklagende Anfrage, die auf seinen Schreibtisch oder an sein Ohr gelangte und Erklärung sowie Rechenschaft forderte, riss vor ihm jenen Abgrund weiter auf, an dem er sich nun wiederfand. Mit jedem publizierten Detail des Verbrechens würde die Meute auch ihn und seine Verantwortung als oberster Landeschef von Bosnien und Herzegowina vor die Öffentlichkeit zerren. Der Attentäter Gavrilo Princip hatte mit seinen Schüssen am 28. Juni nicht nur das Thronfolgerpaar gerichtet, sondern auch seine, die heile Welt des Oskar Potiorek, zum Einsturz gebracht. Dem Landeschef wurde keine Zeit zum Atemholen gegönnt, keine Möglichkeit der Aufarbeitung des Geschehenen, denn noch in der Nacht zum Montag kamen aus Wien erste Anweisungen zum Trauerzeremoniell. Potiorek richtete seine ganze Aufmerksamkeit und Konzentration darauf. Wenigstens bei der Abwicklung dieser so traurigen Aufgabe sollte alles fehlerfrei ablaufen.
Der Montag stand daher ganz im Zeichen der Vorbereitung der Trauerfeier und der Überführung der Särge zum Bahnhof. Das Hofzeremoniell ließ für den Umgang mit dem ermordeten Thronfolgerpaar keine allzu großen Spielräume. Die Überführung war für den Abend vorgesehen. Und wieder hatte sich eine große Menschenmenge entlang der Straßen eingefunden. Diesmal jedoch, Potiorek hatte alle verfügbaren Soldaten der Umgebung in die Stadt befohlen, war genug Wachpersonal und Militär anwesend, das die Straßen freihielt. Als der Trauerzug am Bahnhof eintraf, wurden Salutschüsse mit eigens herbeigebrachten Kanonen abgefeuert und unter großer Anteilnahme der Bevölkerung sang man die Volkshymne. Dann fuhr der Trauerzug mit der Bahn in Richtung Meer ab. Von dort, Potiorek hatte sich mit dieser Route gegenüber den Wünschen Wiens und zu Ehren des Erzherzogs durchgesetzt, würden die Särge auf die Viribus Unitis verladen, bis Triest verschifft und dann mit dem Zug nach Wien gebracht. Dieser Reiseverlauf entsprach exakt der Fahrt des Erzherzogs nach Bosnien, bevor diese auf so tragische Weise geendet hatte.
Nach der Zeremonie forderten Potioreks Nerven und die Müdigkeit ihren Tribut und er begab sich in den Konak, um sich ein wenig Ruhe zu gönnen. Doch durch die Anspannungen des Tages und der Nacht konnte er keinen erholsamen Schlaf finden und wälzte sich unzählige Male im Bett hin und her. Die Ereignisse hinterließen auch in seinem Traum ihre Spuren und riefen Zerrbilder der vergangenen Stunden hervor. Schweißgebadet wachte er schließlich auf und entschloss sich noch in der Nacht, Gavrilo Princip im Gefängnis gegenüberzutreten. Er musste diesen Jungen sehen. Er wollte wissen, wie es sich anfühlte, dem eigenen Schicksal zu begegnen.
***
Es knarrt laut und in den verrosteten Türangeln quietschen die Scharniere, als der Wachmann die Tür öffnet, hineinspäht und, nach einer Prüfung, ob für den Landeschef ein sicheres Eintreten möglich ist, Oskar Potiorek den Zutritt freigibt. Der Feldzeugmeister hat keine Erfahrung im Umgang mit politischen Attentätern, wie Princip einer ist. Unsicherheit beschleicht ihn. Ihn, der seit er auf den Posten des Landeschefs berufen ist, die Geschicke dieser jüngsten Provinz des Habsburgerreiches mit Vehemenz von seinem Schreibtisch aus geführt hat. Er zögert wieder. Nachdem er sich mit einem weiteren prüfenden Blick der Wachsamkeit und Einsatzbereitschaft des Wachpersonals vergewissert hat, tritt Potiorek ein. Wie zum Hohn muss er dabei seinen Kopf senken und gewissermaßen eine Verbeugung andeuten, denn die Zellentür ist nach uralter Bauart viel zu niedrig für seine Größe. In der Gefängniszelle blickt er hastig um sich und versucht, der ihm fremden Situation Herr zu werden, indem er sich möglichst hoch aufrichtet und so seiner Autorität Gewicht verleiht. Das Bild, das sich ihm bietet, lässt seine Verunsicherung jedoch rasch schwinden und er weist das hinter ihm in die Zelle drängende Wachpersonal mit einer Handbewegung an, sich zu entfernen. Mit einem satten Geräusch schließt sich die Zellentür und der schwere schmiedeeiserne Riegel wird langsam entlang der alten, massiven Holzdielen in seine Verankerung geschoben. Es herrscht Stille.
Potiorek blickt noch einmal prüfend im Raum umher. Die Wände sind grob verputzt und was einmal ein weißer Kalkanstrich war, ist mit der Zeit vergilbt und verstaubt. Überall sind Kratzspuren und Bemalungen von früheren Insassen zu sehen, selbst der Plafond wurde bekritzelt. Im linken hinteren Eck steht eine Bettstatt mit dem für Gefängnisse typischen Bettzeug: Eine unförmige Matratze, ein Polster und eine Decke, die auf einem einfachen Holzgestell liegen, sind mit grobem Leinen überzogen. Sein Blick wandert weiter zum Fenster, das hoch oben, fast direkt unter der Decke, angebracht ist. Selbst an diesem warmen, schönen Tag lässt es nur wenig Tageslicht in die Zelle, sodass alles ein wenig fahl und matt erscheint. Die Kühle im Raum und Potioreks Übermüdung sorgen dafür, dass ihn ein kalter Schauer erzittern lässt. Neben dem Bett und dem Holzeimer für die Notdurft des Insassen gibt es nur noch einen armseligen Holztisch und einen ebensolchen Sessel. Für den Besucher ist jedoch kurz vor seiner Ankunft ein zweiter Sessel gebracht worden.
Potiorek spürt, wie sich seine Hände, die hinter dem Rücken die Handschuhe seiner Uniform halten, unwillkürlich zu Fäusten ballen. Durch die beinahe atemlose Stille im Raum hört er, wie das Leder der Handschuhe knirschend zusammengepresst wird. Potioreks Puls steigt an und sein Blut beginnt am eng anliegenden Kragen seiner Uniform zu pulsieren. Plötzlich ist die Kühle im Raum nicht mehr zu bemerken und auch die Müdigkeit scheint wie weggeblasen. Potiorek versucht, seine Erregung zu unterdrücken, und beruhigt mit einem tieferen Atemzug seinen Puls. Er geht langsam, den Blick nun starr geradeaus gerichtet, zum Tisch und setzt sich auf den freien Sessel.
Was kann er einem Fanatiker wie Princip wohl sagen? Soll er etwa die Frage nach dem Warum stellen? Soll er diesen 18-jährigen bosnischen Burschen mit Vorwürfen konfrontieren, ihm den Irrsinn seiner Tat vorhalten? Nichts dergleichen kann die Tat rückgängig machen und damit sein Schicksal wieder ins Lot bringen. Und auf eine politische Debatte hat er keine Lust.
Müdigkeit und Resignation befallen erneut Potioreks Körper. Im Angesicht des Elends, das da vor ihm sitzt, fällt das Gerüst seiner Moralpredigt, die er sich zurechtgelegt hat, langsam und unaufhaltsam in sich zusammen und hinterlässt nichts als Leere. Princip scheut sich, ihn direkt anzublicken, und starrt regungslos auf die Tischplatte. Die Augen des Attentäters wirken bleiern und fahl, sein Gesicht ist blass. Die Augenringe lassen ihn älter aussehen, als er in Wahrheit ist.
Potiorek fährt sich mit einer Hand durch sein schütteres Haar. Zweifel über die Sinnhaftigkeit dieses Besuches befallen ihn. Er steht wieder auf und geht an das hintere Ende der Zelle. Dicht vor der Wand bleibt er stehen. Potioreks Gedanken verschwimmen. Er spürt die Feuchte der Wand, kann die alte Farbe riechen, das leicht Schimmlige und Modrige in der Mauer. Drei-, viermal atmet er stehend tief ein und aus, dann gewinnt sein Machtbewusstsein einmal mehr die Oberhand und er geht, diesmal mit festem Schritt, zum Tisch zurück und setzt sich wieder auf den Stuhl. „Im Angesicht dieses Mörders“, seine Gedanken gewinnen spürbar an Entschlusskraft, „und so wahr ich hier sitze, werde ich alles in meiner Macht Stehende ausreizen, damit dieses Odium der Schuld nicht an mir haften bleibt!“
***
Bei seiner Berufung zum Landeschef von Bosnien hatte er gehofft, einen ruhigen Posten anzunehmen. Als er nach Sarajevo kam, informierte er sich nur oberflächlich über die politische und militärische Lage im Land, gesellschaftliche oder soziale Belange interessierten ihn noch weniger. Er zog in den Konak, das herrschaftliche Palais der Stadtväter, und führte von dort aus in streng administrativer Manier das Land. Er machte nie viel Aufhebens um die Bevölkerung und deren Bedürfnisse, Entscheidungen traf er hinter seinem Schreibtisch sitzend. Bis jetzt hatte er in Sarajevo immer ein relativ angenehmes Auskommen gehabt! Die paar Jahre, die ihm noch bis zum Ruhestand blieben, sollten mit dem Besuch des Thronfolgers einen krönenden Höhepunkt erreichen. Schon kurz nachdem er über diesen Besuch informiert worden war, beschäftigte er sich daher intensiv mit der Planung und Organisation des erzherzoglichen Aufenthaltes. Mehrmals wurden seine Pläne und Vorschläge von Wien korrigiert, nicht zuletzt auch mit dem Hinweis auf budgetäre Engpässe. Schließlich konnte man sich doch einigen und das Programm festlegen.
Es gab immer wieder Gerüchte, dass es zu Störversuchen kommen könnte, aber Unannehmlichkeiten dieser Art würden bei jedem Besuch eines Mitglieds der kaiserlichen Familie in allen Teilen der Monarchie vorkommen. Die Besorgnis von Potiorek und seinem Mitarbeiterstab war nicht größer als sonst. Wie hätte er ahnen sollen, dass just in seiner Stadt ernst gemacht würde und man nach dem Leben des Thronfolgers trachtete. Die üblichen Sicherheitsmaßnahmen entlang der Wegstrecke fielen ebenso wie zusätzliche Wachtruppen dem Spargedanken zum Opfer. Die Benutzung der offenen Wagen war seine Anordnung. Man wollte der großen Hitze Rechnung tragen.
Im Nachhinein erwies es sich als fatal, dass der detaillierte Besuchsablauf schon frühzeitig veröffentlicht worden war. Die größten Vorwürfe gegenüber Potiorek wurden aber laut, weil die Fahrt nach dem ersten Bombenwurf nicht abgebrochen wurde. Er schaffte es nicht, dem Erzherzog die Notwendigkeit einer Planänderung vor Augen zu führen. Geradezu auf einem Präsentierteller setzte man den Besuch fort und gab den sechs jungen, fehlgeleiteten Fanatikern aus Bosnien, keiner älter als 25 Jahre, dazu Gelegenheit, ihren Plan in die Tat umzusetzen. Ein Augenblick genügte und Potioreks persönlich geformte und verwaltete Welt brach inmitten seiner Stadt und vor seinen Augen zusammen. Ein 18-jähriger Gymnasiast hatte ihn vor der Welt gedemütigt und bloßgestellt.
***
Diese Gedanken reißen Oskar Potiorek zurück in die Gegenwart. Zum ersten Mal, seit er die Zelle betreten hat, ist er jetzt in der Lage, sein Gegenüber genau zu mustern. Princip sitzt noch immer regungslos auf seinem Sessel und hält den Kopf gesenkt. Er hat noch denselben Anzug an, den er beim Attentat getragen hat. Das weiße Hemd ist mittlerweile verschmutzt, am Jackett fehlt eine Tasche. „Das ist wohl im Zuge der Handgreiflichkeiten während der Festnahme geschehen“, denkt Potiorek. Er zieht den rechten Handschuh an und streckt langsam seine Hand über den Tisch. Ohne Widerstand lässt sich der Kopf des jungen Mannes anheben. Potiorek blickt in zwei schwarze, grimmige Augen. Das dichte Haar und der typisch unregelmäßige Oberlippenbart können sein Alter nur schwer verbergen. Potiorek blickt lang in die Augen des Attentäters und versucht, auch nur den geringsten Anflug von Reue oder Schuldbewusstsein zu entdecken. Vergebens. Vielmehr hat der Landeschef den Eindruck, als erblicke er so etwas wie Mitleid für ihn selbst im Blick des jungen Bosniers. Nein, reden hätte keinen Sinn, jedes Wort wäre ein Wort zu viel und vergebens!
Die Verletzlichkeit und Jugend des Jungen lassen Potiorek zur Überzeugung kommen, dass selbst der schlimmste Albtraum besiegt werden kann. „Alle Fäden laufen zwar in Wien zusammen und ich bin fern der Machtzentrale“, der Landeschef spürt einen Funken Hoffnung bei diesem Gedanken, „aber noch habe ich Freunde und Einfluss. Die Schuldigen werden bezahlen!“
Etwas zuversichtlicher steht Potiorek auf und bleibt, auf Princip herunterblickend, noch einen Augenblick stehen. Dann dreht er sich um und geht langsam zur Tür. Er klopft zweimal und sofort wird ihm geöffnet. Als Potiorek die Zelle verlassen will, steht Princip auf und ein zynisches Lächeln umspielt seinen Mund. Der Feldzeugmeister, mit einer Hand hat er bereits die Zellentür ergriffen, blickt zurück und stößt mit kräftiger Stimme hervor: „Du hast keine Ahnung, was du mit deiner Tat angerichtet hast, mein Junge, aber ich werde alles daran setzen, dass dir unsere Antwort darauf nicht verborgen bleibt!“
Mit Gewalt fällt die schwere Tür ins Schloss und der Riegel wird wieder vorgeschoben. Princip bleibt noch eine Weile stehen, dann geht er zum Bett und legt sich auf den Rücken. Langsam streckt er sich aus und kreuzt seine Arme über der Brust. Seine weit geöffneten Augen blicken starr auf den Plafond. Lange liegt er regungslos da. Dann, in der Zelle wird es bereits dunkel, fährt er plötzlich hoch und schreit voller Inbrunst in die Stille des Gefängnisses: „Ich bin kein Verbrecher, denn ich habe einen Mann getötet, der Unrecht getan hat! Ich glaube, dass ich richtig gehandelt habe!“
***
Am selben Nachmittag, während in Sarajevo Feldzeugmeister Oskar Potiorek das Gefängnis verlässt, sitzt der Botschafter des Deutschen Reiches in Wien, Heinrich Leonhard von Tschirschky und Bögendorff, in seinem Büro und arbeitet an einem Bericht für seinen Vorgesetzten in Berlin.
Am Morgen hat er als einer von vielen Vertretern der ausländischen Mächte dem Außenminister der österreichisch-ungarischen Monarchie seinen Kondolenzbesuch abgestattet. In diesem Rahmen hat sich auch die Gelegenheit zu einer kurzen privaten Unterredung mit Graf Berchtold geboten. In völliger Übereinstimmung mit den bisherigen Gepflogenheiten und der offiziellen Haltung der deutschen Außenpolitik hat er sich als offizieller Vertreter seines Landes für ein hohes Maß an Besonnenheit und Zurückhaltung in der Donaumonarchie ausgesprochen. „Österreich darf nichts überstürzen, muss bei Aktionen jedenfalls die europäische Gesamtlage im Auge behalten und darf aus Rücksicht auf den deutschen Bundesgenossen keine übereilten Schritte herbeiführen“, sind seine Worte an Berchtold gewesen. Dieser hat sich dafür sehr freundlich bedankt und versichert, dass in diesen Zeiten eine friedliebende und sachlich ruhige Weltanschauung besonders hilfreich sei.
Jetzt sitzt Tschirschky an seinem Arbeitsplatz und verfasst vorschriftsgemäß seinen zusammenfassenden Bericht über die Ereignisse des Tages an den Kanzler des Deutschen Reiches, Theobald von Bethmann Hollweg. „Ich benutze bei dem österreichischen Minister jeden solchen Anlass, um ruhig, aber sehr nachdrücklich und ernst vor übereilten Schritten zu warnen“, erläutert Tschirschky. Die Feder beiseite legend, lässt er das Gespräch mit Berchtold nochmals Revue passieren. Dieser hat ausgeführt, dass der gesamte Tathergang auf Spuren nach Serbien hindeute und der Thronfolger als ein Opfer einer Verschwörung zu betrachten sei. Auch von anderer Stelle habe man an ihn, Berchtold, seit Bekanntwerden des Attentates ständig den Wunsch herangetragen, mit den Serben endlich abzurechnen. Seine beruhigenden Worte wiederholend, hat der deutsche Botschafter abermals auf die möglicherweise verheerenden Auswirkungen eines unüberlegten österreichischen Vorgehens hingewiesen.
Mit einem zufriedenen Lächeln und im Bewusstsein, beruhigend auf die offiziellen Stellen in Österreich eingewirkt zu haben, unterfertigt der Botschafter seinen Bericht und bringt ihn für die weitere Bearbeitung und den Versand nach Berlin ins Vorzimmer.