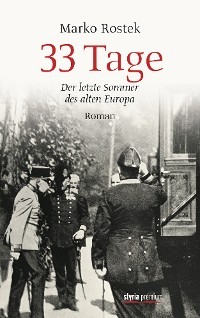Kitabı oku: «33 Tage», sayfa 4
DONNERSTAG, 2. JULI
„Seine Majestät empfängt Sie nun, Herr Minister.“ Leopold Berchtold erhebt sich aus dem Wartesessel und schreitet der ihm zugewiesenen Tür entgegen. Unauffällig, so hofft er wenigstens, versucht er nochmals seine Haltung, seinen Gesichtsausdruck und eigentlich seine gesamte Erscheinung zu korrigieren und dem bevorstehenden Anlass anzupassen. Sogar ein leises Räuspern entfährt ihm. Doch ein verstohlener Blick auf den Adjutanten des Kaisers belehrt ihn im Vorbeigehen eines Besseren. Seine Bemühungen sind aufgefallen. Mit einem aufmunternden Lächeln und einer zustimmenden Kopfbewegung weist ihn dieser in das Arbeitszimmer des Kaisers und schließt die Tür.
Stille.
***
Der Minister des Äußeren war am Morgen wie gewohnt von Anton Brauer geweckt worden. Im Vergleich zu den letzten Nächten in Wien hatte er diesmal jedoch eine unruhige Nacht hinter sich. Er fand lange keinen Schlaf und ging im Geiste oftmals das Gespräch mit Ministerpräsident Tisza durch. Natürlich warf die heutige Audienz beim Kaiser ihre Schatten voraus und er versuchte in den wachen Phasen immer wieder, mögliche taktische Fehler in seinen Formulierungen auszumerzen. Nach dem Aufstehen konnte er keine nennenswerte Erholung in Körper und Geist feststellen. Nach dem Frühstück schrieb er, einer alten Gewohnheit treu bleibend, seiner Frau ein Telegramm und berichtete ihr darin auch von der heutigen Audienz. Für das Studium der Morgenzeitungen hatte er nur eine kurze Zeitspanne übrig, die doch lang genug war, damit ihm wie schon während der letzten Tage auffiel, dass die österreichische und internationale Presse, ausgenommen die serbische natürlich, keinerlei Hetzartikel und ähnliche Kriegstreibereien veröffentlichten. Auf den ersten Blick hielt er dies für ein Positivum, denn so wurde auf die Regierung und auf ihn kein Druck für ein rasches Handeln aufgebaut. Bei näherer Betrachtung musste er sich jedoch eingestehen, dass das Fehlen von Forderungen nach Straf- und Vergeltungsmaßnahmen möglicherweise als Zeichen von weitgehendem Desinteresse interpretiert werden musste. Damit wäre eine breite Zustimmung in der öffentlichen Meinung für einen Waffengang gegen Serbien nur sehr schwer zu erreichen. Im Vorfeld einer Audienz beim Kaiser wollte er sich an diesem Morgen eingehend mit dieser Frage befassen. Noch während er seine Unterlagen ein letztes Mal durchsah, beschloss er, diese Gedanken später seinen engsten Mitarbeitern im Ministerium auseinanderzusetzen.
Zeitgerecht brach er von seiner Wohnung aus direkt nach Schönbrunn auf. Der Kaiser hatte ja seinen Sommeraufenthalt unterbrochen, um in der Hofburgkapelle an der Trauerzeremonie für seinen Neffen teilzunehmen. Für Berchtold, wie für viele andere Regierungsmitglieder, war diese Situation vorteilhaft, denn mit der Allerhöchsten Anwesenheit in Wien entfielen für die Audienzbesuche die mühsamen und zeitraubenden Fahrten nach Ischl.
***
„Wie geht es Ihnen, Herr Minister. Sie sehen blass aus!“ Die Stimme klingt heiser. Berchtold wendet sich in die Richtung, aus der die Worte zu ihm dringen, und sieht den alten Kaiser im Hintergrund des Zimmers stehen. Aufrecht und ungebeugt, den Schicksalsschlag der jüngsten Vergangenheit nicht zeigend, steht der Monarch in der Uniform eines Kavalleriegenerals neben dem Audienzpult. „Vielen Dank für die Allerhöchste Nachfrage, Majestät. Ich befinde mich wohl, jedoch habe ich heute eine kurze Nacht hinter mir. Das wird Euer Majestät mir wohl ansehen.“ „Graf Tisza vertritt offensichtlich seine Ansichten mit ungebrochener Standhaftigkeit“, gibt der Kaiser zurück und unterstreicht damit neuerlich, wie gut unterrichtet er stets ist. Und er führt weiter aus: „Er hat Uns von der Unterredung mit Euch berichtet und Uns seine Argumente ebenfalls nachhaltig vorgebracht. Wir können Uns seinem Standpunkt nicht verschließen …“ Franz Joseph macht eine Pause, blickt auf seinen Schreibtisch, wo neben unzähligen Akten und Papieren auch Fotos seiner Familie stehen. Dann fährt er fort: „Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein, Herr Graf?“
Berchtold beginnt, die Gespräche mit Conrad, den Ministern und den diversen Botschaftern zusammenzufassen, und erwähnt auch seine Eindrücke aus den Pressemeldungen der letzten Tage. Sorgfältig darauf bedacht, in seinen Sätzen keine Formulierungen zu verwenden, die Seiner Majestät eine Handlungsweise aufzwingen könnten, schließt Berchtold mit den Worten: „Durch die Mächtekonstellation in Europa, durch die unsichere Haltung Rumäniens uns gegenüber und die seit den Balkankriegen 1912 und 1913 geschwächte Stellung Bulgariens können wir es uns nicht leisten, gegen Serbien ein weiteres Mal nachsichtig zu sein. Wir stehen vor einem Existenzkampf, Euer Majestät, den wir, sollte Russland eingreifen, allein nicht bewältigen können!“ „Der deutsche Botschafter“, unterbricht ihn der Kaiser, „war gestern bei Uns und hat Uns mit freundlichen Worten zu Besonnenheit und Ruhe gemahnt, jedoch dabei auf das Äußerste betont, dass der deutsche Kaiser Unser wärmster und innigster Bundesgenosse sei und stets seine Bündnispflichten wahrzunehmen gedenke.“ „Auch mir wurde dies mehrmals versichert, Majestät“, erwidert Berchtold und fährt fort: „Ich gebe aber zu bedenken, dass durch ein langes Zuwarten, um eine Vergeltungsmaßnahme zu beginnen, unsere aktuell vorteilhafte Situation, in Anbetracht des schmerzvollen Verlustes, immer mehr zu verblassen droht. Ich fürchte, die moralische Legitimation einer Strafexpedition gegen Serbien wird uns immer mehr abhandenkommen, wenn wir nicht sehr bald reagieren.“ Berchtold zögert kurz, um dem Kaiser Gelegenheit zu einer Antwort zu geben.
Als dieser nicht reagiert, fährt er fort. „Euer Majestät, ich erlaube mir untertänigst, auf die bereits an Euer Majestät übermittelte Denkschrift hinzuweisen, die wir gemeinsam mit dem Kriegsministerium noch vor dem Attentat ausgearbeitet haben. Die Militärs sind der Meinung, dass wir sofort losschlagen sollten, um die Gunst der Stunde zu nutzen. Der ungarische Ministerpräsident, als Gegenpol, neigt der Meinung zu, eine kriegerische Aktion sei nicht vorstellbar. Ich schlage vor, die Denkschrift an das Deutsche Reich zur Kenntnisnahme zu senden, verbunden mit dem dringenden Ersuchen um eine Stellungnahme, welche Haltung Berlin zu unserer Lage im Allgemeinen und zu einer möglichen Vergeltungsmaßnahme im Besonderen einnimmt.“
In diesem Moment tritt die Sonne durch die Wolken und strahlt durch die großen Fenster bis weit in das Innere des Arbeitszimmers. Durch eine unmissverständliche Geste hat sich der Kaiser eine Nachdenkpause ausbedungen und Berchtold wagt es nicht, sich auch nur durch eine unbedachte Bewegung bemerkbar zu machen. In seiner typischen Körperhaltung, mit auf den Rücken verschränkten Händen und leicht nach vorne gebeugt, geht Franz Joseph langsam auf seinen Schreibtisch zu. Nichts ist zu hören, sogar die Schritte des Monarchen dringen nur gedämpft an das Ohr des Ministers, da im ganzen Raum großflächig Läufer und Teppiche verlegt sind. Der Schreibtisch steht nah bei einem der Fenster und gewährt dem Kaiser, wenn dieser auf seinem alten, mit schwarzem Leder bezogenen Stuhl sitzt, einen schönen Blick in den Park. Im Gegensatz zu den sonstigen Gepflogenheiten des Kaisers ist der Schreibtisch Franz Josephs ein formvollendetes Schmuckstück, das die Blicke Berchtolds bei seinen Audienzen immer wieder auf sich zieht. Schon oft hat der Minister als großer Liebhaber alter Kunst und Antiquitäten dieses Meisterwerk der Möbelbaukunst bewundernd betrachtet, doch in diesem Moment gewähren die einfallenden Sonnenstrahlen einen besonders erhabenen Blick auf das Möbelstück. Die zweifach geschwungenen Tischbeine, die sich nach unten hin beeindruckend verjüngen, sind reich verziert und üppig mit allerlei Ornamenten ausgeführt. Bei genauer Betrachtung erkennt man, dass ihre unteren Enden als Pferdefüße ausgeführt sind und so einen Hinweis auf eine der Leidenschaften des Kaisers geben. Die Beine geben einer Tischplatte Halt, die sich mit diesen wiederum zu einem harmonischen Ganzen zusammenfügt. Schmale Laden sind an der Benutzerseite untergebracht, die allerlei Schreibutensilien des Kaisers beinhalten. Berchtold hat bei einer Audienz vor Jahren die Gelegenheit gehabt, einen kurzen Blick hineinzuwerfen, als der Kaiser nach Feder und Tusche suchte. Die Griffe der Laden sind im Gegensatz zum ansonsten im Überfluss mit Verzierungen versehenen Tisch ungewöhnlich schlicht als einfache Messingringe ausgeführt. Wenn der Kaiser diese anhebt, um die jeweilige Lade aufzuziehen, kann man, die entsprechende Stille vorausgesetzt, ein leichtes Quietschen vernehmen. Neben den Stößen mit Akten, Papieren sowie einigen Bildern stehen an beiden Seiten des Tisches zwei klassische Öllampen, die auch dann für ausreichend Licht sorgen, wenn der Kaiser wie gewöhnlich seinen Arbeitstag um 5 Uhr morgens beginnt.
Leopold Berchtold richtet nun, nach wie vor am selben Platz stehend, seinen Blick wieder auf den Kaiser und beobachtet jede Regung des greisen Herrn scharf. Seine Bewunderung für den Kaiser mischt sich mit Ehrfurcht, schließlich ist Franz Joseph länger im Amt, als der überwiegende Teil der Bevölkerung alt ist. „Wie oft in den letzten Jahren bin ich schon hier gestanden und habe schwierige und weitreichende Belange vorzutragen die Ehre gehabt. Viele davon haben das Schicksal der Monarchie mitbestimmt“, erinnert sich Berchtold an die letzten beiden Jahre, als die Balkankriege eine vollkommen ähnliche Ausgangslage schufen. Nur seiner und des Kaisers Friedensliebe ist es zu verdanken, dass nicht damals schon ein europäischer Krieg ausgebrochen ist. „Und was hat uns die Nachgiebigkeit gegenüber Serbien gebracht …?“ Berchtold spricht in Gedanken zu sich selbst und erspart sich die Antwort, denn er kennt sie nur zu gut. Während der Kaiser weiterhin regungslos und in Gedanken vertieft auf seinem Platz verharrt, quälen den Minister Selbstzweifel und Frustration. „Ich zweifle immer mehr daran, dass unser bisheriger Kurs, den Frieden um jeden Preis zu erhalten, der richtige Weg Serbien gegenüber ist. Conrad und die anderen Befürworter eines kriegerischen Aktes scheinen auf lange Sicht recht zu behalten …“ Er ist sich selbst gegenüber ungewohnt ehrlich. Berchtold gibt sich in diesem Moment keinen Illusionen hin, sondern ist vielmehr überzeugt, dass viele Menschen in Österreich dieser Meinung sind. „Ein weiteres Mal den Friedenskurs beizubehalten, das erscheint mir vor diesem Hintergrund ungemein schwer, wenn nicht gänzlich unmöglich. Sie würden mich vom Ballhausplatz jagen!“
Eine Bewegung des Kaisers reißt Berchtold aus seinen Gedanken und bringt ihn zurück in die Gegenwart. Franz Joseph hat ein Bild zur Hand genommen und betrachtet es aufmerksam. Seine Gesichtszüge erhellen sich zusehends, sodass Berchtold zuletzt beinahe einen Anflug eines Lächelns um die Mundwinkel des Monarchen erkennen kann. Die Nachdenkpause währt nun schon einige Minuten und Berchtold zeigt bereits erste Anzeichen von Ungeduld, als Franz Joseph das Bild auf den Schreibtisch zurückstellt und sich wieder seinem Minister des Äußeren widmet: „Ein weiteres Mal müssen Wir Uns nun mit Serbien und dessen ungeheuerlichem Verhalten gegenüber Unserem Land auseinandersetzen. Die Friedensliebe und Nachgiebigkeit, mit der die Monarchie bisher die Bewunderung des zivilisierten Europa geerntet hat, hat leider nicht die erhoffte Wirkung erzielt!“
Der Kaiser hält kurz inne, wendet sich dann Berchtold zur Gänze zu und fährt fort: „Wir halten daher nach reiflicher Überlegung ein kraftvolles Auftreten gegen Serbien für unvermeidlich.“ Erst jetzt geht der Kaiser einige Schritte auf den Minister, der sich bei diesen Worten sichtlich erfreut zeigt, zu, macht aber durch unmissverständliche Kopfbewegungen deutlich, dass an den folgenden Worten nicht zu rütteln ist: „Aber eine militärische Aktion ist unter den gegeben Umständen nicht durchführbar.“ Berchtold starrt auf den Kaiser. Dieser fährt fort: „Wir haben Uns daher entschlossen, die Sachlage weiter zu prüfen und vorläufig eine abwartende Haltung einzunehmen. Wir werden jedoch ein Allerhöchstes Handschreiben verfassen und es der von Euch vorgelegten Denkschrift hinzufügen, damit beides dem Kaiser des Deutschen Reiches zu dessen geschätzter Kenntnisnahme vorgelegt werden kann!“
Damit ist die Audienz augenblicklich beendet. Leopold Berchtold verneigt sich und geht rückwärts die zwei Schritte bis zur Tür. Dort dreht er sich um und verlässt das kaiserliche Arbeitszimmer. Im Vorzimmer bekommt er seine Garderobe gereicht und wird von einem Diener zum Ausgang des Schlosses geführt. Im Wagen, der ihn in das Ministerium bringt, sortiert Berchtold seine Gedanken und er versucht, die Entscheidung des Kaisers einzuordnen. Die Festlegung Franz Josephs bedeutet zuallererst, dass eine unmittelbare militärische Aktion ausgeschlossen ist und sich das Gewicht der Aktivitäten auf das diplomatische Feld verlagert. Damit schließt sich der Kaiser seinem und Tiszas Standpunkt an und erteilt jenem von Conrad und den Militärs eine Absage. Aber völlig offen geblieben ist, was gegen Serbien unternommen werden kann, wenn die Stellungnahme aus dem Deutschen Reich eintrifft.
Der Minister resümiert die Audienz mit einem Anflug von Orientierungslosigkeit. Nach Prüfen der Möglichkeiten sieht er jedoch die Chance, die Haltung Berlins in seine Politik einfließen zu lassen. Je nachdem wie die Stellungnahme ausfällt, wird er diese gegen Conrad und seine Militärintervention oder gegen Tisza und seine ausschließlich ungarische Sichtweise ins Treffen führen. Sollte man in Berlin tatsächlich bereit sein und mit der Monarchie auch im Ernstfall den Schulterschluss bilden, so sieht er jetzt kostbare Zeit verrinnen. „Hier bin ich mit Conrad einer Meinung.“ Berchtold fällt es schwer, sich diese Gemeinsamkeit einzugestehen, denn sie bedeutet, dass man womöglich parallel zur diplomatischen Aktion in Berlin militärische Vorkehrungen zu treffen hat.
Der Minister überschlägt kurz den bevorstehenden Zeitaufwand und stellt fest, dass durch die Mission in Berlin ein möglicher Waffengang um drei Tage verzögert wird. „Das sollte zu verschmerzen sein!“ Berchtold beruhigt vor allem sich selbst damit, denn er kennt die militärischen Zusammenhänge der gegenwärtigen europäischen Bündnisverpflichtungen nicht im Detail. Es gilt nun, alle Anstrengung und Energie darauf zu verwenden, die Stellungnahme des deutschen Kaisers einzuholen. Wer könnte diese Mission erfüllen? Nachdenklich kramt Berchtold in seiner Aktentasche nach einem Notizblock, um mögliche Kandidaten zu notieren. Für so eine heikle Aufgabe kommen aus seinem Ministerium nur jene infrage, die sein vollständiges Vertrauen genießen. Bei diesem Gedanken fällt ihm zuallererst ein Name ein, den er nicht notieren muss. Zufrieden zieht er die Hand wieder aus der Tasche und lehnt sich mit einem erleichterten Gesichtsausdruck zurück. „Sektionschef Hoyos ist ein kluger Schachzug!“
***
Als nächster zu bearbeitender Akt liegt der Bericht Nr. 212 auf seinem Schreibtisch. Der Preuße entnimmt dem Akteneinband, dass es sich um ein Protokoll aus Wien handelt. „Aha, Tschirschkys aktueller Bericht!“ Mit seiner seit der Geburt verstümmelten linken Hand fixiert er das Papier und mit der rechten greift er nach der Feder, um, wie er es für gewöhnlich zu tun pflegt, die ihm vorgelegten Aktenstücke mit Randnotizen zu versehen. Der 55-Jährige kann sein leicht erregbares Temperament nur schwer zügeln, als er den Bericht durchliest. Immer wieder hält er mit dem Lesen inne und äußert lautstark seinen Unmut. Die Schilderungen seines Wiener Beamten über das letzte Zusammentreffen mit dem österreichischen Minister des Äußeren, Graf Berchtold, sind das völlige Gegenteil dessen, was anlässlich des jüngsten Ereignisses in Sarajevo seine eigenen politischen Ansichten beherrscht.
Das Attentat auf Erzherzog Franz Ferdinand hat ihn nicht nur in seinem monarchischen Selbstverständnis zutiefst getroffen, sondern ihm auch einen gerade erst gewonnen politischen Freund genommen. Die menschliche Tragödie wird dadurch noch verschlimmert, dass das Attentat die heiß geliebte Segelregatta, die alljährlich in Kiel stattfindet, verdorben hat. Sein Zorn auf die Attentäter ist gewaltig. Von Anfang an ist ihm klar gewesen, dass Wien hierzu mit aller gebotenen Härte in Serbien Sühne und Rechenschaft einzufordern hätte. Der vorliegende Bericht spricht jedoch eine gänzlich andere Sprache. Wie dem Papier zu entnehmen ist, hat sein Botschafter in Wien mit seinen beruhigenden und beschwichtigenden Aussagen womöglich den ohnehin schon zaudernden Berchtold von raschen Vergeltungsmaßnahmen abgehalten. „Wer hat Tschirschky zu diesen Aussagen ermächtigt, von denen er hier berichtet?“
Der deutsche Kaiser ist außer sich und notiert zügellose Randbemerkungen, ein Spiegelbild seiner Emotionen, auf dem Papier. „Mit den Serben muss aufgeräumt werden – und zwar bald! Hoffentlich hält man in Österreich diesmal durch und lässt sich nicht wieder zur Milde hinreißen!“ Nach nicht einmal der Hälfte des Berichtes legt der Mann in Uniform den Stift beiseite, nimmt das Glas Wein, das vor ihm am Schreibtisch steht, und genehmigt sich einen kräftigen Schluck. Energisch lehnt er sich im hohen Stuhl zurück und blickt zu der im Hintergrund des Arbeitszimmers befindlichen Bibliothek. „Wenn sie jetzt nicht Stärke zeigen, sind sie für uns als Bundesgenossen verloren.“ Sein Gesichtsausdruck verfinstert sich bei diesem Gedanken noch mehr.
In den letzten Jahren ist für ihn und seine Regierung immer deutlicher geworden, dass sich die angrenzenden Mächte in Ost und West gegen ihn und sein Reich zusammenschließen und Österreich als einziger und verlässlicher Bündnispartner gegen diese Einkreisung übrig bleibt. Damit sind die beiden europäischen Zentral-Monarchien auf Gedeih und Verderb aneinandergekettet. Er weiß das. Er weiß aber auch, dass man in Wien anders denkt. Wien hat keine Ambitionen als Weltmacht – so wie er, Wien hat keine Seemacht, die nach Weltgeltung giert – so wie er, Wien hat keine Kolonien, die es zu schützen und zu vergrößern gilt – so wie er. Und Wien hat kein Wirtschaftswachstum von beinahe 25 Prozent im Jahr – so wie er es hat. Nein, Österreichs außenpolitische Interessen sind gänzlich anderer Natur. Regional, kleinräumig und höchstens auf den Balkan gerichtet. Darauf ist die Wiener Diplomatie fokussiert. „Daher muss eine Provokation in dieser Interessenssphäre, wie es das Attentat auf Franz Ferdinand darstellt, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln geahndet werden, will man nicht vor der Welt sein Gesicht und seinen Ruf verlieren!“ Für ihn ist diese Schlussfolgerung sonnenklar. „Oder man wird eben als einziger Bündnispartner versagen.“
Den Preußen hält es bei diesen Gedanken nicht mehr auf dem Stuhl. Er geht energischen Schrittes zu seiner Bibliothek, wo er gerne verweilt, wenn es eine verworrene Situation zu lösen gilt. Umgeben von den Heroen der klassischen deutschen Literatur glaubt er, jene Energie zu verspüren, die für Entscheidungen von großer Tragweite unumgänglich ist. „Jetzt oder nie müssen sie Serbien in die Schranken weisen, 1912 und 1913 haben sie es ja leider verabsäumt.“ Er ist sich seiner Sache sicher und schreckt auch vor Konsequenzen nicht zurück. „Wenn Berchtold allein nicht fähig ist, diese Schritte zu gehen, müssen wir ihm den Rücken stärken. Österreich darf nicht fallen!“ Er greift in das Bücherregal und nimmt wahllos ein Werk aus dem sorgfältig sortierten Bestand. Behutsam öffnet er den Einband und blättert langsam die ersten Seiten um. Einzelne Zeilen lesend, immer wieder umblätternd, steht er eine Weile neben dem Regal und verliert sich in der Prosa des Buches. Dann umfasst er mit der rechten Hand einen dickeren Seitenstapel, bringt ihn durch ein vorsichtiges Nachhintenwölben unter Spannung und lässt die einzelnen Blätter aufschlagen. Während ein zarter Luftwirbel sein Gesicht umspielt, fällt ein zwischen den Seiten verstecktes Lesezeichen zu Boden. Der Mann hebt es auf, wirft einen Blickt darauf und steckt es so zwischen die Seiten, dass es am oberen Buchrand heraussteht. Dann stellt er den Band ebenso behutsam in die Lücke zurück, wie er ihn zuvor herausgenommen hat.
Wieder an seinen Schreibtisch zurückgekehrt, nimmt er Tschirschkys Bericht nochmals zur Hand, sucht jene Stelle im Text, an der er zuvor unterbrochen hat, und beginnt weiterzulesen. Erneut quittiert er die Zeilen des Botschafters mit heftigem Kopfschütteln. „Was geht in Tschirschky vor“, poltert es aus ihm heraus, „dass er sich in eine österreichische Angelegenheit auf diese Weise einmischt. Dazu hat ihn keiner ermächtigt! Nachher heißt es dann, wenn es schiefgeht, Deutschland hätte nicht gewollt!“ Noch im Stehen schreibt Wilhelm II. seine zornigen Bemerkungen auf und geht damit aus seinem Arbeitszimmer. Im Vorzimmer gibt er einem seiner Adjutanten den Auftrag, diesen Bericht in die Reichskanzlei zu senden, damit Bethmann Hollweg die entsprechenden Weisungen nach Wien übermittelt. Die Haltung des deutschen Botschafters Heinrich Leonhard von Tschirschky hat sich gegenüber den offiziellen Stellen in Wien schleunigst zu ändern.